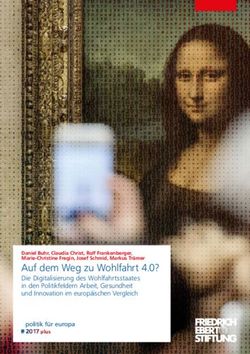LOKKR GEMEINSAM GLOTZEN - Ein digitales Konzept zur Förderung gemeinschaftlicher Film- und Fernseherlebnisse - Steffen Sommerlad
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
LOKKR GEMEINSAM GLOTZEN Ein digitales Konzept zur Förderung gemeinschaftlicher Film- und Fernseherlebnisse Steffen Sommerlad
LOKKR - GEMEINSAM GLOTZEN
Ein digitales Konzept zur Förderung
gemeinschaftlicher Film- und Fernseherlebnisse
Autor
Dipl. Des. (FH) Steffen Sommerad
Matrikelnummer 11737
1. Betreuer Prof. Reto Wettach
2. Betreuer Prof. Dr. Frank Heidmann
3. Betreuer M.A. David Streit
Interface Design
Fachhochschule Potsdam
Masterarbeit zur Erlangung
des Akademischen Grades
Master of Arts (M.A.)
Abgegeben am
29. August 2013
1Eidesstattliche Erklärung
Hiermit versichere ich, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig verfasst und
keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe, alle Aus-
führungen, die anderen Schriften wörtlich oder sinngemäß entnommen wurden,
kenntlich gemacht sind und die Arbeit in gleicher oder ähnlicher Fassung noch
nicht Bestandteil einer Studien- oder Prüfungsleistung war.
Steffen Sommerlad
Berlin, den 29. August 2013
2I N H A LT
1. Einleitung 6
Ausgangshypothese 7
Gestaltungsvorhaben 8
Struktur der Arbeit 8
2. Geschichte 10
Vom Hörfunk über die Telemedien zum Social TV 10
R e f l e xi o n 1 14
3. Social TV 16
Die Funktionen von Social TV Apps 18
Check-in 18
Diskussion, Bewertung, Empfehlung, Links 19
Gamification, Interaktion, Shopping 20
GetGlue, Couchfunk 22
Die Rundshow / Die Macht 23
R e f l e xi o n 2 24
4. Transmediales Erzählen 26
Dina Foxx 27
The Spiral, About:Kate 28
Neue Räume 29
R e f l e xi o n 3 30
5. Kollaborative Zusammenarbeit 32
Der Kern 33
Der Beitrag 34
Die Verbindung, Zusammenarbeit und Entwurf 35
Aktuelle Meinungen 36
R e f l e xi o n 4 38
4I NHALT
6. Neue Sehgewohnheiten 40
Das Geschäftsmodell von YouTube 42
Das Überraschungsmoment 43
Re f l e x i o n 5 44
7. Studienergebnisse 46
Medienradar 47
Social TV - Die Zukunft des Fernsehens? 49
Fernsehen, das neue Super-Medium 51
TV to come. TV to go. 52
Zielgruppe 53
Re f l e x i o n 6 54
8. Qualitative Forschung 56
Experteninterviews 58
Zuschauerinterviews 62
Workshop, Ergebnis 67
Erkenntnismodell 68
Re f l e x i o n 7 69
9. Möglichkeitsräume 70
Entscheidung 72
10. Das Konzept 74
Erstes Feedback, Konzepterweiterung 75
Evaluation, Umsetzung 77
Fazit 78
Informationsarchitektur 80
Prototyp 84
11. Quellenverzeichnis 90
5E I N LE I TU N G
1
Einleitung
und Motivation
Motiviert durch meine an der Köln International School of Design (KISD)
entstandene Ausarbeitung »Wahrnehmung und Visualisierung von Energie« (#1),
bestand von Anfang an der Wunsch nach einem ökologisch-nachhaltigen, vor al-
lem aber gesellschaftlich relevanten Masterthema. Erste Szenarios, Skizzen und
Hypothesen bezogen sich auf die Prozesse rund um Nahrungsmittel und deren Pro-
duktion; auf Mobilität, Warenströme sowie Energiegewinnung und Verbrauch. Nach
einem Workshop und Seminararbeiten zum Thema Einfluss und Vertrauen modifi-
zierte ich dann zu Beginn der Ausarbeitungsphase meinen Schwerpunkt. Auslöser
für die Neuausrichtung auf Social TV waren die folgenden Ereignisse zum Jahres-
beginn: die zum 1. Januar 2013 neu eingeführte Gebühr des Öffentlich-rechtli-
chen Rundfunks und eine investigative Reportage der ARD am 13. Februar 2013
mit dem Titel »Ausgeliefert, Leiharbeiter bei Amazon«.
Mehrere kritische Artikel zum Thema Rundfunkbeitrag sowie Boykottauf-
rufe und Initiativen der Zuschauer ließen auf eine verbreitete Unzufriedenheit mit
dem bestehenden System schließen. Forderungen nach Reformen wurden laut.
Der Amazon-Bericht offenbarte zeitgleich und eindrucksvoll welchen Einfluss das
Medium Fernsehen auch heute noch hat, und wie Medien durch Konvergenz ihre
6EI NLEI TUNG
Potenziale steigern: der Fernsehbericht war lediglich der Auslöser; die Reaktio-
nen, der anschließende öffentliche Dialog, fand im Internet auf Facebook, Twitter
und Blogs statt. Neben der Neugier nach Antworten auf die demokratisch und ge-
sellschaftlich relevante Frage nach den tatsächlichen Partizipations- und Interak-
tionsmöglichkeiten zwischen Sender und Empfänger, motiviert mich auch meine
Leidenschaft für Kino und Bewegtbild an diesem Thema zu arbeiten. Ich möchte
untersuchen wie sozial Social TV wirklich ist und ob die Nutzung dieser Technik
Fernsehen tatsächlicher sozialer macht.
Die einleitend beschriebenen Medienereignisse sind Inspirationsquelle, sie
begrenzen den Fokus dieser Thesis nicht auf Öffentlich-rechtlichen Rundfunk oder
investigativen Journalismus. Die Frage nach Veränderung, Dialog und Partizipa-
tion, wird generell gestellt, mit Fokus auf die im Kontext des Interface- und Inter-
action Design relevanten digitalen Nutzungsszenarios.
1. Können Zuschauer durch Social TV bereits Einfluss auf die
Entstehung von Medieninhalten nehmen?
2. Welche Rück- und Interaktionskanäle offeriert Social TV ?
3. Macht Social TV Fernsehen sozialer, so wie es der Name
suggeriert?
Ausgangshypothese
Menschen möchten teilhaben, mitentscheiden und Meinungen äußern. Men-
schen möchten echte Erlebnisse teilen, sich austauschen und aneinander wachsen.
Der Erfolg der Sozialen Medien verdeutlicht wie groß das bestehende Mitteilungs-
bedürfnis ist. Doch nicht nur der spontane Austausch kurzweiliger Befindlichkei-
ten findet statt. Ein kleiner aber zunehmender Teil der Konsumenten wird dank
zugängiger Produktionsmittel selbst zum Produzenten. Die entstehenden Inhalte
werden eigenständig publiziert und erreichen ein Publikum. Dieser Long-Tail (#2)
der Bewegtbild-Medieninhalte findet gegenwärtig ausschließlich im Internet auf
YouTube und Co. Präsentationsfläche und Publikum.
Die Ausgangshypothese dieser Thesis lautet: Neue Sehgewohnheiten und
Produktionsmöglichkeiten fordern neue Medienerlebnis- und Interaktionsräume.
7E I N LE I TU N G
Gestaltungsvorhaben
Ziel dieser Thesis ist die Entwicklung einer digitalen Plattform die den
Produktions- und Präsentationsprozess von Medieninhalten unterstützt. Medien-
konsum soll als soziales Erlebnis hinterfragt und gegebenenfalls neu definiert und
durch die Lösung erweitert werden. Die Adaption und Erweiterung bereits beste-
hender Mechaniken soll einen direkten und involvierenden Dialog fördern.
Struktur der Arbeit
Die Ausarbeitung beschreibt einleitend die historische Entwicklung der
Rundfunkmedien in Deutschland und stellt durch die Einbindung von Zitaten be-
deutender Medientheoretiker den Bezug zum Thema Social TV her. Anschließend
werden die für das weitere Vorgehen wichtigen design- und medientheoretischen
Grundlagen erörtert: Was ist Social TV und welche Dialog- und Interaktionsmög-
lichkeiten bieten aktuelle Applikationen (Apps) bereits? Die grundlegenden Design-
Pattern von Social TV Apps werden definiert und zur Analyse der Möglichkeiten,
die durch Medienkonvergenz entstehen, erfolgt eine Betrachtung des Transmedia-
len Erzählens, ergänzt und erläutert durch aktuelle Umsetzungen. Aufbauend auf
den Erkenntnissen von Charles Leadbeater (#3) wird dann ermittelt welche Fakto-
ren für das Funktionieren einer offenen und kollaborativen Plattform von Bedeu-
tung sind und wie notwendig Journalisten und Medienexperten neue Interaktions-
möglichkeiten für Zuschauer gegenwärtig einschätzen. Ein Vergleich zwischen dem
klassichen Fernsehen und YouTube zeigt wie partizipativ YouTube im Sinne Lead-
beaters bereits ist und wie stark die Sehgewohnheiten sich gegenwärtig verändern.
Unter Berücksichtigung aktueller Studien zum Thema Social TV und Mediennut-
zung wird die theoretische Zielgruppe und der technische Rahmen des Konzepts
ermittelt.
Im nutzerzentrierten Teil der Untersuchung erfolgt die Aufbereitung der
qualitativen Ergebnisse aus Experten- und Zuschauerinterviews, sowie eines Co-
Creation-Workshops. Diese führen zu einem Erkenntnismodell und Möglichkeits-
räumen. Es erfolgt die Entscheidung für einen Möglichkeitsraum und dessen kon-
zeptionelle sowie gestalterische Ausarbeitung. Zur Evaluation wird abschließend
nochmals der Dialog mit potenziellen Nutzern gesucht. Die Thesis schließt mit ei-
nem Ausblick auf die Realisierungsmöglichkeiten des Konzepts und dem persön-
lichen Erkenntnisfazit.
8»Ich glaube keiner von uns kann wirklich seriös vorher-
sagen wie wir in Zukunft Fernsehen schauen werden
oder eher wie wir Bewegtbild konsumieren werden, jetzt
mal abseits vom Fernsehen als Gerät. Was wir aber de-
finitiv sagen können ist, dass sich das Bewegtbild noch
viel weiter in unseren Alltag reinfressen wird, es wird
noch größer, wir werden überall Bewegtbild haben, auf
Gegenständen, wir werden noch alltäglicher damit um-
gehen. Es wir noch mehr aus dieser Wohnzimmernut-
zung herausgehen. Wir werden in Zukunft wirklich mit
Bewegtbild penetriert werden.« Markus Hündgen (#4)
9GE S C H I C H TE
2
Vom Hörfunk
über die Telemedien
zum Social TV
Eine geschichtlich-
theoretische Annäherung
Die Geschichte des Hörfunks hat ihren Ursprung zu Beginn des 20. Jahrhun-
derts (#5). Begünstigt durch eine Vielzahl technischer Innovationen wird es mög-
lich Tonaufnahmen zu erstellen, diese zu übertragen und anschließend zu empfan-
gen. Das Sender-Empfänger-Modell (#6) beruht auf folgendem Prinzip: akustischer
Schall wird in elektrische Signale übersetzt, diese werden versandt, und anschlie-
ßend, nach Empfang, in akustischen Schall zurückgewandelt und wiedergegeben.
Das magnetische Telefon, dessen Erfindung dem Hörfunk vorausgeht, nutzt zur In-
formationsübertragung noch ein kabelgebundenes Netz. Die neue elektromagneti-
sche Übertragungstechnik des Hörfunks befreit Sender und Empfänger von diesem.
Das Signal wird nun über Sende- und Empfangsantennen durch die Luft übertragen.
In Deutschland erreicht die neue Sendetechnik ihren ersten Höhepunkt
in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts. Zu Propagandazwecken entwickelt und
verkauft das NS-Regime den Volksempfänger. Dieser, im Vergleich zu damaligen
Markenprodukten günstigere Apparat, soll die großflächige Versorgung der Bevölke-
rung mit Empfangsgeräten ermöglichen. Das einseitige Sender-Empfänger-Prinzip
ist in der damaligen Konstellation am schwerwiegensten. Ein Sender, das Propa-
gandaministerium, produziert und verbreitet die Inhalte, hunderttausende Emp-
fänger konsumieren. Der Hörfunk wird zum Massenmedium.
10GESCHI CHTE
Bertolt Brecht kritisiert diesen einseitigen Informationsfluss in dem kein
Raum für Austausch und Interaktion zwischen Sender und Empfänger besteht. Die
damaligen Empfänger konnten sich lediglich durch Aus- oder
Umschalten, oder das illegale Empfangen von ausländischen »Der Rundfunk ist aus einem Distributionsappa-
Sendern, der heimischen Propaganda entziehen. Auch ein rat in einen Kommunikationsapparat zu verwan-
weiteres zeitgleich entstehendes Medium, das Fernsehen, deln. Der Rundfunk wäre der denkbar großar-
welches die akustische Informationsebene des Radios um tigste Kommunikationsapparat des öffentlichen
eine visuelle erweitert, wird Brechts Forderung im Laufe von Lebens, ein ungeheures Kanalsystem, d.h., er
Jahrzehnten nicht gerecht. würde es, wenn er es verstünde, nicht nur aus-
zusenden, sondern auch zu empfangen, also den
Heinrich Hertz entwickelt 1986 die theoretischen Zuhörer nicht nur hören, sondern auch sprechen
und praktischen Grundlagen für das Fernsehen (#8), im zu machen und ihn nicht zu isolieren, sondern
Handel verfügbar sind die ersten Geräte dann 1930. Fünf ihn in Beziehung zu setzen.« Bertolt Brecht (#7)
Jahre später wird an drei Tagen in der Woche jeweils 90 Mi-
nuten Programm gesendet (#9). Die meisten Zuschauer verfolgen dieses zur da-
maligen Zeit in sogenannten öffentlichen Fernsehstuben in Berlin und Hamburg.
1951 noch als Nischenmedium mit lediglich zwei Programmstunden pro
Tag und in schwarz-weiß betrieben, begeistert das Fernsehen schnell die Massen
(#10). Bereits 1955 verfügen 100.000 Menschen in Deutschland über ein Emp-
fangsgerät, 1957 sind es 1.000.000. Das Fernsehen entwickelt sich zum Mas-
senmedium in der BRD. Weitere Meilensteine im Laufe der deutschen Fernsehge-
schichte: das Zweite Deutsche Fernsehen (ZDF) nimmt 1963 seinen Sendebetrieb
auf, 1967 wird erstmals in Farbe gesendet, 1984 starten Kabel- und Privatfernse-
hen gleichzeitig und ab 1989 etabliert sich das Satellitenfernsehen.
Das Bewegtbild ist von Anfang an ein Gemeinschaftsmedium. Zuerst ver-
sammeln sich die Menschen zum Fernsehen in Fernsehstuben und auf öffentli-
chen Plätzen, später schauen sie zuhause im Kreise der Familie oder mit Freunden
und tauschen sich während und anschließend über das Gesehene aus. Das Fern-
sehen liefert Gesprächsstoff, es unterhält, berührt und klärt auf. Es erfüllt sowohl
Bildungs- als auch Unterhaltungsauftrag, Politik ist ebenfalls ein konstanter Pro-
grammbestandteil. Heute wird meist zur Unterhaltung und Zerstreuung gemeinsam
ferngesehen. Im Kontext bestimmter Formate hat sich das Fernsehen in den letz-
ten Jahren vom lange Zeit dominierenden privaten Konsum wieder zu einem öffent-
lichen Ereignis zurückgewandelt. Tausende Zuschauer kommen auf organisierten
Veranstaltungen, sogennanten Public Viewings (#11), zusammen um gemeinsam
Sport- und Musikereignisse zu erleben. Über 100 Kneipen in Deutschland zei-
gen den sonntäglichen Tatort öffentlich (#12) vor einer wachsenden Fangemeinde.
11GE S C H I C H TE
Marshall McLuhans Beschreibung des Fernsehens als ein kühles Medium,
das die persönliche Beteiligung des Publikums verlangt, klingt im Kontext dieser
Ausarbeitung visionär, auch wenn er vermutlich anderes im
»Es gibt ein Grundprinzip, nach dem sich ein Sinn hatte, als eine tatsächliche unmittelbare Partizipation
»heißes« Medium, wie etwa das Radio, von ei- der Zuschauer durch einen Feedback-Kanal. McLuhan be-
nem »kühlen«, wie es das Telefon ist, oder ein schreibt eine aktive intrinsische Beteiligung, ein persönli-
»heißes«, wie etwa der Film, von einem »küh- ches und intimes Weiterfühlen und Weiterdenken des durch
len«, wie dem Fernsehen, unterscheidet. Ein die Sinne rezipierten. Im Hinblick auf den Großteil des ak-
»heißes« Medium ist eines, das nur einen der tuellen Fernsehangebots mutet seine Auffassung verklärend
Sinne allein erweitert, und zwar bis etwas »de- und naiv an. Oder meinte er mit persönlicher Beteiligung
tailreich« ist (…) heiße Medien verlangen daher und Vervollständigung die Energie, die das Fernsehen beim
nur in geringem Maße persönliche Beteiligung, Public Viewing in den Massen provoziert, die Sprechchöre
aber kühle Medien in hohem Grade persönliche und das daraus erwachsende starke Gemeinschaftgefühl?
Beteiligung oder Vervollständigung durch das McLuhans Zitat bietet, nach Neuinterpretation, einen wun-
Publikum.« Marshall McLuhan (#13) derbaren Ausganspunkt: Wie kann das kalte Medium Fern-
sehen die Zuschauer »heiß« machen, wie kann es motivieren
tatsächlich zu partizipieren? Dieses wird erst viel später durch ein weiteres Me-
dium realistisch und möglich, welches die gesamte Kulturindustrie inklusive ihrer
Distributionskanäle verändert.
In den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts beginnt sich das Internet in Haus-
halten und auf Arbeitsplätzen auszubreiten (#15). Durch das digitale Netz können
Menschen sich fortan weltweit und autonom austauschen und
»Alle diese Medien gehen untereinander und mit verbinden. Theoretisch zensiert keine Instanz die stattfin-
älteren wie Druck, Funk, Film, Fernsehen, Tele- dende Kommunikation und den Datenverkehr. Zu Beginn des
fon, Fernschreiber, Radar usw. immer neue Ver- 21. Jahrhunderts entstehen innerhalb dieses offenen Systems
bindungen ein. Sie schließen sich zusehends zu völlig neue Kommunikations- und Interaktionsmöglichkeiten.
einem universellen System zusammen.«
Hans Magnus Enzensberger (#14) Jeder mit dem Netz verbundene Konsument kann im
nächsten Schritt auch zum Produzent werden. Über Foren,
»Die neuen Medien sind ihrer Struktur nach Blogs, Ton-, Bild- und Video-Streaming-Dienste, sowie On-
egalitär. Durch einen einfachen Schaltvorgang lineverlage stehen differenzierte Publikationsmöglichkeiten
kann jeder an ihnen teilnehmen; die Programme für die eigenen Ideen zur Verfügung. Die zeitgleich stattfin-
selbst sind immateriell und beliebig reproduzier- dende Demokratisierung der Produktionsmittel begünstigt
bar. Damit stehen die elektronischen im Gegen- das Entstehen neuer Inhalte im und speziell für das Internet.
satz zu älteren Medien wie dem Buch oder der Hard- und Software, die Tools zur Erstellung und Verbreitung
Tafelmalerei, deren exklusiver Klassencharakter von Inhalten werden für viele erschwinglich und erlernbar.
offensichtlich ist.« Enzensberger (#14.1)
12GESCHI CHTE
Die öffentlich-rechtlichen Rundfunkmedien können, aufgrund ihrer traditi-
onell gewachsenen bürokratischen Strukturen, nur sehr langsam auf die schnellen
und radikalen Veränderungen reagieren, die das Internet for-
dert. Zudem blockieren antiquarische Verwertungsrechte und »Die neuen Medien sind aktions- und nicht kon-
vorgeblich existenzsichernde Auflagen der privaten Sender templativ, augenblicks- und nicht traditionell
eine angemessene Anpassung an die neuen Sehgewohnhei- orientiert. Ihr Zeitverhältnis ist dem der bürger-
ten. Doch auch die privaten Sender reagieren nicht schnel- lichen Kultur, die Besitz will, also Dauer, am
ler, fordert doch die zunehmende Verschiebung der Inhalte liebsten Ewigkeit, völlig konträr. Die Medien
ins Netz auch die Entwicklung von neuen Werbekonzep- stellen keine Objekte her, sie sich horten und
ten. Umschalten, Vorspulen und Wegsehen ist im vielfälti- versteigern ließen.« Enzensberger (#14.2)
gen nichtlinearen Angebot des Internets noch einfacher als
beim linearen Programm der Sender. Letztendlich betreten die Öffentlich-recht-
lichen das neue Terrain und bieten einige Ihrer Inhalte für mindestens 7 Tage in
Online-Mediatheken zum Abruf an.
2013 ist Social TV (#16) das Schlagwort in aller Munde. Es muss und kann
nun etwas passieren, das ist sowohl den Fernsehmachern als auch den Zuschau-
ern bewusst. Doch es erfordert einen offenen Dialog und Ex-
perimente um herauszufinden was möglich und sinnvoll ist. »Zum ersten Mal in der Geschichte machen die
Das Publikum des klassischen linearen Programms, welches Medien die massenhafte Teilnahme an einem
nach wie vor zu Hause auf dem Sofa vor einem Fernsehap- gesellschaftlichen und vergesellschaftlichten
parat konsumiert, vergreist zunehmend. Die Konsumenten produktiven Prozeß möglich, dessen praktische
von morgen, die jüngeren Zuschauer, suchen sich Ihre Me- Mittel sich in der Hand der Massen selbst befin-
dieninhalte mit steigender Tendenz auf legale und illegale den. Ein solcher Gebrauch brächte die Kommu-
Weise im Internet. Längst konsumieren viele Zuschauer die nikationsmedien, die diesen Namen bisher zu
gewünschten Inhalte zu ihrer bevorzugten Zeit. Sie lassen Unrecht tragen, zu sich selbst.«
sich nicht durch das begrenzte Angebot der Sender in ih- Enzensberger (#14.3)
ren Sehgewohnheiten einschränken. Sie produzieren selbst-
ständig Inhalte, veröffentlichen diese unmittelbar nach Fertigstellung für jeder-
mann zugängig, und erwarten eben diese Flexibilität auch von den Inhalten die
sie konsumieren.
13GE S C H I C H TE
Reflexion 1:
Fernsehen war schon immer sozial.
Die Vermutung Fernsehen sei ein isolierendes und unsoziales Medium ist
falsch. Ganz im Gegenteil, Fernsehen ist von Anfang an ein Medium das Menschen
verbindet. Sie konsumieren zu Hause im Kreise der Familie oder mit Freunden und
Fremden im öffentlichen Raum. Hier erblüht das Medium Fernsehen zu einem un-
mittelbaren sozialen und gemeinschaftlichen Ereignis, hier liegt, in Bezug auf li-
neare Sendung und gleichzeitigem Konsum, noch eine seiner Stärken. Fernsehen
fördert den Dialog, die Zuschauer tauschen sich über das Gesehene aus, direkt vor
dem Fernsehgerät oder Tage später im Büro und auf Schulhöfen. Es wird gelacht,
gelästert und gemeinsam mitgefiebert. Fernsehen verfolgt dabei schon immer so-
wohl Unterhaltungs- als auch Bildungsauftrag.
Beim stetigen Wandel hin zum digitalen und nichtlinearen Medienkonsum,
dem wachsenden Austausch über Inhalte im Internet, sollte diese soziale Stärke des
Fernsehens bei einer neuen Umsetzung nicht ausser Acht gelassen werden. Men-
schen wollen auch in Zukunft Erlebnisse teilen, sie wollen gemeinsam Fernsehen.
Während seiner hundertjährigen Geschichte bleibt Fernsehen allerdings
ein Monolog-Medium. Es gibt praktisch keinen ernstzunehmenden Rückkanal vom
Empfänger zum Sender der einen echten Dialog ermöglicht, so wie Brecht und
Enzensberger ihn schon vor Jahrzehnten forderten. Ist Social TV dieser neue Kanal?
14»What if Social TV Is Less
Social Than We Think?«
Peter Kafka (#17)
»Ist es denn so schwer? Mit dem Internet bieten sich
derart viele Möglichkeiten, frischen Wind in die ver-
staubte Fernsehwüste zu bringen. Wie lange will man
sich in den Fernsehanstalten noch dem Internet ver-
schließen bzw. dieses wenn, dann nur halbherzig einbin-
den? Meinungsbilder in den sozialen Netzwerken werden
weitestgehend ignoriert. Hätte die ARD beispielsweise
gewusst, dass sich innerhalb kurzer Zeit Fanclubs auf
Twitter für den einmalig im Münchener Tatort auftreten-
den Charakter Gisbert Engelhardt bilden würden, hätte
man diesen sicherlich nicht – Achtung Spoiler – am
Ende der Folge sterben lassen. Ein Fernsehprogramm,
dass spontan auf die Live-Reaktionen seiner Zuschauer
reagieren kann, bleibt wohl mein Hirngespinst.«
Mareike Schönherr (#18)
»Zusammenfassend bezeichnet Social-TV das
Zusammenspiel aus Bewegtbildinhalten, zu-
sätzlichen (nutzergenerierten) Inhalten dazu,
den Interessen und sozialen Beziehungen der
Nutzer, und den (Nutzungs-)Daten, die sie er-
zeugt.« Markus Barth (#19)
15S OC I A L TV
3
Social TV
Ein
Definitionsversuch
Social TV ist ein diffuser Begriff. Immer mehr Social TV Anwendungen um-
werben den Zuschauer mit differenzierten Funktionsangeboten. Ausgangspunkt
der Wortkreation ist die im Kontext des Web 2.0 entstandene Bezeichnung Social
Media. Diese assoziiert unmittelbar führende Internetunternehmen wie Facebook,
Twitter, YouTube und Google und steht für digitale Medien und Technologien die
einen schnellen Austausch zwischen Menschen ermöglichen. Das Teilen, Kom-
mentieren und Produzieren von Medieninhalten steht im Vordergrund dieses Dia-
logs. Durch die fortschreitende Demokratisierung der Produktionsmittel kann jeder
Konsument zum Produzent werden, Social Media erlaubt es im nächsten Schritt
die eigenen Inhalte schnell und unkompliziert mit einer Gemeinschaft zu teilen.
Räumliche Distanz ist kein Hindernis mehr für Kollaboratio-
»Ich glaube gar nicht so sehr, dass es [Social TV, nen, und aufgrund der starken Vernetzung erreichen Inhalte
Anmerkung des Verfassers] dem Zuschauer wirk- durch sogenannte virale Effekte auch ohne großes Budget
lich effektiv etwas bringt, sondern vor allem den oder inszeniertes Marketing schnell ein großes Publikum.
Sendern. Es ist eine sehr aus Produzenten-Sicht
geleitete Interessenlage, nicht aus Konsumen- Social Media steht folglich für Dialog, für unend-
tensicht.« Markus Hündgen (#4) lich viele gleichzeitig stattfindende Gespräche. Das klassi-
sche Fernsehen steht für Monolog, für ein lineares Angebot
ohne direkten Feedback-Kanal. Die Wortschöpfung Social TV
16SOCI AL TV
verweist also auf eine Erweiterung des klassischen Fernseherlebnisses um eine Di-
alogebene, um einen Rückkanal. Viele etablierte Sender gehen ihre ersten Schritte
in Richtung dieser neuen Offenheit indem sie Facebook- und Twitter-Profile für
Sender, Sendungen und Moderatoren anlegen. Hierdurch ermöglichen sie ihren
Zuschauern Meinungen während und nach der Ausstrahlung zu hinterlassen. Die
Sender erhalten auf diesem Weg ein direkteres Feedback und können besser ein-
schätzen wer ihre Inhalte konsumiert.
Social TV bedeutet: Zuschauer informieren Freunde und Bekannte spontan
durch die sozialen Kanäle über ihre Fernsehgewohnheiten. Ergänzend zum klassi-
schen Fernsehgerät erfolgt die Nutzung dieser Zusatzfunktionen über den Second
Screen. Mit Hilfe von Smartphone, Tablet oder Laptop werden die Kommentare
und Likes unabhängig vom Fernsehgerät verschickt und geteilt. Gegenwärtig über-
wiegt der Eindruck, dass die klassischen Sender ratlos sind
wie sie sinnvoll mit den neuen Möglichkeiten umzugehen »Social-TV: Die Verbindung von Sozialen Netz-
haben. Oft fungieren die sozialen Mechaniken in den Um- werken und Fernsehen. Man will die junge Ge-
setzungen als ein vom Format losgelöster und eigenständi- neration der Digital Natives binden, bevor sie
ger Kanal. Die Inhalte werden wie gewohnt unter Ausschluss gar nicht mehr linear fernsieht.«
der Öffentlichkeit produziert. Es gibt keinen echten Dialog, Daniel Bröckerhoff (#4)
dieser wird lediglich simuliert, in der Hoffnung eine bessere
Quote zu erzielen und durch die Einbindung der neuen Medien interessanter für
jüngere Zuschauer zu werden. Socia TV, als Marketing-Instrument, bedeutet aktu-
ell vor allem für die Sender einen Mehrwert.
Wird Fernsehen noch sozialer, wenn der Zuschauer durch das Angebot einer
Online-Mediathek selbst entscheiden kann wann er welche Sendung sieht? Oder ist
Fernsehen, wie eingangs beschrieben, nur dann wirklich sozial, wenn Zuschauer
vor dem Bildschirm zusammenkommen? Bevor im nächsten Schritt auf den Funk-
tionsumfang von Social TV Apps eingegangen wird erfolgt an dieser Stelle eine Ka-
tegorisierung der aktuellen Umsetzungen nach Absender und Kontext:
1. Sendereigene Plattformen, Mediatheken und Apps
2. Sendungsspezifische Webseiten und Apps
3. Inhaltsübergreifende Plattformen, Streaming-Dienste und Apps
von Drittanbietern
17S OC I A L TV
Die Funktionen
von Social TV Applikationen
Appplikationen kommen auf Smartphone und Tablet zum Einsatz und sind,
bedingt durch die im Vergleich zu Computer und Laptop kleineren Bildschirme,
im Funktionsumfang limitiert. In einem gelungenen Second Screen-Szenario er-
weitert die App das Fernseherlebnis durch ein Angebot von Zusatzfunktionen. Die
Nutzer werden so stärker eingebunden, das Storytelling endet nicht vor der Matt-
scheibe oder nach Sendeschluss. Die Zahl der Apps die Fernsehen und Soziale
Medien verknüpfen steigt stetig, in Amerika gibt es bereits über 50: GetGlue, Miso,
Tweek, wywy, Couchfunk, Zapitano, waydoo, TunedIn und Shair, um nur einige der
bekannteren amerikanischen und deutschen Anbieter zu nennen. Jede App bietet
einen spezifischen Funktionsumfang. In Anlehnung an die vom amerikanischen
Architekten und Systemtheoretiker Christopher Alexander ent-
wickelte Pattern-Language (#20), die exemplarische Muster
definiert, welche übergreifend adaptierbar sind, werden diese
Funktionen hier als Pattern definiert. Generell beschreibt jedes
Pattern ein Problem und seine Lösung. Alle hier beschriebe-
nen Pattern wurden vor ihrem Social TV Einsatz bereits in an-
derem Kontext genutzt. Der Funktionsumfang aktueller Social
TV Apps setzt sich aus den folgenden Pattern zusammen (#21).
Check-in
Nutzer können sich registrieren oder über ihr Facebook
bzw. Twitter-Profil anmelden. So wird das Potenzial von bereits
etablierten Netzwerken implementiert und der Anmeldevorgang
erleichtert. In Verbindung mit der Anmeldung entsteht ein Nut-
zerprofil. Durch Check-ins (vgl. Abb. 1) beim Medienkonsum
dokumentiert das System langfristig die Verhaltensweisen des
Nutzers, für diesen und andere einsehbar.
Abb. 1: wywy-App: Check-in, Bewertung und Empfehlung
18SOCI AL TV
Diskussion
Ein integrierter oder importierter Chat (Twitter, Face-
book) ermöglicht dem Nutzer den unmittelbaren Austausch
mit anderen Zuschauern (vgl. Abb. 2). Parallel zum Fernseh-
konsum sind so Live-Diskussionen über die Inhalte möglich.
Bewertung
Über Bewertungsmöglichkeiten in Form von Kommen- Abb. 2: Couchfunk-App: Diskussion
taren und vorgegebenen Skalen kann der Nutzer seine Mei-
nung hinterlassen (vgl. Abb. 3). Auf Dauer entsteht so durch
Schwarmintelligenz ein Mittelwert aller Bewertungen, der eine
Kategorisierung der Medieninhalte nach Beliebtheit ermöglicht.
Empfehlung
Nutzer sprechen persönliche Empfehlungen aus und
teilen diese über soziale Netzwerke mit Freunden (vgl. Abb. 1).
Oder das System selbst spricht nutzerzentrierte Empfehlungen
aus, basierend auf den spezifischen Konsumgewohnheiten oder Abb. 3: Couchfunk-App: Bewertungsskala
denen von Nutzern mit ähnlichen Interessen. Hierbei wird oft
auch auf die bei anderen Netzwerken (z.B. Facebook) vorlie-
genden Nutzerdaten zurückgegriffen.
Weiterführende Links
Mit Hilfe von Direktlinks oder per Programmierschnitt-
stelle (API) importierte Daten werden weiterführende Informa-
tionen, Videos und Bilder angeboten. Im Filmbereich macht
z.B. das Einbinden von Filmdatenbanken (IMDb), Wikipedia
und offiziellen Film-Webseiten Sinn. Durch ergänzende Infor-
mationen zum Film (Regisseur, Entstehungsjahr, Schauspie-
ler) oder der behandelten Thematik entsteht für den Nutzer so
ein praktischer Mehrwert innerhalb des Systems (vgl. Abb. 4).
Abb. 4: Couchfunk-App: Weiterführende Links, Shopping
19S OC I A L TV
Gamification
Durch Gamification kann die Attraktivität und Exklusivi-
tät der App gesteigert werden (vgl. Abb. 5). Wettbewerb, Aufga-
ben und Belohnung fördern die Nutzung der App, den Austausch
mit der Gemeinschaft, und das Bewerten und Kommentieren
von Medien. Im Rahmen eines Belohnungs- bzw. Gamification-
Konzepts sammelt der Nutzer z.B. durch Check-ins Auszeich-
nungen oder Punkte. Diese können dann später in Gutscheine
oder Vergünstigungen eingetauscht werden. Über Gamification-
Elemente werden die eigenen Verhaltensweisen und Erfolge in-
nerhalb einer Gemeinschaft vergleich- und sichtbar.
Interaktion
Eine Interaktion ist die stärkste Form der Partizipation.
Nutzer können sich während der Sendung an Umfragen oder
Abstimmungen beteiligen und so direkt in den Sendungsverlauf
Abb. 5: GetGlue-App: Gamification
eingreifen (vgl. Abb. 6). Die Interaktion ist der einzige Rückka-
nal zum Sender mit echtem partizipativem Charakter.
Shopping
Aufbauend auf dem bereits beschriebenen Prinzip der
weiterführenden Inhalte können auch zum Format passende
Shops oder Links zu Büchern, DVDs, CDs, On-Demand-Diens-
ten und Merchandise-Artikeln eingebunden werden (vgl. Abb.
4). Der Nutzer gelangt so bei Interesse direkt und bequem mit
Hilfe der App zum gewünschten Artikel.
Hauptziel einer Social TV App und ihrer Funktionen ist
die langfristige Unterhaltung und Bindung ihrer Nutzer. Alle be-
schriebenen Pattern drehen sich um die Lösung dieses Problems.
Die beschriebenen Mechaniken kommen alle aus dem Umfeld
der Sozialen Medien und offerieren auf unterschiedlichen Ebe-
nen Mehrwert. Die Diskussions- und Empfehlungsfunktionen
Abb. 6: Die Macht-App: Interaktion
20SOCI AL TV
beantworten grundlegende menschliche Kommunikationsbedürfnisse. Gamifica-
tion bedient die Lust am Vergleich und dem Wettbewerb innerhalb einer Gemein-
schaft. Die Integration von Shop-Elementen löst für den Betreiber das Problem der
Rentabilität und stillt zudem die Konsumbedürfnisse des Nutzers. Das folgende
Diagramm (vgl. Abb. 7) veranschaulicht welche Pattern als Basisfunktionen drin-
gend notwendig sind um konkurrenzfähig zu sein, welche die App besonders at-
traktiv und exklusiv, und welche das Konzept profitabel machen. Um die Funkti-
onsweisen besser zu verstehen, werden, stellvertretend für das große Angebot an
Social TV Umsetzungen nachfolgend zwei konzeptionell unterschiedliche kommer-
zielle Smartphone-Applikationen von Drittanbietern beschrieben, sowie ein sen-
dungsspezifisches Konzept, das im Gegensatz zu diesen einen bemerkenswerten
Fokus auf Interaktion legt.
notwendig exklusiv rentabel
Check-in
Diskussion
Bewertung
Empfehlung
Links
Gamification
Interaktion
Shopping
Abb. 7: Social TV Funktionen und ihre Relevanz
21S OC I A L TV
GetGlue
Besonders umfassend war das Konzept des amerikanischen Social Net-
work GetGlue. Im Juni 2010 auf den Markt gekommen, ermöglichte das System
bis zur Überarbeitung 2012 den Check-in bei einem Großteil der kulturell bedeu-
tenden Medien: Serien, TV-Shows, Kinofilme, Bücher und Musik. Ergänzend dazu
konnte der Nutzer auch Fan von Gerichten, Hobbys, berühmten Persönlichkeiten,
Bands und aktuellen Themen werden. Jetzt ist GetGlue deutlich reduzierter und
bedient nur noch die Bereiche Fernsehen, Film und Sport. Geblieben ist das Ga-
Abb. 8: GetGlue-Logo mification-Prinzip. Der Nutzer sammelt durch Check-ins digitale Badges (Abb. 5),
die auf seinem GetGlue-Profil dokumentiert werden. Ab einer bestimmten Anzahl
kann er sich diese dann als reale Sticker per Post nach Hause schicken lassen.
Facebook ist nahtlos eingebunden, so dass die Check-ins und Präferenzen schnell
mit Freunden und Bekannten geteilt werden können. GetGlue verlängert das Kon-
sumerlebnis durch ein Belohnungssystem weit über die Konsumsituation hinaus
in den Lebensraum des Nutzers. Immaterielle Fernseherlebnisse erhalten durch
die passenden Sticker eine physische Repräsentanz. Je nach Platzierung der Sti-
cker werden Fernseherlebnisse so für Familie, Freunde und Fremde sichtbar, und
fördern einen Dialog. Der eigene Fernsehkonsum wird überdies durch die Sticker
messbar. Abstrakte Konsumzeit wird in eine konkrete Einheit übersetzt.
Couchfunk
Das Kernkonzept des deutschen Social Network Couchfunk ist der Aus-
tausch während des Fernsehens, das gemeinsame Erleben von Sendungen, auch
wenn man nicht gemeinsam vor dem Fernsehgerät sitzt. Die Nutzer können außer-
dem Sendungen kommentieren, bewerten, weiterempfehlen, einen Timer einstel-
len, der sie an eine Ausstrahlung erinnert und sich wie bei GetGlue in Formate ein-
checken. Couchfunk löst die parallel zur Sendung stattfindende Kommunikation
durch eine Kombination aus internem Chat und Twitter-Integration. Auf der Start-
seite wird das aktuelle Diskussions- und Informationsangebot übersichtlich in vier
Abb. 9: Couchfunk-Logo Bereiche unterteilt: das aktuell laufende Programm, die aktuellen Top 10, Unsere
Tv-Tipps und Magazin. Nutzer von Couchfunk können sowohl als stiller Beobachter
passiv die Gespräche der Anderen verfolgen, als auch aktiv, durch das Erstellen von
eigenen Meldungen, teilhaben. Sie können dauerhaft den Konsumgewohnheiten
und Empfehlungen eines anderen Nutzers folgen indem sie ihn durch einen Klick
zum »Helden« ernennen. Da das Informationsangebot bei stark frequentierten For-
maten schnell zu einer unübersichtlichen Flut wird lassen sich die über Hashtags
ermittelten und eingebetteten Twitter-Meldungen auch deaktivieren, so dass nur
22SOCI AL TV
noch der interne Couchfunk-Chat sichtbar ist. Wie bei GetGlue steckt auch hinter
Couchfunk ein kommerzielles Intresse. Die gesammelten Nutzerdaten werden für
Werbe- und Marketingzwecke ausgewertet. Couchfunk bietet passend zu den ent-
sprechenden Inhalten außerdem Direktlinks zu kostenpflichtigen Downloads, Kon-
sumartikeln und externen Shops.
Die Rundshow / Die Macht
Die Rundshow ist ein am 14. Mai 2012 gestartetes vierwöchiges und Me-
dienexperiment und Nachrichtenformat des Bayerischen Rundfunks. Hauptinitia-
tor ist der BR-Redakteur Richard Gutjahr, gesendet wurde täglich aus der hinteren Abb. 10: Rundshow-Logo
Hälfte des sowohl namentlich als auch konzeptionell ver-
wandten Rundschau-Studios. Der Kern des Rundshow-Kon- »Ja, die erste »Rundshow« war zu vollgepackt.
zepts ist ein direkter Dialog zwischen Sender und Empfänger Aber das gehört zur Testphase. Und wenn dann
durch die Einbindung von Social Media und einer eigens für irgendwer den per Webcam zugeschalteten Leu-
die Sendung entwickelten App. Die Zuschauer wurden wäh- ten noch klarmacht: Setzt eure verdammten
rend jeder Folge ständig aufgefordert zu partizipieren und so Kopfhörer auf! Nicht essen, nicht tippen, man
direkten Einfluss auf den Verlauf der Sendung zu nehmen. versteht kein Wort!, dann könnten die Inhalte
Die App »Die Macht« fungierte als logische Erweiterung der tatsächlich in den Vordergrund rücken - und die
klassischen Fernbedienung und ermöglichte den Partizipie- lustige Technikspielerei wäre nur mehr Mittel
renden per »Daumen hoch« oder »Daumen runter« akusti- zum Zweck. Dann könnte die »Rundshow« sogar
sches Feedback ins Studio zu senden (Abb. 6). Der Dialog Zuschauer anlocken, die keinen eigenen Twit-
war zudem via Facebook, Twitter, YouTube und über die sen- ter-Account haben und »irgendwas mit Medien«
dungseigene Webseite möglich. Per Google Hangouts und machen.« Anne Haeming (#22)
Skype wurden weltweite Liveschaltungen zu Zuschauern und
Interviewpartnern aufgebaut und in den Sendungsplot integ- »Wir haben nach der Sendung noch ne Stunde
riert. Die recht chaotisch ablaufenden Folgen der Rundshow dagesessen und haben alles gelesen was uns die
zeigten einerseits wie lebendig und facettenreich Zuschau- Leute während der Show geschrieben haben und
erpartizipation sein kann, und andererseits wie schwierig es was sie gerne geändert haben möchten, was sie
ist ständige Improvisation zu organisieren und die Aufmerk- gut fanden, was sie schlecht fanden, und jetzt
samkeit der Zuschauer durch das entstehende »Medienrau- kommt das phänomenale: Wir haben‘s gleich
schen«, die Konkurrenz zwischen TV, Twitter und Co., nicht am nächsten Tag umgesetzt. Und die Leute ha-
zu überfordern. ben darauf reagiert und waren dankbar, dass wir
ihnen zuhören. Ich glaube das ist etwas, das wir
Die Rundshow ist ein eindrucksvolles Beispiel alle lernen müssen als Medienmacher, als Jour-
für echte und spontane Partizipation. Die Zuschauer konn- nalisten der Zukunft, dass wir unser Publikum
ten nicht nur während der Sendung eingreifen und sich ernst nehmen müssen.« Richard Gutjahr (#23)
23S OC I A L TV
beteiligen, sie konnten über das Internet auch an den öffentlich zugängigen Re-
daktionssitzungen zwischen den Sendungen teilhaben. Von Zuschauerseite einge-
brachte konstruktive Kritik am Format wurde direkt im Anschluss an die tägliche
Ausstrahlung von den Redakteuren gesichtet und im Konzept der folgenden Sen-
dung berücksichtigt.
Die Rundshow bietet aufgrund des offenen Live-Konzepts viel Raum für
spontane Interaktion mit dem Publikum. Doch wie kann Partizipation im Kontext
fiktionaler Inhalte stattfinden, die sich über mehrere Folgen erstrecken und deren
Dramaturgie eine stärkere Kontrolle verlangt. Zur Klärung dieser Frage erfolgt im
nächsten Kapitel eine Untersuchung des Transmedialen Erzählens.
Reflexion 2:
Social TV bedeutet nicht Partizipation.
Social TV offeriert dem Nutzer generell formatunabhängige Zusatzfunkti-
onen über einen separaten Kanal. Social TV ist einerseits Austausch während des
Fernsehens via Second Screen und Social Media, und andererseits ein Big Data
Mess- und Marketinginstrument. Social TV greift dabei oft auf bestehende Infra-
strukturen wie Facebook und Twitter zurück. Gegenwärtig bedeutet Social TV vor
allem oberflächlichen Smalltalk, durch Bewertungen Einfluss auf andere ausüben,
und im Gegenzug durch die Bewertungen Anderer beeinflusst werden. Echte In-
teraktion mit dem Gesehenen hingegen ist sehr selten. Einen Einfluss auf das li-
neare Programm und dessen Protagonisten gibt es nur in Ausnahmefällen.
Eine Ausnahme ist die Rundshow. Dieses vierwöchige Medienexperiment
war konzeptionell von Anfang an auf Partizipation und Transparenz ausgelegt. Eine
eigens für die Sendung programmierte App fungierte als direkter Rückkanal zum
Sender. Hier wurde die Forderung nach Dialog, die Enzensberger und Brecht for-
mulierten, technisch umgesetzt.
Der Eindruck entsteht, dass echte Interaktion mit dem Gesehenen nicht
durch inhaltsübergreifende Social TV Apps von Drittanbietern möglich sein kann,
solange keine Offenheit und die entsprechende Infrastruktur auf Seiten der Sen-
der existiert. Durch das bloße Addieren von Social Media Elementen auf beste-
hende Konzepte wird dauerhaft nur ein oberflächlicher Austausch möglich.
24»Wir müssen sie teilhaben lassen am Entstehen unse-
rer Geschichten. Wir müssen sie ernst nehmen und zu-
hören lernen. Wir müssen ihre Anregungen prüfen, über
ihre Kritik diskutieren, kurz: ernsthaft den Dialog füh-
ren. Kritische Fragen lassen sich nicht mehr abtun wie
einst, als es bloß Leserbriefseiten und Zuschauertelefone
gab; Chats nach der Sendung und Pseudoaktionen auf
Facebook sind auch zu wenig. Journalisten müssen sich
grundlegend öffnen, um besser zu werden und ihr Publi-
kum immer neu zu werben. Sie müssen so gesprächsbe-
reit und transparent werden, wie es nur geht«
Daniel Bröckerhoff (#24)
»Social-TV ist eigentlich nur ein Übergangs-
werkzeug, eine Brückentechnologie, hin zu
einem komplett geänderten Nutzungsverhal-
ten. Social-TV setzt auf dem auf was wir ken-
nen und nutzt einfach die gleichen Wege, die
Kommunikationsmittel, das wird aber nicht
auf Dauer halten.« Markus Hündgen (#4) »The art of storytelling has always been sub-
ject to change. Through the process of digita-
lization and the accompanying media conver-
gence, we’re now on the verge of a quantum
leap. We are no longer viewers, listeners, rea-
ders, users, or players.Today, we are »expe-
riencers«, whose roles and behaviors change
based on how we use and approach media.«
Transmedia Manifest (#25)
25TR A N S M E DI A LE S E RZÄ H LE N
4
Transmediales
Erzählen
Transmediales Erzählen ist die Medien und Format übergreifende Inszenie-
rungstechnik von Geschichten. Pionier auf diesem Gebiet und Autor diverser Bü-
cher zum Thema ist Henry Jenkins, Direktor des Comparative Media Studies Pro-
gram am Massachusetts Institute of Technology (MIT) (#26). Laut Jenkins fördert
die Integration von unterschiedlichen Medien (wie z.B. Buch, Fernsehen, Film,
Computerspiel und Comic) in den Erzählfluss die Entstehung eines einzigartigen
und intensiven Unterhaltungserlebnisses (#27). Der Inhalt ist dabei so aufberei-
tet, dass der Rezipient im Laufe der Geschichte das Medium wechseln muss bzw.
kann um tiefer in den Erzählfluss einzutauchen. Jedes Medium wird dabei ent-
sprechend seiner Vorteile und Eigenschaften genutzt und trägt so seinen originä-
ren Teil zur Erzählung bei. Digitale Medien sind prädestiniert für die Interaktion
des Zuschauers mit der Geschichte, dem Erzähler oder den Protagonisten. In der
Markenkommunikation von Unternehmen ist transmediales Erzählen, die Nutzung
von medienübergreifenden Synergieeffekten, schon lange von Bedeutung: Konsu-
menten werden an unterschiedlichen Orten abgeholt um ein umfassendes Mar-
kenerlebnis zu ermöglichen. Die Anzahl der potentiellen Rezipienten steigt durch
differenzierte Einstiegsmöglichkeiten einer medien- und formatübergreifenden In-
szenierung, und eine Heranführung an neue, bisher wenig genutzte, Medien wird
forciert. Präferieren Nutzer z.B. ältere Medien wie Fernsehen, Film oder Buch, so
26TRANSM EDI ALES ERZÄHLEN
werden sie in ihrem vertrauten Umfeld angesprochen und abgeholt. Ist das Inte-
resse dann geweckt und der Rezipient folgt der Geschichte, kann er im nächsten
Schritt durch den transmedialen Erzählfluss herausgefordert und motiviert werden
neue Medien wie das Internet, Apps oder Computerspiele zu entdecken.
ARTE, der Bayerische Rundfunk und das ZDF haben in den letzten Jahren
bereits experimentiert und erste Erfahrungen mit transmedialen Erzählstrukturen
und der aktiven Zuschauerbeteiligung gemacht. Im Folgenden werden relevante
nationonale und internationale Projekte beschrieben und auf ihre Medienbestand-
teile und die angebotenen Kommunikations- und Informationsrichtungen unter-
sucht. Zitate der Fernsehmacher aus Interviews und Berichten geben Auskunft
über in die gewonnenen Erkenntnisse und das beobachtete Zuschauerinteresse.
Wer rettet Dina Foxx? (2011)
Dina Foxx (#28) ist in erster Linie ein Alternate Reality Game (ARG) über die
Datenschutz-Aktivistin Dina die unter dem Pseudonym »Datagrrl« das Ziel verfolgt
Internetnutzer und Publikum für die Themen Online-Sicher-
heit und Datenmissbrauch zu sensibilisieren. Der gleichna- »Den Film haben knappe 700.000 Menschen in
mige ZDF-Fernsehfilm beschreibt Dinas digitale Arbeitswelt der Erstausstrahlung gesehen… Wir hatten ins-
und das Verschwinden ihres Freundes Vasco. Als dieser tot gesamt 2 Millionen Webseiten-Abrufe innerhalb
aufgefunden wird beginnt Dina auf eigene Faust zu recher- der 3 wöchigen Spiellaufzeit. Und beim ARG ha-
chieren und wird plötzlich selbst zur Hauptverdächtigen. Der ben sich 1000 User angemeldet und aktiv mit-
Film endet abrupt nach Inhaftierung und Verhör von Dina und gemacht.« Milena Bonse (#29)
fordert den Zuschauer auf selbst in die Rolle des Ermittlers
zu schlüpfen um den Fall zu lösen. Dies war durch die Teilnahme an einem inter-
aktiven und begleitenden Online-Spiel möglich, welches in zwei Schwierigkeits-
stufen angeboten wurde. Der Fernsehfilm ist in diesem Kon-
zept Ausgangspunkt für den Einstieg in die Online-Welt des »Wir haben zwei interessante Erkenntnisse ge-
Spiels. Von dort gab es keinen partizipativen oder dramatur- macht: Die Kommentarfreudigkeit und die
gischen Rückweg in die TV-Welt. Das anschließende Online- Schwarmintelligenz sind wirklich enorm. Auch
Spiel erstreckte sich über 3 Wochen, in dieser Zeit wurden ein sehr schwieriges Rätsel wurde innerhalb von
regelmäßig neue Rätsel und Hinweise über Facebook-, Flickr- wenigen Minuten von der aktiven Community ge-
und YouTube-Profile veröffentlicht. Wer kein Interesse an ei- löst.« Milena Bonse (#29)
ner aktiven Teilnahme hatte konnte über regelmäßig angebo-
tene Video-Zusammenfassungen das Geschehen passiv auf der Webseite verfolgen.
Ergänzend zum virtuellen Teil wurden Live-Events inszeniert, auf denen die Spie-
ler via Geocaching versteckte USB-Sticks aufspüren und auswerten mussten.
27TR A N S M E DI A LE S E RZÄ H LE N
The Spiral (2012)
The Spiral (#30) ist eine fünfteilige Serie über den Raub von 6 berühmten
Kunstwerken, deren Episoden gleichzeitig in 8 europäischen Ländern ausgestrahlt
wurden. Passend zu Serie gab es eine begleitende Webseite,
»In der Regel bleiben 90% der Zuschauer pas- die die Zuschauer immer wieder durch kleine Spiele und
siv, 9% gehen auf die Webseite und 1% beteili- Aufgaben zu einer aktiven und kreativen Teilnahme an der
gen sich aktiv am Konzept und der Diskussion. Lösung des Kriminalfalls aufforderte. Wer dem Aufruf der
Unsere Herausforderung ist es also die 90% in Hauptdarsteller folgte und die Serie im Internet besuchte
Richtung der 9% und die 9% in Richtung der erhielt die Möglichkeit Elemente oder die Handlung der Se-
1% zu bewegen.« Federico Dini (#31) rie mitzugestalten. Ihren Höhepunkt fand die Inszenierung
in einem Live-Event am 28. September um 21 Uhr MEZ vor
dem Europaparlament in Brüssel. The Spiral war somit auf drei Ebenen erlebbar:
im TV, im Internet, und einem Live-Event.
About:Kate (2013)
About:Kate (#32) ist eine crossmediale Fernsehserie deren Handlung die
psychische Verfassung der Hauptperson Kate Harff zum Inhalt hat. Kate, eine
junge Frau, weist sich aufgrund einer Identitätskrise eigenständig in eine psychi-
atrische Klinik ein. Sie ist Ende 20, und ihre Erlebens- und
»Das Von-allem-zu-viel-und-zu-schnell spiegelt Gefühlswelt setzt sich mit Verhaltensweisen und Problemen
sich auch in der parallelen Aufbereitung der Se- der gleichaltrigen Zielgruppe, den Digital Natives, ausein-
rie in den Social Networks und auf dem Smart- ander. Passend zur Serie inszenierte ARTE eine Webseite,
phone wider. Wo sich relevante Informationen das Facebook-Profil der Hauptperson und bot eine App für
oder originelle Mitmach-Möglichkeiten in dem Smartphone und Tablet an. Der Zuschauer konnte sich via
Stream von Postings und Spielchen verbergen, Facebook mit Kate »anfreunden« und während der Sendung
ist eine sich schnell erschöpfende Herausforde- über die App mit der jeweiligen Folge synchronisieren. Die
rung. Aber wann hat man sich vom Fernsehen Software erkannte über das Audiosignal Episode und Szene
sowie von dessen crossmedialer Weiterführung und lieferte so präzise Zusatzinformationen auf dem Second
das letzte Mal so richtig überfahren gefühlt?« Screen. Ergänzend zu thematischen Links und einem wach-
Hannah Pilarczyk (#33) senden Fragenkatalog, der eine Art Selbsttherapie ermög-
lichte, konnten die Zuschauer durch das Hochladen von eige-
nem Foto- und Videomaterial kreativ an der Entstehung der Serie teilhaben. Diese
Beiträge entstehen motiviert durch Aufgaben auf der Webseite, konnten dort in ei-
ner Galerie durchstöbert und bewertet werden, und wurden ab der 3. Folge in Sze-
nen der Serie eingebaut. Im Gegensatz zum linearen Dina Foxx-Konzept fand hier
ein wechselseitige Interaktion zwischen Sender und Empfänger statt (Abb. 11).
28TRANSM EDI ALES ERZÄHLEN
Dina Foxx
TV Webseite Live
Erstausstrahlung Event
Ebene 1 (passiv)
Fernsehfilm
Partizipation:
Ebene 2 und 3
About:Kate
TV/Internet-Stream Webseite
Kontakt über Facebook-Profil,
Partizipations-Aufgaben: Zuschauer
Episode 1 können Fotos und Videos hochladen
Ab der 3. Folge wird
das Foto- und Videomaterial
Episode 2 der Zuschauer integriert
Episode 3
Parallel zur Folge:
Synchronisation über
eine App, passende
Zusatz-Infos und Fragen Episode 4
Abb. 11: Transmediale Dramaturgie von Dina Foxx und About:Kate im Vergleich
Neue Räume
Die beschriebenen Beispiele offerieren dem Zuschauer durch transmedi-
alen Erzählfluss neue Erlebnis- und Partizipationsräume. Auch die staatliche Film-
behörde Kanadas National Film Board of Canada (NFB) hat einen Handlungsbe-
darf in der zukünftigen Programmgestaltung und Inhaltsproduktion erkannt, und
beschreibt in einem 2013 veröffentlichten Manifest eindrucksvoll was sie vom Pu-
blikum erwartet und wie dieser Austausch möglich werden kann: »We are entering
an era where everybody is a creator - it is important for us to sustain creators. (...)
We need to create spaces that the audience can claim and develop. (...) Create a
»safe« neutral space online or offline where different views can be expressed and
shared.« (#34). Im nächsten Kapitel wird erörtert was diesen offenen und siche-
ren Raum ausmacht, so dass eine Eroberung durch das Publikum möglich wird,
und mehr Zuschauer zu einem aktiven Teilnehmer werden.
29TR A N S M E DI A LE S E RZÄ H LE N
Reflexion 3:
Echte Partizipation braucht Raum.
Transmediales Erzählen ist interaktiv, wenn es durch die Nutzung von
Medienmöglichkeiten und -räumen ehemals passive Rezipienten involviert, orga-
nisiert und zu einem aktiven Beitrag herausfordert. Die Bündelung von differen-
zierten menschlichen Fähigkeiten zu einer Schwarmintelligenz konstituiert neue
Chancen für das gemeinschaftliche Problemlösen und die Produktion von Inhalten.
Transmediales Erzählen ist außerdem sozial, wenn Menschen, die sich ursprüng-
lich nur digital begegnen, durch den Wechsel zwischen Medien und Orten, auch
auf physischer Ebene, z.B. durch ergänzende Live-Events, zusammenkommen.
Der Wechsel zwischen den Medien muss Sinn machen, und Medien soll-
ten ihren spezifischen Eingeschaften und der Situation entsprechend eingesetzt
werden. Eine mögliche Rückkehr oder das Ausweichen auf vorherige bzw. favori-
sierte Medien ist wichtig, um Nutzer nicht dauerhaft auszuschließen. Die Zitate der
Fernsehmacher verdeutlichen, dass eine Nachfrage nach Interaktion und Partizi-
pation besteht. Je komplexer und herausfordernder das Angebot ist, desto kleiner
wird allerdings die Zahl der Teilnehmer. An den komplexesten Rätseln und den di-
rektesten Interaktionen beteiligen sich in der Regel weniger als 1% der Zuschauer.
Die Forderung nach Veränderung im Bereich der Erzählstrukturen und Pratizipa-
tionsmöglichkeiten ist zur Zeit allgegenwärtig. Ein neues Produktionsparadigma
wird gefordert.
Interface- und Interaction Design sind Elemente des Transmedialen Erzäh-
lens. Die Art wie digitale Werkzeuge und ihre Schnittstellen (HCI) sich in den All-
tag und die Verhaltensweisen des Nutzers einfügen ist entscheidend für eine dau-
erhafte Nutzung und Akzeptanz. Ort, Technik, Nutzerfähigkeiten und Mehrwert des
digitalen Services sind in der Konzeption von Anfang an zu berücksichtigen, so
dass sich das Produkt am Ende nahtlos in den Tag, in das Leben des Nutzers ein-
fügt; oder für Reibung und Konfrontation sorgt, wenn dies gewünscht ist.
30»In reality, creativity has always been a highly col-
laborative, cumulative and social activity in which
people with different skills, points of view and in-
sight share and develop ideas together. At root
most creativity is collaborative; it is not usually a
product of a lone individual’s flash or insight.«
Charles Leadbeater (#35)
»The old, industrial media, newspapers and tele-
vision, do not have enough room to cater for all
the minority interests of their readers and liste-
ners. Newspapers and television have high capi-
tal costs - studios and print plants - and to cover
these costs they have to reach a large audience. »Nicht mehr Konsum oder Produktion wer-
The web with its much lower costs allows a com- den in Zukunft unsere Gesellschaft defi-
mitted and knowledgeable enthusiast to connect nieren. Sondern Teilhabe und Innovation.
to his fellow fans.« Charles Leadbeater (#35.1) Das Web macht die Welt demokratischer.«
Charles Leadbeater (#36)
»In einer neuen Version meines Buches »We
Think!« wird es darum gehen, unter welchen
Bedingungen Menschen zusammenarbeiten,
kreativ sein, die Ergebnisse ihrer Arbeit teilen
und sich selbst organisieren können, ohne
auf traditionelle Organisationsstrukturen
zurückgreifen zu müssen.«
Charles Leadbeater (#37)
31Sie können auch lesen