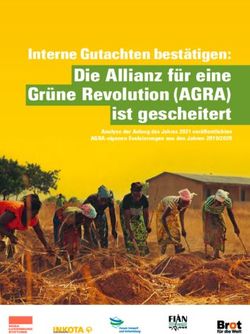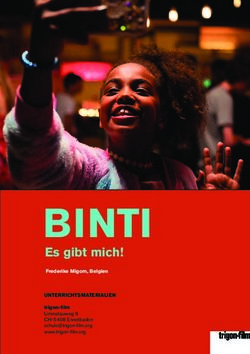Medien übersetzen zwischen Zeit und Raum
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
1
Vortrag auf dem Workshop:
Espace – Diskursive Streifzüge durch die raumtheoretische Praxis, Wien, 31. 1. 2020
http://homepages.uni-paderborn.de/winkler/Medien übersetzen zwischen Zeit und Raum.pdf
Hartmut Winkler
Medien übersetzen zwischen Zeit und Raum
1. Intro
Stellen wir uns vor, wir zerschnitten einen Film in seine einzelnen Bilder, und stellten sie wie
Karteikarten hintereinander, sodass ein kompakter Stapel entsteht. Ginge man die Bilder dann
von vorne nach hinten durch, würde wie gewohnt der Film ablaufen. Was aber, wenn man den
Stapel um 90 Grad gedreht in feine Scheiben schnitte? Was würde man sehen, wenn man
diese Scheiben als Film projizierte? Martin Reinhart und Virgil Widrich haben dieses Ex-
periment bereits vor 20 Jahren im Rechner gemacht. Und das Resultat ist ästhetisch ebenso
befremdlich wie spektakulär. 1
Vor allem aber ist es für die Theorie interessant, weil die drei Dimensionen des Bilderstapels
an sich ja keineswegs austauschbar sind: Die X- und die Y-Achse stehen für die Kanten des
einzelnen Bildes und das heißt: für zwei Dimensionen des Raums. Die dritte, T-Achse des
Stapels aber steht für den Ablauf der Zeit. Im Experiment nun wird die Zeit- gegen eine
Raumachse ausgetauscht, weshalb Reinhart/Widrich ihr Projekt ‚TX-Transform‘ nennen.
Wie und warum – in aller Welt – aber kann man Raum gegen Zeit, und Zeit gegen Raum tau-
schen?
Im Alltag tauchen dergleichen Probleme nicht auf; wir leben in Raum und Zeit und machen
uns kaum Gedanken darum, weil Raum und Zeit den selbstverständlichen Rahmen unserer
Alltagserfahrung bilden. Und wenn Physiker uns überzeugen wollen, in Wahrheit seien die
Dinge komplizierter, Raum und Zeit plastisch und ‚relativ‘, und das euklidische Weltver-
ständnis rettungslos überholt, sagen wir: „interessant“ – und kehren lächelnd zu unserer All-
tagsgewissheit zurück.
Aber ist das wirklich so? Im Folgenden möchte ich argumentieren, dass es auch im Alltag –
zumindest der Medien und der Populärkultur – Mechanismen, Projekte und Erfahrungen gibt,
die Raum und Zeit in einer völlig anderen Weise behandeln. Medien experimentieren auf viel-
fältige Weise mit Raum und Zeit; Raum kann in Zeit überführt werden, und Zeit in Raum;
Raum und Zeit werden auf vielfältige Weise verformt, Probleme der einen Sphäre werden mit
den Mitteln der anderen sichtbar gemacht. Auch hier also geht es darum, dass Zeit und Raum
‚relativ‘ und voneinander abhängig sind. Ob die Medien ihre eigene Relativitätstheorie haben,
sei dahingestellt; sicher ist, dass sie Raum und Zeit in sehr unvermutete Konstellationen brin-
gen.
Ausgehend von Reinhart/Widrich möchte ich im Folgenden Fälle vorstellen, die das fragliche
Feld beleuchten, und ich werde auf Beispiele aus der Medienkunst und durchaus kuriose Ein-
zelprojekte, auf Beispiele aus der Medientechnik, auf Alltagsanwendungen und Zufallsfunde
zurückgreifen. Diese möchte ich konfrontieren mit bestimmten Basisannahmen, die die Medi-
entheorie zum Thema bereitgestellt hat. Hier soll deutlich werden, dass es nicht um Rand-
probleme, sondern im Kern um das Funktionieren der Medien selber geht. In meinem
Schlussteil werde ich versuchen, bestimmte theoretische Konsequenzen zu ziehen.
1
Kurzfilm Österreich 1998, 35 mm, Länge: 5 min.2
2. TX-Transform
Betrachten wir das Experiment mit dem Bilderstapel genauer. Reinhart hat das Programm ab
1992 entwickelt, Widrich und er haben dann 1998 gemeinsam ‚TX-Transform‘, den wohl be-
kanntesten Film mit dieser Technik, gemacht. 2 Die Ausgangsanordnung entspricht im Grunde
dem Daumenkino: X- und Y-Achse markieren die einzelnen Bilder, die T-Achse den Papier-
stapel, den man sequenziell durchblättern kann.
3 4
Nun wird der Block im rechten Winkel dazu geschnitten; und der Algorithmus sorgt dafür,
dass die ‚Lagen‘ genauso dünn wie die Papierlagen sind:
5
2
Ein Video von 1999, das das Verfahren vorstellt und erläutert, findet sich auf:
https://www.youtube.com/watch?v=_dLqlbSq428
Wikipedia liefert weitere, gute Informationen:
https://de.wikipedia.org/wiki/Tx-transform
Reinhart und Widrich haben eigene Webpages:
http://www.tx-transform.com/Ger/index.html
https://www.widrichfilm.com/projekte/tx-transform.
Es gibt ein Interview mit Widrich:
https://www.youtube.com/watch?v=82ScuD7Srvo
sowie ein Seminar von 2007, das ab Min 23 auch ‚TX-Transform‘ behandelt:
https://www.youtube.com/watch?v=AbEh6hUjaPo
Anwendungsbeispiele finden sich auf:
https://www.youtube.com/watch?v=7ZAC2E1qn94
https://www.youtube.com/watch?v=lyJ28GnE_uA
https://www.youtube.com/watch?v=6xGpUlvET0s
https://www.youtube.com/watch?v=9iOLRXOa5Cg
und schließlich eine Demo zur Software:
https://www.youtube.com/watch?v=8usqO_6BNW8
3
Das Bild ist der Webpage von Virgil Widrich entnommen:
https://www.widrichfilm.com/projekte/tx-transform , zuletzt abgefragt: 16. 8. 18.
4
Webpage des Daumenkinofestivals Hannover: http://www.daumenkino-festival.de/stuff/bild.jpg , 16. 8. 18.
5
Webpage von Virgil Widrich, a. a. O.3
Was entsteht, wie gesagt, ist ein Stapel neuer, äußerst verblüffender Bilder:
6 7
8
Die Bilder sind ‚gegenständlich‘ und die Objekte bleiben meist als Objekte erkennbar, aber
sie wirken auf eigentümliche Weise verzerrt. Die Formen sind fließend und lösen sich teil-
weise auf; Körperteile verschwinden und das ordnende Raster der Geometrie scheint seine
Kraft zu verlieren.
Noch seltsamer aber wird die Sache, wenn man über eines der Bilder tatsächlich nachdenkt
und sich klar macht, dass in ihm keine einheitliche Zeit herrscht. Die Zeit im linken Teil des
Bildes vielmehr ist eine andere als im rechten, weil der linke Rand zu Beginn, und der rechte
Rand am Ende der Bewegtbildsequenz entstanden ist. Das Bild insgesamt also steht für einen
Verlauf, und ist im Grunde ein eigener ‚Film‘. Unsere Wahrnehmung kann das schwer akzep-
tieren; an fotografische Bilder gewöhnt kann sie kaum anders, als auch hier eine Moment-
aufnahme und Gleichzeitigkeit zu unterstellen. Zudem ist verwirrend, dass alle unbewegten
Objekte verschwinden, während alle bewegten sichtbar bleiben:
9
6
Webpage von Martin Reinhart: http://www.tx-transform.com/Ger/index.html , zuletzt abgefragt: 16. 8. 18.
7
Ebd.
8
Ebd.4
Und endgültig fremd wird es, sobald der Film anläuft und die Bilder in Bewegung geraten;
wenn Objekte rotieren oder die Kamera im Film sich zu bewegen beginnt, wird selbst ein gut
geschultes Bildverständnis gesprengt.
Ich möchte es hierbei vorläufig belassen. Eigentlich nämlich geht es mir um die Frage, ob das
– sicherlich intelligente und avancierte – Projekt tatsächlich so exotisch ist, wie es scheint. Ist
dies der erste Versuch, Raum und Zeit auszutauschen? Oder gibt es weitere Fälle in der
Mediengeschichte? Und was kann die Medientheorie dazu sagen?
3. Basisannahmen der Theorie
Medien haben ein doppeltes, ein gespaltenes Verhältnis zu Raum und Zeit. Auf der einen
Seite, als Praktiken, als Technik und als Signifikanten, sind sie Teil der materiellen Welt und
den Gesetzen von Raum und Zeit unterworfen. Auf der anderen Seite, sagt Harold Innis (der
Lehrer McLuhans in den 50er Jahren), können sie Raum und Zeit ‚überwinden‘; 10 den Raum
in der Tele-Kommunikation, die Zeit in ihrer Fähigkeit, Inhalte zu speichern, zu tradieren und
zu bewahren. Diese Vorstellung ist im Fach stabil etabliert, obwohl es auch hier viele offene
Fragen gibt. 11
Eine zweite etablierte Vorstellung ist, dass die Logik der Speichermedien sich gegen den
Fluss der Zeit richtet. Für die Fotografie ist dies evident: der Druck auf den Auslöser stellt
still, was immer sich vor der Linse ereignet. Aus dem kontinuierlichen Fluss der Ereignisse
wird ein einzelner Moment quasi herausgestanzt. Preis ist, dass dabei Zeit und Veränderung
aus dem Bildraum verbannt werden; Veränderungen können sich nur noch am Bild, aber nicht
mehr im Bild ereignen.
Und auch der Raum wird verformt, insofern die ursprünglich drei Dimensionen des Raumes
im Bild auf nur noch zwei reduziert werden. Mit dem Bild entsteht ein neues räumlich/flaches
Objekt, das Latour ein ‚immutable mobile‘ nennt. 12 ‚Immutable‘, weil das Abgebildete still-
gestellt wird, und ‚mobile‘, weil das Bild selbst nun eigene Reisen durch Zeit und Raum an-
treten wird.
Wie aber verhält es sich mit Raum und Zeit in anderen Medien? Nehmen wir das Beispiel der
Schrift; und hier liegen die Dinge bereits komplizierter. Schrift ist – zumindest nach einer
9
TX-Transform, Trailer, 1999, https://www.youtube.com/watch?v=_dLqlbSq428 , 2min32; zuletzt abgefragt am
16. 8. 18.
10
„Jedes einzelne Kommunikationsmittel spielt eine bedeutende Rolle bei der Verteilung von Wissen in Zeit und
Raum, und es ist notwendig, sich mit seinen Charakteristiken auseinanderzusetzen, will man seinen Einfluss auf
den jeweiligen kulturellen Schauplatz richtig beurteilen. Je nach seinen Eigenschaften kann solch ein Medium
sich entweder besser für die zeitliche als für die räumliche Wissensverbreitung eignen, besonders wenn es
schwer, dauerhaft und schlecht zu transportieren ist, oder aber umgekehrt eher für die räumliche als für die
zeitliche Wissensverbreitung taugen, besonders wenn es leicht und gut zu transportieren ist. An seiner relativen
Betonung von Zeit und Raum zeigt sich deutlich seine Ausrichtung auf die Kultur, in die es eingebettet ist.“
(Innis, Harold: Tendenzen der Kommunikation. (The Bias of Communication, 1949). In: Barck, Karlheinz (Hg.):
Harold A. Innis – Kreuzwege der Kommunikation. Ausgewählte Texte. Wien/NY 1997, S. 95).
11
Vgl.: Winkler, Hartmut: Prozessieren. Die dritte, vernachlässigte Medienfunktion. München: Fink: 2015.
12
Latour, Bruno: Die Logistik der immutable mobiles. In: Döring, Jörg; Thielmann, Tristan (Hg.): Mediengeo-
graphie. Theorie − Analyse − Diskussion. Bielefeld: transcript Verlag 2009, S. 111-144 (EV, am.: 1987); sowie
ders.: Drawing Things Together. Die Macht der unveränderlich mobilen Elemente. In: Belliger, Andréa; Krieger,
David J. (Hg.): ANThology. Ein einführendes Handbuch zur Akteur-Netzwerk-Theorie. Bielefeld: Transcript
2006, S. 259-307 (EV, am.: 1986/90).5
ihrer Seiten hin – niedergelegte, fixierte mündliche Sprache. 13 Auch die Schrift also stellt
einen Ereignisstrom still. Anders als im Fall der Fotografie aber wird die Zeit aus der Darstel-
lung nicht einfach verdrängt, sondern sie geht in die mediale Anordnung ein. Hierfür ist ein
Trick, eine Übersetzung nötig: Denn während sich die mündliche Sprache in der Zeit entfaltet,
nutzt die Schrift den Raum; man reiht die Zeichen in der Zeile linear an, um die ebenfalls
lineare Achse der Zeit zu repräsentieren. Zeit also wird in Raum umcodiert; und das Nachein-
ander der gesprochenen Worte in ein gerichtetes Nebeneinander geschriebener Zeichen. Real-
tonaufzeichnung und Film erben diese Logik und entwickeln sie weiter.
Auch hier möchte ich zunächst abbrechen. Denn es dürfte deutlich geworden sein, dass die
Frage nach Raum und Zeit keineswegs eine philosophische, oder innerhalb der Medien-
wissenschaften ein Randproblem ist. Wenn bereits die Schrift Zeit in Raum umcodiert, und
nur auf dieser Basis den Lautstrom der Sprache, also Zeit, repräsentieren kann, dann betrifft
die Frage möglicherweise die Medien als ‚Aufschreibesysteme‘ insgesamt. Ich werde auf
diese Frage zurückkommen.
3. Zeit wird Raum
Welche Medien also gibt es, die auf der fraglichen Grenze zwischen Zeit und Raum operie-
ren? Beginnen wir noch einmal bei der Fotografie. Bei näherem Hinsehen nämlich erscheint
mehr als fraglich, ob die Fotografie die Dimension der Zeit tatsächlich vollständig aus der
Abbildung verbannt.
Bewegt sich ein Objekt vor der Linse und ist die Belichtungszeit relativ lang, entsteht, um ein
Beispiel zu nennen, Bewegungsunschärfe. Auch wenn diese zunächst als ‚Fehler‘ auftritt,
wurde sie schnell als Zeichen/Anzeichen für Bewegung lesbar, und dann als ästhetisches Dar-
stellungsmittel konventionalisiert.
14 15
13
Dass Schrift mehr ist als das, beschreibt: Krämer, Sybille: Sprache und Schrift oder: Ist Schrift verschriftete
Sprache? In: Zeitschrift für Sprachwissenschaft, Nr. 15.1 (1996), S. 92-112.
14
Bildquelle unbekannt.
15
Foto: Carsten Gruss: Bewegunsunschärfe, https://www.fotocommunity.de/photo/bewegungsunschaerfe-
carsten-gruss/25086728 , zuletzt abgefragt: 28. 8. 18.6
16 17
Bewegungsunschärfe kodiert, wie die Schrift, Zeit in Raum um. Daneben gibt es Fälle, in
denen die fotografische Aufzeichnung von Bewegung zu Verzerrungen führt, die für das
bloße Auge kaum noch plausibel erscheinen:
18 19
16
Foto: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bewegungsunsch%C3%A4rfe_bei_fl%C3%BCchtendem_
Hirschen_IMGP6972.jpg
17
Bildquelle unbekannt.
18
Still aus einem Video, veröffentlicht im Youtubekanal ‚360kid / straylor‘:
https://www.youtube.com/watch?v=kCExp0jnMG8
Hier geht es um einen Sonderfall, insofern es sich um eine Bewegtbildkamera handelt; Straylor erläutert: “Air-
plane propellers turn very fast. Many rotations per second are required to give a plane it's thrust to move
forward. So why is it that this video makes the propeller look like it's not turning very fast at all? The answer can
be found when comparing the speed of propeller rotation to that of the frame rate of a video camera, or how
many frames per second the camera is capturing the propeller rotation. A video camera can only capture a
defined amount of frames per second (also known as 'frame rate’). If a video camera captures only 30 frames a
second, it is capturing only 30 different positions of the rotating propeller a second. A higher camera frame rate
can capture many more frames of motion. A slower frame rate captures less. In the video example here, the
video camera is only capturing a small number of frames per second compared to the actual number of propeller
rotations per second, and visually that translates into a video that looks like the propeller is not moving very fast
at all.” (Ebd.); dass die Verzerrung keineswegs auf die ‚Frame rate‘ zurückgeht, wird unten zu diskutieren sein.
19
Still aus einem Video von David Maiolo: Optical Illusion - Airplane Propeller in Sync with Camera, 2013:
https://www.youtube.com/watch?v=uthT9exn5tU7
20
Solche Verzerrungen treten auf, wenn der Kameraverschluss und die Objektbewegung un-
glücklich synchronisiert sind. Und umgekehrt lässt sich dieser Effekt nutzen, wenn beide
bewusst oder zufällig aufeinander abgestimmt sind; so kann man mit einem I-Phone die
Schwingungen einer Gitarrenseite sichtbar machen:
21
Der Effekt ist der eines Oszilloskops, das ebenfalls Schwingungen – allerdings elektrische
Schwingungen – stillstellt und räumlich beobachtbar macht.
22
20
Foto von Jacques-Henri Lartigue aus dem Jahr 1913; http://www.flong.com/texts/lists/slit_scan/, 17. 8. 18.
21
Still aus dem Video: ‚Tolle Effekte: iPhone 4 Kamerashutter und schwingende Gitarren-Saiten bzw. Flugzeug-
Propeller‘, http://www.iphone-news.org/2011/09/12/tolle-effekte-iphone-4-kamerashutter-und-schwingende-
gitarren-saiten-bzw-flugzeug-propeller-26925/ , z. a.: 18. 8. 18.
22
https://putzlowitsch.de/2012/02/21/heinrich-rudolf-hertz-oszilloskop/ , z. a.: 18. 8. 18.8
Ein zweites Mittel neben der Bewegungsunschärfe, und wie diese stabil konventionalisiert, ist
die Technik der Mehrfachbelichtung, die ebenfalls eine fotografische Repräsentation von Zeit
und Bewegung erlaubt.
23 24
Auch Mehrfachbelichtungen können als ‚Fehler‘ auftreten; etwa in Google Earth und in
Google Street View, wo die Algorithmen bei bestimmten Raum/Zeit-Konstellationen offenbar
in Probleme geraten, und wo es eine eigene Fangemeinde gibt, die solche Sonderfälle gewis-
senhaft sammelt:
25 26
Und auch hier kommt es zu optischen Verzerrungen, die denen des Propellers ähneln:
27
23
Foto: Elisofon, Eliot: Marcel Duchamp descends staircase. (1952).
https://blog.zhdk.ch/kkunst/1e1ecbd3a8c1cd24f4a355c8bf6714cd-multiple-exposure-photography-artsy-photos/
24
Foto: Mili, Gjon: Stroboscopic Multiple Exposure Of American Ballet Theater ballerina Alicia Alonso exe-
cuting a pas de bourree. (1944). https://www.nyfa.edu/student-resources/double-exposure-photography/
25
Youtube-Video mit Beispiel aus Google Earth: https://www.youtube.com/watch?v=nV39ZejBfMU, 8min46.
26
Beispiel aus Google Street View: https://www.youtube.com/watch?v=1idMFbHqaWA , 2min28.9
Geht man in der Geschichte weiter zurück, trifft man auf Eadweard Muybridge und Étienne-
Jules Marey, 28 die gegen Ende des 19. Jahrhunderts mit Serienfotografie und Mehrfachbelich-
tung systematisch experimentierten, und deren Arbeiten unmittelbar zum Film und zur Bewe-
gungsillusion führten.
29 30
5. Raum wird Zeit
Machen wir nun die Gegenprobe und gucken, ob es auch solche Medien gibt, die Raum in
Zeit verwandeln. Und natürlich ist das der Fall. Nehmen wir als Beispiel die Technik des
Films. Der Film nämlich tut beides: 31 In der Aufzeichnung verfährt er analytisch, insofern er
die kontinuierliche Objektbewegung in Einzelaufnahmen zerlegt und diese, wie die Schrift,
räumlich nebeneinander speichert. In der Aufzeichnung also verwandelt der Film Zeit in
Raum.
In der Projektion verfährt der Film dagegen synthetisch: Alle Einzelbilder werden auf die-
selbe Leinwand projiziert, wo die träge menschliche Wahrnehmung sie zur Illusion einer Be-
wegung verschmilzt. Das räumliche Nebeneinander, das für die Aufzeichnung kennzeichnend
ist, geht in der Projektion unter; und was Raum war, wird wieder in Zeit verwandelt.
6. Matrix
Marey nutzte u. a. eine fotografische Flinte, die mehrfach hintereinander auslöste und serielle
Aufnahmen auf einer Platte erlaubte. Muybridge dagegen setzte eine große Anzahl von
Kameras ein, die nacheinander über Reißleinen z. B. von den Hufen eines galoppierenden
Pferdes ausgelöst wurden, und von denen jede nur eine einzelne Aufnahme machte. 32
Mehr als 100 Jahre später wurde eine Variante dieser Technik im Spielfilm Matrix 33 noch ein-
mal top aktuell. Berühmt wurde der Film für einen special effect, der ‚Bullet Time’ genannt
und im Anschluss vor allem in der Werbung unendliche Male verwendet wurde: Im Halbrund
um eine Szene wird eine Anzahl von Kameras aufgebaut, die – anders als bei Muybridge alle
27
Google Street View: https://www.youtube.com/watch?v=1idMFbHqaWA
28
Beide jeweils 1830-1904.
29
Foto: Eadweard Muybridge: https://variety.com/2013/film/markets-festivals/cohen-media-takes-movie-rights-
on-edward-muybridge-tome-1200483742/
30
Foto: Étienne-Jules Marey: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=395142
31
…und schon die optischen Spielzeuge davor, wie das Zoetrop und das Praxinoskop…
32
Vgl.: https://www.youtube.com/watch?v=aG5erS2GNG0 , https://www.youtube.com/watch?v=FYKZif9ooxs
33
USA 1999, Regie: Lana und Lilly Wachowski.10
im selben Moment – eine Einzelaufnahme, jede aus ihrer leicht verschobenen Perspektive,
machen.
34
Diese Einzelaufnahmen werden im Computer zusammengetragen und dann als ‚Film‘ abge-
spielt. Der Effekt ist bekannt: Es entsteht ein Kamera-Flug rund um die Szene, die wie eine
Momentaufnahme schockgefrostet erscheint; ein fallender Körper, 35 ein spektakulärer Sprung
oder spritzendes Wasser 36 liefern besonders verblüffende Resultate. 37
38
Und weil der Blick das Objekt umkreist, entsteht eine besondere räumliche Plastizität, ein
skulpturaler Effekt, der im Widerspruch zum Inhalt der Szene, dem spritzenden Wasser, steht.
Spritzendes Wasser kannte man bis dahin nur als Bewegtbild, immer an Zeit gebunden; oder
eben ‚flach‘, als fotografischen Schnappschuss.
Im hier verfolgten Zusammenhang ist der Effekt interessant, weil er – relativ unmittelbar
visuell erfahrbar – ebenfalls eine Umkehrung von Zeit und Raum bedeutet. Was tatsächlich
ein räumliches Nebeneinander ist, das Nebeneinander der Kameras, wird umgerechnet und
präsentiert als ein zeitliches Nacheinander. Der Raum – eine Achse des Raums – wird aus-
getauscht gegen die Achse der Zeit, und es wird gezeigt, dass beide überhaupt austauschbar
sind.
34
Foto: http://henrybetts.co.uk/an-attempt-at-bullet-time/
35
Vgl.: Matrix, behind the scenes: https://www.youtube.com/watch?v=Kjcv-JtUOgA
36
Vgl.: https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ZlZPmABrLu8
37
Mit ‚Matrix‘ wurde die Technik berühmt, tatsächlich aber ist sie älter: „Das Konzept des als ‚Bullet-Time‘
oder ‚Matrix‘-Effekt bekannten Spezial-Effektes wurde erstmals im Jahr 1967 in der japanischen Zeichentrick-
serie ‚Street Racer‘ dargestellt. Die erste ‚echte‘ Effektszene dieser Art gab es 1976 in dem Film ‚Der rosarote
Panther kehrt zurück‘ und durch den Science-Fiction-Überraschungshit ‚Matrix‘ wurde dieser, sonst nur in der
Werbung verwendete Effekt, weltweit bekannt und beachtet. Im Vorfeld der Photokina 2010 hat der adf
(Arbeitskreis Digitale Fotografie) mit Sponsoren (u. a. 3D-Viz.com) die größte ‚Matrix-Effekt‘ Installation der
Welt im Otto-Fotostudio in Hamburg durchgeführt.“ (http://www.digitalkamera.de/Meldung/_Matrix_
Fotografie_der_sichert_sich_Eintrag_ins_Guiness_Book/6777.aspx , 12. 7. 13). Für den genannten Rekord
waren 130 Kameras nötig…
38
Still aus dem Film ‚Matrix‘.11
7. Spur
Auch im Bewegtbild, in Film und Video, hat man Mehrfachbelichtungen eingesetzt; in der
analogen Videotechnik etwa gehörte die visuelle Rückkopplung zu den Effekten, die dem
‚Beatclub‘ 1965-72 zu seinem ‚psychodelischen‘ Look verhalfen. 39 Und noch 2009 trat die
Gruppe OK GO mit einer digitalen Variante auf:
40
Ob in der Fotografie oder im Bewegtbild: Mehrfachbelichtungen verwandeln Zeit in Raum,
und in beiden Fällen hinterlässt die Bewegung eine Spur. Im Bewegtbild allerdings spielt die
Zeitachse eine andere Rolle: Hier ist die Spur selbst dynamisch; sie füllt die Fläche aus und
muss durch Verblassen/Löschen oder Überschreiben wieder aus der Welt geschafft werden;
zudem wird in manchen Fällen der Rhythmus der Frames, den das Medium der Wahrneh-
mung entzieht, wieder sichtbar.
Ästhetisch anspruchsvoller ist das Projekt ‚The Invisible Shape of Things Past‘, das Joachim
Sauter und Dirk Lüsebrink 1995 bis 2006 entwickelt haben. 41 Hier geht es um eine Kamera-
fahrt z. B. durch die Architektur eines Hauses. Im Anschluss werden die einzelnen Frames
wieder zu einem Stapel gepackt; mit der Besonderheit allerdings, dass jedes Bild räumlich
exakt dort hingestellt wird, wo es im Verlauf der Kamerafahrt aufgenommen wurde. Der Weg
der Kamera materialisiert sich als Lindwurm. Man kann die unregelmäßige Bewegung der
Handkamera sehen, die Schritte des Kameramanns werden als Auf und Ab sichtbar, wo die
Kamera schwenkt, fächern sich die Frames auf…
39
„Regisseur Mike Leckebusch entwickelte mit den ersten elektronischen Key-Effekten und visuellen Rück-
koppelungen eine Bildwelt, die den Beat-Club zum Wegbereiter einer neuen, eigenen Fernseh-Ästhetik werden
ließ.“ Radio Bremen: Generation Beatclub:
https://www.radiobremen.de/fernsehen/produktionen/dokumentationen/beat-club280.html, 23. 8. 18.
40
Musikvideo zum Titel: WTF?; http://www.youtube.com/watch?v=12zJw9varYE, 23. 8. 18; in ihrem official
making off, bezieht sich die Gruppe auf die traditionelle Mehrfachbelichtung in Fotografien des 19. Jh. zurück:
https://www.youtube.com/watch?v=TNeItlrTdvY , 23. 8.18,
41
https://artcom.de/project/the-invisible-shape-of-things-past/ , 23. 8. 18. (Dank für den Fund an William Uric-
chio).
Auch Sauter/Lüsebrink beziehen sich auf Experimente der Vergangenheit: „Beeinflusst durch den aufkommen-
den Film und mehrfach belichtete Fotografien, lösten Kubisten und Futuristen in ihren Bildern und Skulpturen
die lineare Darstellung von Raum und Zeit auf. Sie versuchten, Darstellungsformen für Bewegung zu finden und
führten die Abbildung multipler Zeiten und Perspektiven eines Objekts ein. Zur gleichen Zeit entwickelten
Künstler wie Fischinger, Ruthmann und Eggeling den ‚Absoluten Film‘, dessen Ziel es war, sich von der Abbil-
dung alles Gegenständlichen zu befreien, Abstraktion mit filmischen Mitteln herzustellen und so die Malerei zu
erweitern. Neben vielen anderen Techniken wurden dünne Scheiben eines Knetklumpens abgeschnitten und die
sich dadurch kontinuierlich verändernde Schnittfläche mit einer Trickfilmkamera Bild für Bild abgefilmt. Das
Ergebnis war die Auflösung dieses Objektes in Einzelbilder, die zusammengesetzt eine Kamerafahrt durch das
Objekt darstellten.“ (Ebd. (Hervorh. H. W.)).12
„Aus vorhandenen filmischen Einzelbildern“, sagen Sauter/Lüsebrink, werden „Objekte und
Skulpturen generiert“; 42 es entsteht ein neues Objekt im Raum.
43 44
45 46
42
Ebd.
43
Ebd.
44
Ebd.
45
Ebd.
46
Ebd.13
Sauter/Lüsebrink haben ihr Projekt als Fotografie/Computergrafik und als Video präsentiert,
und dann tatsächlich auch in Metall gegossen. Das Video 47 macht die Logik besonders deut-
lich.
8. Moviebarcode
Sehr verbreitet – so verbreitet, dass es schwer ist, einen Urheber zu nennen – ist das Projekt
Moviebarcode, das jeweils einen ganzen Spielfilm in nur einem Bild zusammengefasst prä-
sentiert: 48
49
50
Hier geht es vor allem um die Farbe; man kann sehen, welche Farben die einzelnen Sequen-
zen des Films dominieren und wie die übergreifende Farbregie aussieht, die den Ablauf des
Filmes bestimmt. Das Bild wird berechnet, indem man jeden Frame des Films auf einen Strei-
fen von nur einem Pixel Breite komprimiert; und jedes Pixel bekommt den Farbwert, der dem
47
Ebd., Bild 14.
48
Z. B. auf: http://moviebarcode.tumblr.com . Dank für den Hinweis an Dennis Bienkowski.
49
Blade Runner 2019 (USA 2017); https://zerowidthjoiner.net/movie-barcode-generator, 24. 8. 18.
50
Stardust Memories (USA 1980); http://moviebarcode.tumblr.com, 24. 8. 18.14
Durchschnitt der Farben der ursprünglichen Bildzeile entspricht. 51 Eine Variante zeigt auf der
Vertikalen nur eine Farbe, und zwar wieder den Durchschnittswert, an.
52
9. Zielfotos, Slitscan
Äußerst interessant für die Frage nach Raum und Zeit sind auch Zielkameras, wie sie im Sport
eingesetzt werden.
53 54
Auch hier nämlich wird nicht, wie man denken könnte, im entscheidenden Augenblick des
Einlaufs eine Momentaufnahme gemacht. „Die klassische Art der Zielfotoerzeugung [viel-
mehr] benutzt eine Fotokamera, bei der der Film hinter einem feststehenden Schlitz […] mit
einer geeigneten Geschwindigkeit entlang bewegt wird. Dabei sind Objektiv und Schlitz ge-
51
Wie dieser Durchschnitt genau gerechnet wird, bleibt in den meisten Darstellungen dunkel; und generell zeigt
sich die Mehrzahl der Autoren an der konkreten Arbeitsweise der Algorithmen bemerkenswert desinteressiert;
eine gute Darstellung der technischen Varianten liefert Thomas Poulet: https://blog.thomaspoulet.fr/movie-
barcode/
52
Blade Runner‚ ‚smooth version‘; https://zerowidthjoiner.net/movie-barcode-generator, 24. 8. 18.
53
https://www.horseracing.ch/news/aarau-27909-zielfoto-um-rang-falsch-ausgewertet-die-wetter-sind-einmal-
mehr-die-dummen-nd-3455.html, 24. 8. 18.
54
https://www.badische-zeitung.de/olympische-spiele/das-zielfoto--126151060.html, 24. 8. 18.15
nau auf die Ziellinie ausgerichtet, wodurch nur dieser Bereich zu verschiedenen Zeiten belich-
tet wird.“ 55
Auch die Zielkamera also liefert weniger ein Foto als einen ‚Film‘; und auch sie teilt das Bild
in hauchdünne, senkrechte Bildstreifen auf, die jeweils eine unterschiedliche Zeit repräsentie-
ren. Wieder ist, was als Raum erscheint, eigentlich Zeit; wieder wird X gegen T getauscht.
Der Zeitvektor allerdings ist im Zielfoto umgedreht, insofern der rechte Rand, anders als in
den bisherigen Beispielen, einen früheren Zeitpunkt als der linke repräsentiert.
Fotokünstler haben mit Ziel- oder Schlitzkameras vielfältig experimentiert.
56 57
58 59
Die Technik wird ‚Slit Scan‘ genannt. Wieder sind auch hier nur bewegte Objekte sichtbar;
und besonders interessant und verstörend sind die Bilder, wenn die Kamera während der Auf-
nahme bewegt wurde oder wenn das Objekt rotiert.
55
Wikipedia: Zielfoto; https://de.wikipedia.org/wiki/Zielfoto; 24. 8. 18 (Erg. u. Hervoh. H. W.); Wikipedia
schreibt ‚Schlitzverschluss‘; das aber ist eher irreführend, weil der Schlitz während der gesamten Dauer der Auf-
nahme offen bleibt.
56
Walter, Hans-Jörg: Gescannte Innenstadt. In: Tageswoche [Ch], 30. 12. 14;
https://tageswoche.ch/form/bildstoff/gescannte-innenstadt/ , 24. 8. 18; Dank für den Hinweis an Klaus Pohl.
57
Ebd.
58
Ebd.
59
Ebd.16
60
Und mit der Slitscan-Technik sind auch Bewegtbilder möglich. In der Technik des traditionel
len, analogen Films nur am Tricktisch, indem man die Filmvorlage streifenweise auf einen
neuen Träger kopiert, und dabei die Streifen zeitlich, jeweils ein Bild weiter, versetzt. 61 In der
digitalen Welt gibt es hierfür Programme. Resultat ist ein Film, dessen einzelne Frames im
Grunde Slitscan-Fotografien sind und die, wie diese, unterschiedliche Zeiten enthalten. Spielt
man den Film ab, entstehen Bilder, die physikalisch unmögliche Objektbewegungen zeigen. 62
63 64
60
http://www.sarahhoworka.at/projects/slitscanexperiments , 25. 8. 18
61
So sagt der Kameramann, der gemeinsam mit Zbigniew Rybczynski 1988 den Experimentalfilm ‘The Fourth
Dimension’ gemacht hat: “I was supervising optical cameraman, operating a customized aerial-image projector
augmented Master Oxberry animation stand. […] The work on the Oxberry required 480 separate exposures on
every frame of the 35mm film negative to create the final effect.” https://vimeo.com/channels/thezone/24476973 ,
25. 8. 18 (Hervorh. H. W.). In Film und Video werden im Gegensatz zur Still-Fotografie, meist waagerechte
Streifen verwendet.
62
Es gibt mehrere sehr gute Sammlungen zu künstlerischen Slitscan-Projekten; so etwa Trevor Alyn: The Weird
World of Slit-Scan Video; https://www.youtube.com/watch?v=NSesvu_uqLo , 25. 8. 18, sowie Golan Levin: An
Informal Catalogue of Slit-Scan Video Artworks and Research; http://www.flong.com/texts/lists/slit_scan/ , 25.
8. 18.
63
Zbigniew Rybczynski: The Fourth Dimension, https://www.youtube.com/watch?v=LlVh0TCDDgU , 25. 8.
18.
64
Ebd.17
65 66
10. Magyar
Als letztes sei ein Projekt des Künstlers Adam Magyar erwähnt. 67 Auch Magyar hat mit Slit-
scantechniken experimentiert, arbeitet inzwischen aber mit Highspeed Videokameras, die
anstelle der normalen 25 Aufnahmen 1.500 Bilder pro Sekunde machen. Spielt man die Auf-
zeichnung mit normaler Geschwindigkeit ab, ist der Effekt eine extreme Zeitlupe, und jede
aufgezeichnete Sekunde wird auf eine volle Minute gedehnt.
68 69
70 71
65
Adrien M. und Claire B.: Anamorphose temporelle (2010):
https://vimeo.com/7878518?utm_source=affiliate&utm_medium=pro-eean-standard-
20140801&utm_campaign=10335 , 25. 8. 18.
66
Ebd.
67
Auch für diesen Tipp Dank an Klaus Pohl.
68
Adam Magyar, Stainless - Sindorim (excerpt): https://www.youtube.com/watch?v=oZlBdpp7FtI , 0min18, 25.
8. 18.
69
Ebd., 0min21.
70
Ebd., 0min24.18
Aber gehört die Zeitlupe überhaupt in den hier diskutierten Zusammenhang? Im konkreten
Fall ja, denn Magyar hat sein Motiv ausgesprochen sorgfältig gewählt: Er positioniert seine
Kamera in U-Bahn-Zügen, die mit großer Geschwindigkeit in die Station einfahren. In der
Zeitlupe wird die Querbewegung stark reduziert; da sie aber nicht langsam wirkt und es kei-
nen objektiven Anhaltspunkt gibt, kann der Zuschauer die Zeitlupe nicht als Zeitlupe erken-
nen. Völlig verblüffend ist deshalb, dass die gefilmten Personen wie schockgefrostet erschei-
nen. Wie in einer Momentaufnahme erscheinen sie vollständig stillgestellt; was das Video
zeigt, hat man so tatsächlich noch niemals gesehen; und die Querbewegung hebt wie bei
‚Matrix‘ den skulpturalen Charakter der Szene hervor.
Hier also ist es die Relation unterschiedlicher Geschwindigkeiten, die Zeit in Raum umschla-
gen lässt. 72
11. Schlitzverschluss
Dass die Slitscan-Bilder dem des verzerrten Propellers ähneln, ist kein Zufall. Denkt man über
die Techniken nämlich nach, wird klar, dass auch in der normalen Still-Fotografie ‚Slitscan‘
bereits eine Rolle spielt, insofern die meisten Kameras einen Schlitzverschluss haben. Wiki-
pedia macht dies mit einer relativ guten Grafik deutlich:
73 74
Der Schlitzverschluss einer Kamera besteht aus zwei getrennten Lamellen oder Textilstreifen,
die man den ersten und zweiten ‚Verschlussvorhang‘ nennt. Wird der Auslöser betätigt, wird
der erste Verschlussvorhang nach unten gezogen und das Licht der Linse kann auf den Film
oder den Sensor fallen. Am Ende der Belichtungszeit wird der zweite Vorhang nachgezogen
und stoppt das Licht wieder ab.
Wann dies geschieht aber ist abhängig von der gewählten Belichtungszeit. Im Extremfall –
also dann, wenn die Belichtung sehr kurz ist – folgt der zweite dem ersten Vorhang unmittel-
bar, so dass tatsächlich nur ein ‚Schlitz‘ offenbleibt, der von oben nach unten über den Sensor
fliegt. Und dies ist der Fall, der hier interessiert: In der Konsequenz nämlich heißt dies, dass
der obere Teil des Bildes zu einem früheren Zeitpunkt entsteht als der untere.
Der Unterschied mag geringfügig sein und in den meisten Fällen keine Auswirkung auf das
Foto haben. Anders allerdings, wenn sich das Objekt vor der Kamera schnell bewegt; denn
dann muss es zu den genannten räumlichen Verzerrungen kommen.
71
Ebd., 0min27.
72
Magyar hat seine Arbeit sorgfältig reflektiert und in einem online verfügbaren Vortrag erläutert:
https://www.youtube.com/watch?v=MgSz8naAfFI , 25. 8. 18.
73
https://de.wikipedia.org/wiki/Schlitzverschluss
74
Grafik: Ralf Pfeifer, ebd.19
75
12. Fernsehen und digitale Bilder
Das historische Bild des Rennwagens ist tatsächlich dadurch zustande gekommen, dass der
mechanische Schlitzverschluss eine Zeitversetzung während der Aufnahme bewirkt. Wie aber
kann das auch für das Bild des Propellers gelten, wenn das Bild aus einem digitalen Video
stammt? 76 Digitale Kameras haben keinen Schlitzverschluss; auch wenn selbst das Handy, bei
dem für Mechanik gar kein Platz wäre, bei jeder Aufnahme das traditionelle Geräusch imi-
tiert…
Das Problem löst sich, wenn man sich klarmacht, dass digitale Kameras so funktionieren, als
ob sie einen Schlitzverschluss hätten. Und dies führt auf den Kern der digitalen Bildaufzeich-
nung zurück. Digitale Bilder bestehen bekanntlich aus einem Raster von Pixeln, das in Zeilen
und Spalten gegliedert ist. Weniger trivial ist, dass damit immer auch die Zeit eine Rolle
spielt. Ganz im Gegensatz zur Alltagsauffassung, die es als geradezu kennzeichnend für Bil-
der ansehen würde, dass sie ihre Inhalte schlagartig/instantan präsentieren, was sie von zeit-
gebundenen Medien wie der Schrift oder der Musik unterscheidet.
Wenn ein digitales Bild gemacht wird, fällt das Licht auf die Zellen des Sensors, und diese
sind räumlich nebeneinander, in einer regelmäßigen Rasterfläche, geordnet. Dann aber wird
der Sensor ausgelesen, und dies geschieht zeitlich sequenziell, Pixel für Pixel und Zeile für
Zeile; der Strom von Bits wird über eine Leitung übertragen und dann, ebenfalls sequenziell,
in einem Speicher abgelegt.
Dies alles geschieht sehr schnell, und sicherlich unterhalb der Schwelle der menschlichen
Wahrnehmung; in bestimmten einzelnen Fällen – etwa dem des Propellers – aber wird die
zeitliche Verschiebung innerhalb des Bildes als räumliche Verzerrung sichtbar.
In digitalen Bildern regiert die Zeit; und dies einfach deshalb, weil Rechner 77 ihre Daten
grundsätzlich sequenziell – in strenger Abfolge – verarbeiten. Ich habe an anderer Stelle argu-
mentiert, dass der Computer diese Logik von der Telegrafie übernimmt; 78 Bernhard Vief hat
sehr richtig gesagt, dass die Zerlegung und Sequenzialisierung von Bildern mit der Hoch-
75
Noch einmal das Foto aus dem Jahr 1913; http://www.flong.com/texts/lists/slit_scan/, 17. 8. 18;
„This 1913 still photograph by Jacques-Henri Lartigue demonstrates an unintended form of slit-scanning, which
results when a fast subject is captured by a camera with a slow vertical shutter.”
http://www.flong.com/texts/lists/slit_scan/ , 25. 8. 18.
76
Vgl. FN 14, 15.
77
…jedenfalls Von-Neumann-Rechner…
78
Winkler, Prozessieren, a. a. O, S. 277-296.20
frequenztechnik des analogen Fernsehens beginnt; 79 Bildtelegraphie und Fax stellen das histo-
rische Bindeglied beider dar.
13. Theoretische Schlussfolgerung
Die technischen Beispiele zeigen, dass es sich nicht um ein Luxusproblem handelt, wenn
Medienkünstler sich mit dem Umschlag von Zeit in Raum befassen. In meinem Schlussteil
nun möchte ich das Thema deshalb in einen etwas allgemeineren Rahmen stellen.
Meine erste These ist, dass alle Speichermedien auf der prekären Grenze zwischen Zeit und
Raum ihren Ort haben. Immer und grundsätzlich stellen Speicher still, was bis dahin ein Vor-
gang war und damit eine notwendig zeitliche Dimension hatte. Was gespeichert wird, wird
dem Fluss der Zeit entrissen. 80
Zum zweiten wäre darauf zu bestehen, dass Speicher immer räumliche Speicher sind. Spei-
cher gibt es nur als physisches Objekt; und wenn Objekte durch ihre Beharrungskraft be-
stimmt sind, durch ihre Eigenschaft, dass sie als Gegen-stand der Zeit entgegenstehen, dann
kann man sagen, dass mediale Speicher diese Trägheit der Objekte mitbenutzen.
Dies ist wichtig, weil dies bei der zweiten prominenten Medienfunktion, der Übertragung,
anders ist: Die Techniken der Übertragung haben auf ihrem Weg vom materiellen Brief hin
zum Mobilfunk einen Prozess der ‚Immaterialisierung‘ durchlaufen; und auch wenn dieser
Begriff nicht unproblematisch ist,81 ist unbestreitbar, dass Signifikanten und Kanäle mit ihrem
Dingcharakter auch ihre Bindung an den Raum verlieren.
Umso klarer muss man konstatieren, dass dies für die Speicher in keiner Weise gilt. Speicher
sind und bleiben an die Welt der Dinge und an den Raum gebunden. Es ist gelungen, die Spei-
cher eindrucksvoll zu miniaturisieren; auch kleine Dinge aber bleiben Dinge und beanspru-
chen Raum.
Meine dritte These betrifft den Umschlag von Zeit in Raum und von Raum in Zeit. Am
Beispiel des Films war zu sehen, dass Aufzeichnung und Projektion, Verräumlichung und
Wiederverzeitlichung aufeinander verwiesen sind. Man kann sich dies als einen Zyklus
vorstellen, der beide Momente, Verräumlichung und Wiederverzeitlichung, miteinander ver-
bindet. Im Kern geht es darum, wie das Fluide und das Stabile, die Medien-Praktiken und die
Medien-Dinge zusammenhängen. Und dies nun ist in meiner Perspektive nicht mehr und nicht
weniger als der Kern-Mechanismus, um den sich alles Mediale dreht.
Denn wie in aller Welt, und nun wechsele ich endgültig ins Allgemeine, kann es überhaupt zu
so etwas wie ‚symbolischen‘ Prozessen kommen? Wie entsteht ein Raum von Zeichen, wenn
diese einerseits Teil der materiellen Welt sind, und ihr gleichzeitig gegenüberstehen? Wie
entsteht dieser Raum der Reflexion (?) oder Repräsentation (?), die Möglichkeit, Dinge und
Sachverhalte symbolisch zu modellieren und dann mit Zeichen statt im Realen, probeweise zu
agieren? 82 Was macht Zeichen zu Zeichen, und wie reißen sich die Zeichen aus der Welt der
anderen Dinge los?
79
Vief, Bernhard: Über die Unschärfe von Zeitschnitten. In: Transit (Hg.): On The Air. Kunst im öffentlichen
Datenraum. Wien 1994, S. 135-158, S. 144f..
80
Vgl.: Winkler, Prozessieren, a. a. O., S. 153-178.
81
…weil die Rede von der ‚Immaterialisierung‘ den nach wie vor technischen Aufwand vergisst…
82
Der Gedanke, das Symbolische über das Probehandeln zu bestimmen, kann hier nur sehr verkürzt wieder-
gegeben werden. Ich habe ihn ausgearbeitet in: Winkler, Prozessieren, a. a. O., S. 233-254, S. 246ff.21 Friedrich Kittler, der wohl prominenteste Vertreter der dt. Medienwissenschaft in den 80er und 90er Jahren, hat und hätte die Frage so nicht gestellt, gleichzeitig aber hat er eine klare Antwort gegeben: All dies geht nur über einen ersten Schritt der Verräumlichung, der den Bann der Zeit bricht und das Material als Material, und als symbolisches Material, allererst freistellt. 83 Ich selbst habe vorgeschlagen, die Medien darüber zu bestimmen, dass sie den Raum für ein symbolisches Probehandeln eröffnen. Ein Probehandeln, das – anders als ein tatsächliches Handeln – reversibel ist. Und wenn das so ist, dann hängt das Probehandeln von einem ersten Akt der Verräumlichung ab; denn Probehandeln kann ich nur mit Dingen, die ich vorher dem irreversiblen Fluss der Zeit entrissen habe. 84 Die Umsetzung von Zeit in Raum und Raum in Zeit also ist weit mehr als eine Art Glas- perlenspiel, das ich innerhalb der Medien tun (oder eben auch lassen) kann. Stillstellung/Ver- räumlichung vielmehr konstituiert den Raum, in dem (und das Material, mit dem) symbo- lisches Handeln überhaupt möglich ist. Und wenn künstlerische Projekte innerhalb der Medien mit dieser Grenze spielen, dann schließt dies immer auch eine Reflexion auf jene ‚erste‘ Verräumlichung ein. Damit ist das Terrain markiert, auf dem die beschriebenen Raum/Zeit-Projekte sich tummeln. Die Projekte selbst brauchen die Theorie nicht, sie sind für sich genommen reizvoll und An- lass zum Denken genug. Aus Sicht der Theorie – oder bescheidener: aus der Sicht der vorge- schlagenen Thesen – aber bekommen sie, denke ich, zusätzliche Relevanz. Und vor allem kann es umgekehrt beim Nachdenken über die Medien nicht nur um Begriffe gehen, weil erst die konkrete Anschauung, exponierte Einzelprojekte und case based reasoning die tatsäch- liche Komplexität der Fragen zeigen. Die Übersetzung von Zeit in Raum und von Raum in Zeit ist ein gutes Beispiel für die These von Michel Serres, Medien seien – vor allem anderen – Übersetzer. 85 Dem nachzugehen aber wäre sicher eine eigene Überlegung… 83 „An der Zeit hat alle Kunst ihre Grenze. Sie muß den Datenfluß des Alltags erst einmal stillstellen, bevor er Bild oder Zeichen werden kann.“ (Kittler, Friedrich: Grammophon, Film, Typewriter. Berlin 1986, S. 10. (Her- vorh. H. W.)). Kittler hätte es sicher für abwegig gehalten, nach einer Trennlinie zwischen dem Symbolischen und dem Nicht- Symbolischen zu fragen; und auch der Begriff des ‚Probehandelns‘ findet sich in seinen Schriften nicht. Mit der Formulierung „…bevor [der Datenfluss des Alltags] Bild oder Zeichen werden kann“ aber nimmt er exakt diese Trennlinie in den Blick… Vgl.: Winkler, Prozessieren, a. a. O.. 84 Winkler, Prozessieren, a. a. O., S. 246ff.. 85 Serres, Michel: Hermes III. Übersetzung. Berlin: Merve 1992 (EV, frz.: 1974).; vgl.: Winkler, Prozessieren, a. a. O., S. 39ff.
Sie können auch lesen