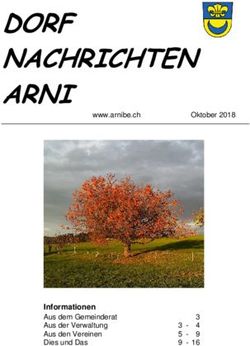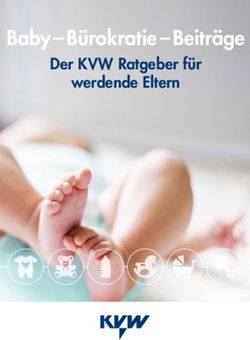Mit Mütze, Bier und Suppe Gemeinsam gegen Leerstand
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Mit Mütze, Bier und Suppe
Gemeinsam gegen Leerstand
Roland Gruber, nonconform architektur vor ort
Beinahe jede Anfrage, die ein Bürgermeister in den letzten Jahren an unser Büro
richtete, widmete sich der Frage, wie mit den Leerständen in der eigenen Stadt
oder Gemeinde umzugehen sei. Denn das Phänomen der aussterbenden Ortskerne
ist nicht zu übersehen. „Durch die rapide Überalterung im ländlichen Raum und die
jahrzehntelange monofunktionale Siedlungserweiterung an den Ortsrändern kommt
es schnell zum Donut-Effekt“, erklärt Hilde Schröteler-von Brandt, Professorin an
der Universität Siegen. „Das bedeutet, dass sich zuerst die identitätsprägenden
Ortszentren entleeren. Wo die Einwohner fehlen, rutschen auch die
Handelsflächen mit ins Donut-Loch.“
Doch Leerstand ist mehr als das landesweite Aussterben von Ortskernen.
Von Verfall und Unternutzung betroffen sind auch Ställe, alte Speicherbauten und
nicht mehr genutzte Höfe, Fabriken, die aufgrund des Strukturwandels in
Landwirtschaft und Industrie aufgelassen werden mussten, öffentliche Bauten, in die
Jahre gekommene Einfamilienhaussiedlungen sowie monostrukturelle
Gewerbegebiete der letzten Jahrzehnte.
Die Beschäftigung mit Schrumpfungsprozessen und mit der Transformation
des baulichen Bestands stellt die Planung vor vollkommen neue Herausforderungen.
„Die Raumplanung, eine Disziplin, die sich unter den Bedingungen fordistischen
Wachstums entwickelt hat, steht angesichts des tiefgreifenden strukturellen
ökonomischen und gesellschaftlichen Wandels vor großen Herausforderungen“,
stellt Rudolf Scheuvens, Professor für Örtliche Raumplanung und Stadtentwicklung
an der Technischen Universität Wien, im Rahmen der Österreichischen
Leerstandskonferenz fest. „Dies vor allem dann, wenn die Voraussetzungen des
steten Wachstums nicht mehr zutreffen.“
Die Auseinandersetzung mit der Leerstandsproblematik wirft komplexe
Fragen über die Produktion und den Gebrauch der gebauten Umwelt auf: Wie kann
Leerstand erfasst werden? Welche Ursachen liegen diesem immer häufiger
auftretenden Phänomen zugrunde? Welche Strategien können Gemeinden und
Städte ergreifen, um Leerständen vorzubeugen? Vor allem aber: Welche neuen
Planungsmethoden müssen entwickelt werden, um einen konstruktiven Umgang mit
den Potenzialen leerstehender Räume zu fördern? Und wie können die Bürgerinnen
und Bürger in den Lösungsprozess konstruktiv miteinbezogen werden?
Mit der vor ort ideenwerkstatt®, einer neuen, von uns entwickelten
Planungsmethode versuchen wir, all diese Fragen mithilfe jener Menschen zu
beantworten, die mit der Problematik am besten und längsten vertraut sind – mit
den Bewohnerinnen und Bewohnern, mit den Nutzerinnen und Nutzern. Der Clou
dabei: Wir verlassen unsere Schreibtische und bauen direkt vor Ort unser
1temporäres Büro auf. Gemeinsam mit den Betroffenen erarbeiten wir live, also in
Echtzeit, eine Handvoll maßgeschneiderter Konzepte. Nach nur drei Tagen voller
Ideen, Interviews und Inspirationen und der Analyse von oft tausenden Ideen wird
die konkrete Lösung in einem gemeinschaftlichen Verdichtungsakt entwickelt, um
unmittelbar darauf auf Herz und Nieren geprüft zu werden.
Mütze, Bier und Suppentopf sind dabei wichtige alltägliche Bausteine, auf
die wir in den World Cafés und Besprechungsrunden zurückgreifen, um die
Hemmschwelle zu überwinden und der Kreativität der Bürgerinnen und Bürger auf
die Sprünge zu helfen. Das gemeinsame Entwickeln von Zukunft darf durchaus
Freude bereiten und auch mal Spaß machen. In der letzten Ausgabe von oö.Planet
(01/14) wird uns attestiert, „die Bürgerbeteiligung quasi neu erfunden“ zu haben.
Auch so ein Feedback macht Freude.
Im Rahmen unserer Arbeit mit der vor ort ideenwerkstatt® sind in den letzten
Jahren einige Projekte beziehungsweise Projektinitiativen entstanden, die im
Umgang mit der Leerstandsproblematik in Gemeinden und Städten eine neue
strategische Stoßrichtung exemplarisch vorzeigen. Die im Folgenden präsentierte
Auswahl umfasst Lösungsvorschläge für einzelne leerstehende Gebäude, aber auch
für leerstehende, ausgestorbene Ensembles und ganze Gemeindegebiete.
Die Rathausbühne in Guntramsdorf
In der niederösterreichischen Gemeinde im Südwesten Wiens stand das alte, nicht
sanierungsfähige Rathaus in der Ortsmitte leer. Durch diesen Umstand wurde der
umliegende Rathausplatz kaum mehr genutzt war ein funktionsleerer Raum. In
Zusammenarbeit mit den Bürgerinnen und Bürgern wurde beschlossen, das
Gebäude im Ortszentrum bis auf die Kellerdecke abzutragen und das dadurch
geschaffene Podest als Dorfplatz, Veranstaltungszone und leicht erhöhte
Festivalbühne zu nutzen. Der alte Keller bleibt erhalten und ist sowohl
Versorgungsfläche für die Rathausbühne wie auch Showroom der regionalen
Winzer sowie für kleine Veranstaltungen aller Art zu nutzen. Das Ergebnis trägt
Früchte: „Ich freue mich über die vielen engagierten Bürgerinnen und Bürger, die
diese Chance zur Mitgestaltung genutzt haben, um gemeinsam einen Platz der
Begegnung als neuen Ortsmittelpunkt zu schaffen“, sagt Bürgermeister Karl
Schuster.
Leoben: Ein Schulhaus macht Schule
Mitte des 20. Jahrhunderts hatte Leoben fast 40.000 Einwohner. Seit der Stahlkrise
in den Siebziger Jahren ging die Einwohnerzahl auf nunmehr 24.000 kontinuierlich
zurück. Unter der schrumpfenden Bevölkerung litt auch das zuletzt fast leerstehende
Schulhaus in Leoben-Donawitz. Ein intensiver Beteiligungsprozess mit allen
Schülern, Lehrern, Eltern, der Schulgemeinschaft, den Behörden und den Planer
führte zum Entschluss, im bestehenden Schulgebäude mehrere Schultypen von der
Volksschule über die Neue Mittelschule (NMS) bis hin zur Polytechnischen
Lehranstalt unterzubringen und das Gebäude punktgenau zu verändern. „Drei
Schulen unter einem Dach, das ist ein außergewöhnliches Projekt“, meint Alt-
Bürgermeister Matthias Konrad. „Das ist eine Leobener Schulstrukturreform.“
2Stadt Haag entdeckt den Theatersommer
Mit seinen rund 5.000 Einwohnern ist Haag eine typische Kleinstadt im
niederösterreichischen Alpenvorland. Das Zentrum schien ausgestorben, der
Leerstand rund um den Hauptplatz war enorm, das kommerzielle Leben
konzentrierte sich in den Fachmarktzentren am Ortsrand. Im Jahr 2000 entstand die
Idee, den Hauptplatz nachhaltig wiederzubeleben und ein alljährlich
wiederkehrendes Theaterfestival zu etablieren. Die mobile Tribüne mit ihrem
charakteristischen Design und ihren 600 Sitzplätzen, die wir zu diesem Zweck
geplant haben, ist heute nicht nur ein temporäres Wahrzeichen, das mittlerweile mit
zahlreichen internationalen Preisen ausgezeichnet wurde, sondern auch ein
Impulsgeber und Initiator für neues Leben und neue Bauimpulse im Haager
Ortszentrum. Der Leerstand ist nahezu komplett beseitigt, vor allem auch
qualitätsvoller Wohnraum wurde geschaffen.
Zeillern rollt seinen roten Teppich aus
Die Bevölkerung der niederösterreichischen 1.300-Einwohner-Gemeinde hat einen
wichtigen Konsens erzielt: Ein leerstehendes Gasthaus im Ortszentrum wurde
angekauft, um darauf „attraktives Wohnen für junge Familien wie auch Raum für
betreubares Wohnen für alte Menschen im Zentrum“ zu schaffen. Die rundum
liegende Freifläche wurde einem gemeinsamen Ideenfindungsprozess unterzogen
und führte schließlich zu der Idee, auf dem Dorfplatz einen „Roten Teppich“
auszurollen. Der buchstäblich rot betonierte Platz, der die Kirche mit dem Schloss
Zeillern verbindet, dient heute vor allem als Bühne und Hintergrundkulisse für
Hochzeiten. Nicht zuletzt dient er dem Niederösterreichischen
Blasmusikausbildungszentrum, das im Schloss Zeillern untergebracht ist, als
akustisches Trottoir. Das Projekt entpuppte sich als Breitbanderfolg, denn die
Gemeinde ist am besten Weg, eine echte „Blasmusikgemeinde“ zu werden.
Hörsching hebt wieder ab
Den meisten österreichischen Flugpassagieren ist Hörsching ein Begriff. Doch der
6.000-Einwohner-Ort umfasst nicht nur den Linzer Flughafen, sondern auch ein
ausgestorbenes und sanierungsbedürftigen Dorfzentrum. Um das Leben von der
Peripherie wieder ins Zentrum zu locken, soll der Brucknerplatz neu gestaltet
werden. Die denkmalgeschützten Häuser sollen saniert, ein leerstehendes Gasthaus
abgerissen und neu gebaut werden. In Zukunft soll das Zentrum kommunale
Nutzungen wie beispielsweise ein Eltern-Kind-Zentrum, ein Bürgerservice, eine
Sozialberatungsstelle sowie diverse Geschäfte, Büros und Veranstaltungsräume
beherbergen. Vor kurzem wurde ein Projektmanager bestellt, der die ersten
Maßnahmen dieses langfristigen Projekts realisieren soll.
In Illingen geht’s um die Wurst
Seit zwölf Jahren wartet die saarländische Gemeinde im Westen Deutschlands auf
eine Neuentwicklung der großen, zentralen Industriebrache. Für die ehemalige
Wurstfabrik im Stadtzentrum, die einst 500 Arbeitsplätze umfasste, wurden bereits
etliche private Nutzungskonzepte erarbeitet, allerdings konnte bisher keines dieser
Szenarien den Ansprüchen der Illinger gerecht werden. Vor zwei Jahren hat die
3Gemeinde Bundesfördermitteln zur Zentrumsentwicklung beantragt und die
Entwicklung der innerstädtischen Brache nun selbst in die Hand genommen. In
einem Partizipationsprozess, an dem sich ein Großteil der 15.000 Einwohner
beteiligt haben, wurde beschlossen, den Gebäudebestand teilweise zu erhalten und
darin Nahversorger, Büros und Wohnungen unterzubringen. Herzstück des
Zukunftsszenarios ist ein Marktplatz mit einer Opern-Air-Veranstaltungsfläche für
kulturelle Aktivitäten und einem angeschlossenen Pflegewohnheim mit betreutem
Wohnen.
Die Stadt Innsbruck erprobt die Live-Nutzungsentwicklung
Mitten im Stadtzentrum der Tiroler Landeshauptstadt Innsbruck liegt die historische
Rotunde. Das beeindruckende Rundgebäude wurde Ende des 19. Jahrhunderts für
die Unterbringung des Riesenrundgemäldes „Die Schlacht am Bergisel“ errichtet.
Direkt daneben befindet sich eine charmante, ebenfalls in die Jahre gekommene
Talstation der Hungerburgbahn aus den 1950er Jahren, die die Bewohner und
Touristen einst vom Stadtzentrum in die Gipfel der umliegenden Berge führte. Beide
Gebäude sind seit einigen Jahren ungenutzt, die Rotunde steht unter
Denkmalschutz.
Wie geht man mit solchen Leerständen an neuralgischer urbaner Stelle um?
Was soll mit dem gesamten innerstädtischen Rotunden-Areal passieren? Und
welche Veränderungsprozesse sind gewünscht? Eine Möglichkeit wäre, das Areal
der öffentlichen Hand zu überlassen. Eine andere, es an Investoren zu verkaufen.
Doch das letzte Wort sollten die 120.000 Bürgerinnen und Bürger haben!
In einem breit angelegten, öffentlichen Ideenfindungsprozess mit Beteiligung
aller interessierten Bürgerinnen und Bürger wurden viele verschiedene
Nutzungsszenarien und bauliche Veränderungsmöglichkeiten ausgetüftelt und auf
eine gemeinsame Idee eingedampft. Das Ergebnis: Das gesamte Rotundenareal soll
nun als Brutstätte für Kreativität und Innovation genutzt werden – mit einem Fokus
auf die Jugend.
Wie die Bespielung im Detail aussehen soll, wird nun direkt vor Ort in einer
spannenden Live-Nutzungsentwicklung ausprobiert. Diese differenzierte Testphase
wird sich über einige Jahre ziehen und Grundlagen für die weitere inhaltliche
Programmierung des Areals liefern. Nur auf diese Weise kann jene kreative
Bandbreite erzielt und ausgetestet werden, die von der Bevölkerung gewünscht
wird. Das heißt: In den kommenden drei Jahren könnten Organisationen,
Institutionen und Privatpersonen langfristige Nutzungsszenarien vorschlagen und
direkt vor Ort ausprobieren. Die Zeit wird weisen, welche Nutzung bzw. Nutzungen
sich bewähren. Erst danach wird die Rotunde – maßgeschneidert und punktgenau
– baulichen Veränderungen unterzogen werden.
4FACTBOX
nonconform architektur vor ort wurde 1999 von den beiden Kärntnern Roland
Gruber (geboren und aufgewachsen in Bad Kleinkirchheim) und Peter Nageler
(geboren in Paternion, aufgewachsen in Fresach) gegründet und 2003 um Caren
Ohrhallinger (Braunau/OÖ) und 2013 um Katharina Kothmiller (St.Pölten) erweitert.
Derzeit hat nonconform Büros in Wien und Kärnten (15 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter).
nonconform arbeitet fast ausschließlich im Schnittfeld von Architektur, Städtebau
und kommunaler Entwicklung. Die Arbeitsweise zeichnet sich dadurch aus, dass
nonconform bereits frühzeitig in den Planungsprozess involviert wird – noch bevor
eine konkrete Bauaufgabe feststeht. Um die Entscheidungsfindung professionell
begleiten zu können, hat nonconform mit der vor ort ideenwerkstatt® ein
partizipatives Planungsinstrument kreiert, das die Organisation kommunaler
Projektentwicklungs- und Planungsprozesse unter größtmöglicher Miteinbeziehung
der Bürgerinnen und Bürger von der Ideensuche bis zur Umsetzung betreut.
Zahlreiche Kommunen, die an der Durchführung einer vor ort ideenwerkstatt
Interesse zeigen, kämpfen mit Leerständen im Ortszentrum und zunehmend auch in
Neubaugebieten. Häufig ist die Ratlosigkeit im Umgang mit dem ausgestorbenen
Ortskern ein wesentlicher Auslöser für die Beauftragung. Die vor ort ideenwertstatt
ist ein alternatives Modell, wenn die klassischen Planungsmethoden versagen.
Seit 2011 veranstaltet nonconform architektur vor ort die Österreichische
Leerstandskonferenz, die heuer in Leoben stattfinden wird. Der Think Tank befasst
sich mit dem unangenehmen Thema Leerstand und bietet Lösungskonzepte und
Best-Practice-Beispiele.
à www.nonconform.at
à www.vorortideenwerkstatt.at
à www.leerstandskonferenz.at
5Sie können auch lesen