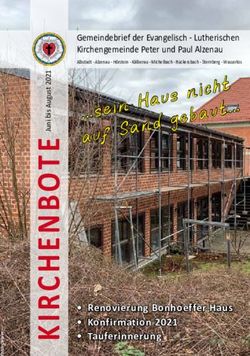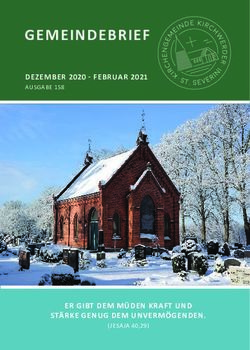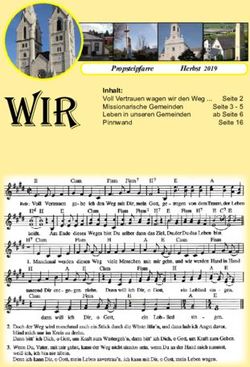Moral und Mord im Namen Gottes?
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Textarchiv TA-2007-9
Moral und Mord im Namen Gottes?
Zusammenhänge, deren Abwesenheit und Aufklärung.
von Manfred Spitzer
Als ich noch ein kleiner Junge war, fiel mir auf, dass mein Vater nie in die Kirche ging. Ich fragte ihn
also eines Tages, ob er denn nicht an Gott glaube. „Nein", meinte er, er glaube nicht an Gott. Ich
ließ nicht locker und in typischer Kindermanier fuhr ich fort: „Warum denn nicht?" Daraufhin erklärte
mir mein Vater ganz ruhig Folgendes: Er sei ganz normal erzogen worden und der Kirchgang ge-
hörte für ihn zum Alltag wie das Zähneputzen oder das gemeinsame Abendessen in der Familie.
Dann aber kam der Krieg (bei dessen Beginn mein Vater gerade einmal 14 Jahre alt war) und er
habe als Soldat miterlebt, wie die Pfarrer auf beiden Seiten der Front die Waffen gesegnet und für
den Endsieg gebetet hätten. Da sei ihm klar geworden, dass am Glauben etwas nicht stimmen
könne und seither glaube er an gar nichts mehr. - Ich war tief beeindruckt und habe seit diesem
Erlebnis nie mehr mit meinem Vater über religiöse Fragen gesprochen. Die Sache war klar.
„Ist die religiöse Entwicklung eines Menschen von dessen moralischer Entwicklung unab-
hängig?"
Seit dem 11. September 2001 denken wir bei religiös motiviertem Terror vor allem an Islamisten
und Selbstmordattentäter. Der Bombenterror der katholischen irisch-republikanischen Armee (IRA)
im protestantischen Nordirland scheint ebenso vergessen, wie die Rolle der Kirchen in beiden
Weltkriegen, von den Kreuzzügen gegen die „Ungläubigen" einmal gar nicht zu reden. Ebenfalls
weitgehend unbekannt sind durchaus schon etwas ältere psychologische Studien zum Zusammen-
hang zwischen Religiosität und Verhalten. Um es gleich zu sagen: Es gibt kaum einen. Betrachten
wir einige Beispiele:
Der Zusammenhang zwischen Religiosität und Hilfsbereitschaft wurde an College - Studenten im
Alter von 19 Jahren empirisch untersucht (2). Zunächst mussten die Studenten unterschiedliche
wirtschaftliche, gesellschaftliche, ästhetische, theoretische, politische und religiöse Aktivitäten dar-
aufhin einschätzen, wie viel diese ihnen wert waren. Man ging ganz einfach davon aus, dass die
Rangordnung, welche die Menschen diesen Aktivitäten zuweisen, etwas darüber aussagt, was
ihnen wichtig ist. Man hierarchisierte also die Werte der Studenten. Danach wurden diese mit 16
Aussagen der Bibel konfrontiert, deren Realitätsgehalt eingeschätzt werden musste. Schließlich
wurden sie danach befragt, wie häufig sie beteten und die Kirche besuchten.
Etwa zwei Wochen nach dem Ausfüllen der Fragebögen wurden die Studenten gebeten, an einem
Experiment teilzunehmen. Es wurde ihnen mitgeteilt, dass es lediglich 15 Minuten dauern würde.
Diejenigen, die sich freiwillig gemeldet hatten, wurden dann einzeln von einem Versuchsleiter zu
einem großen, recht leeren Raum geführt. Dort erklärte der Versuchsleiter ein Geschicklichkeitsex-
periment, meinte dann aber, er müsse seine kaputtgegangene Stoppuhr holen, und ließ den Stu-
denten „für ein paar Minuten" alleine. Genau zwei Minuten später betrat eine Frau den Raum,
nahm eine an die Wand gelehnte Aluminiumleiter, verschwand damit in einem angrenzenden Raum
1Manfred Spitzer / Moral und Religiosität / Textarchiv: TA-2007-9
und schloss die Tür hinter sich. Die Frau war Teil des Experiments. Im angrenzenden Raum stieg
sie auf die erste Stufe der Leiter, sprang wieder herunter, schleuderte die Leiter gegen ein Stück
Sperrholz, das an die zum Lagerraum angrenzende Wand gelehnt war, und warf eine Bratpfanne
aus Metall auf den Fußboden, während sie gleichzeitig laut vernehmbar stöhnte und eine Stoppuhr
aktivierte. Danach wartete die Frau für 90 Sekunden in Ruhe, oder so lange, bis die Versuchsper-
son im anderen Lagerraum die Tür zu ihrem Raum öffnete. Genau darauf kam es an: Man be-
stimmte die Zeit in Sekunden, innerhalb der die Versuchsperson zu Hilfe eilte.
„Was die Gruppenzugehörigkeit im Hinblick auf Religiosität jedoch anbelangte, zeigte sich
abermals kein Zusammenhang mit der Hilfsbereitschaft."
Zur Auswertung kamen dann alle drei Datensätze: Die Hilfeleistung auf der einen Seite, und das
zuvor angegebene Wertesystem bzw. religiöse Verhalten auf der anderen Seite. Insgesamt zeigte
sich Folgendes: 35 der insgesamt 71 Studenten (48 %) öffneten die Tür zum angrenzenden Raum,
versuchten also, Hilfe zu leisten. Ein Zusammenhang zwischen Wertesystem, Bibelfestigkeit und
Ausmaß des persönlichen Glaubens an die Bibel sowie der Häufigkeit des Kirchgangs bzw. privater
Gebete einerseits und der Hilfsbereitschaft für eine fremde Person (die möglicherweise gerade
einen Unfall erlitten hat, das heißt, von der Leiter gefallen ist) wurde nicht gefunden.
Diese Ergebnisse lassen sich mit den Überlegungen von Lawrence Kohlberg (23) zur Entwicklung
der Moral beim Menschen in Verbindung bringen. Kohlberg nimmt an, dass es insgesamt sieben
Stufen gibt, auf denen sich das moralische Verhalten eines Menschen zeigt, vom einfachen „Wie-
du-mir-so-ich-dir", zum höheren Einsehen in die Notwendigkeit auch selbstlosen Verhaltens. Nach
Kohlberg ist es Ausdruck einer höheren moralischen Entwicklungsstufe, wenn ein Unbeteiligter
einem Fremden zu Hilfe eilt. Aus seiner Sicht ist die religiöse Entwicklung eines Menschen von
dessen moralischer Entwicklung unabhängig. Das Ergebnis der eben beschriebenen Untersuchung
scheint dies zu bestätigen.
Eine frühere Studie zum Thema Hilfsbereitschaft an 82 Studenten der Columbia Universität in New
York ergab ebenso keinen Zusammenhang zwischen dem regelmäßigen Besuch einer Kirche oder
Synagoge und altruistischen Verhaltensweisen. Die gleiche Studie ergab zudem, dass Einzelkinder
signifikant stärker egoistisch (weniger hilfsbereit) sind als der Durchschnitt (7).
Nun könnte man argumentieren, dass sich diese Studien an Studenten keineswegs auf alle Men-
schen verallgemeinern lassen (26). Denn erstens ist ihr religiöses Empfinden vielleicht noch unreif,
noch nicht eingebunden in eine Gesamtpersönlichkeit oder schlichtweg nicht richtig erfasst mit
einem Fragebogen, den man auch sehr oberflächlich ausfüllen kann – schließlich geht es ja um
nichts. Zweitens ist das Fehlen des Nachweises eines Zusammenhangs nicht zu verwechseln mit
dem Nachweis des Fehlens desselben: Lack of proof is not proof of lack, wie die Amerikaner kurz
und bündig zu formulieren pflegen. Gegen diese Argumente spricht allerdings, dass man durchaus
Auswirkungen der Religiosität bei Studenten findet, die Methoden also geeignet sind, tatsächlich
vorhandene Effekte aufzudecken. Zudem findet religiöse Erziehung sehr früh im Leben statt, weil
diese frühen Erfahrungen prägen, wie alle bedeutenden Religionsführer wussten und deren Nach-
folgeorganisationen nur zu gut wissen. Schließlich erfolgten derartige Studien nicht nur an Studen-
ten, sondern auch bei der erwachsenen Normalbevölkerung oder gar bei (sicherlich erwachsen)
Bischöfen.
Eine retrospektive Studie an Menschen, die ihr Leben riskiert hatten, um während des Dritten
Reichs Juden vor den Nationalsozialisten zu retten, ergab, dass „die Retter sich nicht signifikant
von Zuschauern bzw. allen Nicht-Rettern im Hinblick auf religiöse Einstellung, religiöse Erziehung,
ihre eigene Religiosität oder die Religiosität ihrer Eltern unterschieden" (16).
2Manfred Spitzer / Moral und Religiosität / Textarchiv: TA-2007-9
„Religiöse Menschen stehen den Risiken einer drohenden Umweltkatastrophe indifferent
gegenüber oder schätzen sie sogar eher als geringer ein."
Der fehlende Zusammenhang zwischen Religiosität und Hilfsbereitschaft zeigte sich in einer gan-
zen Reihe von Studien. Manchmal jedoch ergab sich sogar ein negativer Zusammenhang: In einer
Studie an 100 Bischöfen, 259 Priestern und 1.530 Kirchengemeindemitgliedern der episkopalen
protestantischen Kirche in den USA, die von deren Hauptquartier in Auftrag gegeben worden war
(9), zeigte zunächst keinen Zusammenhang zwischen Religiosität und Hilfsbereitschaft (gemessen
als erfragte gemeinnützige Spenden). Bei Aufteilung der Probanden in Untergruppen zeigte sich
sogar ein negativer Zusammenhang: So gaben nur 12 % der am stärksten in die Kirche involvierten
Gemeindemitglieder an, im letzten Jahr für das Rote Kreuz gespendet zu haben, wohingegen die
am wenigsten in die Kirche involvierten Gemeindemitglieder dies in 23 % getan hatten (9).
Ebenfalls kein Zusammenhang zwischen der Ausprägung von Religiosität einerseits und Hilfsbe-
reitschaft sowie der Bereitschaft zum Schummeln andererseits wurde in einer Untersuchung von
Smith und Mitarbeitern (19) an 402 Psychologiestudenten (165 männlich und 237 weiblich) festge-
stellt. Die Gesamtgruppe wurde in vier Gruppen eingeteilt: (1) die sehr religiösen „Jesus-People" (n
= 49), die mehr als 15 Minuten täglich mit religiösen Aktivitäten verbrachten; (2) die religiösen Stu-
denten, die bis zu 15 Minuten täglich mit religiösen Aktivitäten verbrachten (n = 125); (3) die nicht
religiösen Studenten (n = 174) und (4) die Atheisten, die dadurch definiert waren, dass sie die Exis-
tenz von Gott explizit verneinten (n = 54).
Die Tendenz der Studenten zum Schummeln, also bei Gelegenheit und Möglichkeit zum eigenen
Vorteil zu lügen, wurde im Rahmen eines Tests untersucht. Die Studenten hatten 40 Fragen mit
Multiple-Choice-Verfahren zu lösen und die Antworten mit einem Bleistift auf einem Standard-
Antwortformular anzukreuzen. Danach wurden die Tests eingesammelt und vom Versuchsleiter
wurden (ohne dass die Studenten dies wussten) Fotokopien erstellt. In der nächsten Stunde wur-
den die Tests wieder ausgeteilt, und der Versuchsleiter sagte den Studenten, dass er ihnen ver-
trauen würde, und dass sie sich selbst benoten könnten. Den Studenten wurde weiterhin gesagt,
dass Tests nicht nur zur Prüfung von Wissen, sondern auch zum Lernen selbst eingesetzt werden
könnten, und dass man herausgefunden hätte, Studenten würden besser lernen, wenn ihnen die
Möglichkeit gegeben wird, ihre falschen Antworten zu korrigieren. Den Studenten wurde daraufhin
die von ihnen selbst geschriebene Klausur, ein Zettel mit den richtigen Antworten, sowie Hinweise
zum Auffinden der jeweils für die Frage relevanten Passagen im Lehrbuch mit nach Hause gege-
ben. Sie hatten die Aufgabe, im Lehrbuch jeweils nachzulesen, wenn sie eine Frage falsch beant-
wortet hatten. Die korrigierten und benoteten Klausurbögen sollten am nächsten Tag von den Stu-
denten erneut abgegeben werden. Bevor er die Studenten dann entließ, machte der Versuchsleiter
noch die Bemerkung, dass er dieses Verfahren bereits früher angewendet und gute Erfahrungen
damit gemacht hatte, woran sich noch die folgende Bemerkung anschloss: „Natürlich hängt der
Erfolg des Systems von der Ehrlichkeit und moralischen Integrität von Ihnen, liebe Studenten, ab.
Ich vertraue Ihnen, und ich denke, Sie können sich selbst vertrauen. Es wird immer ein paar geben,
die ihre Integrität als Person dadurch vermindern, dass sie täuschen, aber ich habe immer erlebt,
dass die meisten Studenten sich gemäß ihrer eigenen moralischen Standards verhalten, sofern
man ihnen die Möglichkeit zur Verantwortung für ihr eigenes Verhalten gibt."
Täuschungen wurden ganz einfach durch Vergleich der Fotokopien mit den danach abgegebenen
Klausurbögen ermittelt. Es zeigte sich, dass insgesamt 56 % der Studenten versuchten, ihre Klau-
sur im Nachhinein durch Schummeln zu verbessern, und dass dies in keinerlei Zusammenhang
damit stand, zu welcher religiösen Gruppierung die Studenten gehörten.
3Manfred Spitzer / Moral und Religiosität / Textarchiv: TA-2007-9
Um die Hilfsbereitschaft der Studenten zu untersuchen, verlas der Versuchsleiter am Ende des
Semesters vor der Abschlussklausur einen Brief, von dem er sagte, dass er ihn am gleichen Mor-
gen von dem Direktor eines Behandlungszentrums für geistig behinderte Kinder bekommen hätte.
In dem Brief ging es im Wesentlichen darum, dass der Direktor des Behandlungszentrums die
Studenten darum bat, freiwillig 5-mal jeweils eine Stunde mit einem behinderten Kind zu verbrin-
gen. Die Studenten sollten dann auf der Klausur im Falle ihrer Hilfsbereitschaft das Wort, ja" und
ihre Telefonnummer vermerken, sodass sie kontaktiert werden konnten. Nur 22 der Studentinnen
und 7 % der Studenten (Unterschied signifikant) boten freiwillig ihre Hilfe bei der Betreuung von
geistig behinderten Kindern an. Was die Gruppenzugehörigkeit im Hinblick auf Religiosität jedoch
anbelangte, zeigte sich abermals kein Zusammenhang mit der signalisierten Hilfsbereitschaft.
Zusätzlich konnte in dieser Studie gezeigt werden, dass Schummeln und Nächstenliebe ebenfalls
nichts miteinander zu tun hatten. Die drei moralischen Dimensionen der Religiosität, der Nächsten-
liebe und der Tendenz, die Wahrheit zu sagen, erwiesen sich damit als unabhängig voneinander.
Diese Ergebnisse passen zu einer Umfrage, bei der 81 % der befragten College-Studenten anga-
ben, dass es moralisch falsch sei, bei Prüfungen zu täuschen; zugleich gaben jedoch 80 % der
Studenten an, dass es erlaubt sei, zu täuschen, wenn andere dies auch täten. Bei der Untergruppe
der religiösen Studenten hielten 92 % das Täuschen für moralisch falsch, 87 % waren jedoch wie-
derum der Auffassung, dass man schummeln dürfe, wenn dies jeder täte (zitiert nach 19).
Eine weitere Untersuchung an 115 Einwohnern der Stadt Indianapolis ging der Frage nach, ob ein
religiöser Nachbar ein guter Nachbar ist. Die Befragten waren im Durchschnitt 47 Jahre alt, waren
überwiegend Frauen (61 %) und Angehörige der weißen Rasse (81 %). Aus den Interviews wurden
verschiedene Variablen isoliert, unter anderem die Ausprägung der Religiosität, gemessen am
Gottesdienstbesuch, sowie die Häufigkeit von Besuchen der Nachbarn sowie die Hilfsbereitschaft
gegenüber Nachbarn. Wieder gab es keinen Zusammenhang zwischen religiöser Zugehörigkeit,
nachbarschaftlicher Hilfe und nachbarschaftlichem Kontakt. Konkret bedeutet dies, dass „wer ein-
mal pro Woche in die Kirche geht, seinem Nachbarn nicht mehr hilft und ihn nicht häufiger besucht
als jemand, der überhaupt nicht in die Kirche geht" (8). Hierzu passen übrigens auch neuere Stu-
dien, die zeigen, dass religiöse Menschen den Risiken einer drohenden Umweltkatastrophe indiffe-
rent gegenüberstehen oder sie sogar eher als geringer einschätzen (18).
„Religiosität führt, wenn überhaupt, zu mehr Intoleranz"
Wenn schon Religiosität faktisch weder mit der Liebe zum Nächsten, zur Wahrheit oder zur Erde
zusammenhängt, wie steht es dann mit der Toleranz? Die wissenschaftlichen Untersuchungen
hierzu zeigen ein ähnliches Bild: Religiosität führt, wenn überhaupt, zu mehr Intoleranz (1).
Eine faktorenanalytische Untersuchung von 77 Männern und 77 Frauen, die mittels verschiedener
Verfahren (projektiver Test, Interview und Fragebogen) untersucht worden waren, ergab ebenfalls
keinen Zusammenhang zwischen den wesentlichen Maßen für Religiosität (Häufigkeit von Kirchen-
besuch, Gebeten und Spenden) und Variablen wie Nächstenliebe, Hilfsbereitschaft und Beschei-
denheit (5). Die Autoren kommentieren ihre Ergebnisse wie folgt: „Was dies im Grunde bedeutet,
ist, dass die Nichtreligiösen in unserer Stichprobe praktisch genauso oft als gute Samariter, die sich
bescheiden um ihre Nächsten kümmern, betrachtet werden, wie diejenigen, die am religiösesten
und demütigsten in unserer Gruppe abschnitten. Anders ausgedrückt, gibt es eine Menge devoter,
religiöser, zur Kirche gehender „NichtChristen" in unserer Stichprobe, wenn man die Bergpredigt
und die vier Evangelien als Maßstab für christlichen Glauben und christliches Verhalten nimmt. Es
scheint damit, dass die christlichen Kirchen zwar einen Einfluss auf ihre Mitglieder haben, sich
dieser aber auf das Beten, das Zur-Kirche-Gehen und das Spenden von Geld sowie die persönli-
4Manfred Spitzer / Moral und Religiosität / Textarchiv: TA-2007-9
che Erlösung beschränkt, und dass die Kirchen offensichtlich darin versagt haben, bei ihren Mit-
gliedern ein Verantwortungsgefühl für andere Menschen hervorzurufen" (5).
Fragte man sich noch bis vor 10 oder 15 Jahren praktisch ausschließlich im Rahmen empirischer
Studien, worin die positiven Auswirkungen von Religiosität liegen könnten, so hat sich der Fokus –
wahrscheinlich nicht zuletzt aufgrund der weltpolitischen Ereignisse – gewandelt: Es gehört heutzu-
tage durchaus zu den respektablen Objekten wissenschaftlichen Erkenntnisinteresses, sich zu
fragen, worin die negativen Auswirkungen von Religion liegen könnten. Anders gewendet: Wenn es
schon keine Zusammenhänge zwischen Religiosität und prosozialen Verhaltensweisen zu geben
scheint, so erhebt sich die Frage, wie es um die immer wieder vermuteten negativen Auswirkungen
der Religiosität steht. Religion macht aggressiv, so meinen die einen (10); nein, Religion macht
Frieden, entgegnen die anderen (15). – Was stimmt?
Um dieser Frage nachzugehen, führte Brad Bushman von der Universität Michigan, USA, zwei
Experimente durch (4): das erste an 248 Studenten und Studentinnen einer religiös geprägten US-
amerikanischen Universität und das zweite an 242 Studierenden einer niederländischen weltlichen
Universität. Von den Studierenden der US-amerikanischen Brigham Young University (BYU) gaben
99 % an, sie glaubten an Gott und die Bibel, wohingegen nur 50 % der Studierenden an der nieder-
ländischen Vrije Universität (VU) in Amsterdam an Gott und nur 27 % an die Bibel glaubten, jeweils
nach eigenen Angaben.
„Wer an Gott glaubt, wird stärker gewalttätig, wenn er zuvor liest, dass Gott die Gewalt sank-
tioniert hat."
Den Versuchsteilnehmern wurde zunächst gesagt, dass sie an zwei verschiedenen Studien teil-
nehmen würden: Eine über Literatur des mittleren Ostens und eine über die Auswirkungen negati-
ver Stimulation auf die Reaktionszeit. Sie mussten zunächst einen Text lesen, wobei der Hälfte der
Versuchspersonen gesagt wurde, es handele sich um einen Text aus dem Alten Testament und die
andere Hälfte erfuhr, es handle sich um einen Text, der bei archäologischen Ausgrabungen im Jahr
1984 gefunden wurde.
Der zu lesende Text entstammt dem Buch der Richter (19-21) des Alten Testaments und handelte
von der Geschichte eines Israeliten im Lande Kanaan, der mit seiner Geliebten in die Stadt Gibeah
im Lande Benjamins reiste. Während der dortigen Übernachtung wurde die Frau vom Pöbel aus
religiösen Gründen geschändet und ermordet. Daraufhin kam der Mann mit der Leiche seiner Ge-
liebten wieder nach Hause, und sein Heimatstamm (das Volk Ephraim) war entsetzt über das, was
die Mitglieder des anderen Volkes seiner Geliebten angetan hatten. Die eine Hälfte der Versuchs-
personen las dann die folgenden zwei Sätze: „Die Versammlung fastete und betete zu Gott und
fragt ihn „was soll getan werden im Hinblick auf die Sünden unserer Brüder in Benjamin?" und Gott
antwortete ihnen, dass so etwas bei seinem Volk nicht duldbar sei. Gott befahl den Israeliten, ge-
genüber ihrem Nachbarstamm zu den Waffen zu greifen und sie vor Gott zu bestrafen" (4, Über-
setzung durch den Autor).
Der anderen Hälfte der Versuchspersonen wurde der gleiche Text präsentiert, aber ohne diese
beiden entscheidenden Sätze. Mit anderen Worten, die Hälfte der Versuchspersonen las einen
Text, bei dem Gewalt von Gott als Rache für Mord gerechtfertigt wurde; die andere Hälfte hatte
diese Rechtfertigung nicht. Es handelte sich um ein 2x2 Design mit Quelle (Bibel vs. Ausgrabungs-
text) und Sanktionierung der Gewalt durch Gott (gegeben vs. nicht gegeben) als unabhängige
Variablen.
5Manfred Spitzer / Moral und Religiosität / Textarchiv: TA-2007-9
Die Geschichte ging dann weiter dahingehend, dass sich die Israeliten zum Kampf gegen die Ben-
jamiten versammelten, dass im Laufe des Gefechts zehntausende Soldaten auf beiden Seiten
getötet wurden, dass am Ende jedoch die Israeliten nicht nur die Stadt Gibeah, sondern weitere
Städte zerstörten und jeden töteten, Männer, Frauen und Kinder.
Nachdem die Versuchsteilnehmer die Geschichte gelesen hatten, mussten sie – im Rahmen einer
vermeintlich zweiten Studie – eine Reaktionszeitaufgabe ausführen. Ihre Aufgabe bestand darin,
dass die Versuchspersonen jeweils einen Knopf schneller drücken mussten, als ihr Gegner in der
Aufgabe und dass der jeweils langsamere durch ein lautes Geräusch über Kopfhörer für seine
Langsamkeit bestraft wurde. Die Teilnehmer konnten die Lautstärke zur Bestrafung des anderen
jeweils auswählen zwischen 60 und 105 Dezibel (dB). Die jeweiligen Spielpartner (Vertraute des
Versuchsleiters) stellten die Lautstärke des Geräuschs nach Zufall ein. „Im Prinzip hatten die Ver-
suchspersonen damit, innerhalb der ethischen Grenzen des Labors, eine Waffe unter ihrer Kontrol-
le, mit der sie ihren Partner schädigen konnten, sofern sie im Reaktionszeittest besser abschnitten"
(4, Übersetzung durch den Autor).
Die Ergebnisse der Untersuchungen waren wie folgt: Bei den religiösen Studenten gab es sowohl
einen Effekt der Herkunft des Textes (Bibel versus Ausgrabung) als auch einen Effekt der beiden
Sätze, in denen Gott die Gewalt sanktioniert: In beiden Fällen war das Resultat eine vermehrte
Aggressivität in der Reaktionszeitaufgabe durch den religiösen Kontext. Eine Analyse nach dem
Geschlecht der Teilnehmer zeigte zudem, dass Männer aggressiver waren als Frauen.
Auch bei den weniger religiösen Studenten aus den Niederlanden zeigten sich ähnliche Effekte:
Lasen sie zuvor, dass Gott die Gewalt sanktionierte, verhielten sie sich im nachfolgenden Experi-
ment aggressiver. Weiterhin zeigte sich, dass diejenigen, die an Gott glaubten, aggressiver waren,
als diejenigen, die zuvor angegeben hatten, dass sie weder an Gott noch an die Bibel glaubten. Es
fand sich zudem eine Wechselwirkung zwischen dem Glauben an Gott und dem Lesen der beiden
Sätze in denen Gott Gewalt sanktioniert: Wer an Gott glaubt, wird stärker gewalttätig, wenn er
zuvor liest, dass Gott die Gewalt sanktioniert hat (Abb. 1)
Abb. 1 Einfluss des berichteten Glaubens an Gott und die
Bibel und von Gott sanktionierter Gewalt auf das Aggres-
sionsniveau. Dieses wurde wie folgt gemessen: Die
Lautstärke des Rauschens, das der Gewinner des Reak-
tionszeittests dem Verlierer als Strafe für dessen Lang-
samkeit applizieren konnte, variierte von 0 bis 105 dB.
Insgesamt wurden 25 Durchgänge (wer ist schneller?)
pro Versuchsperson durchgeführt und die Anzahl der
Durchgänge, vor denen die Versuchsperson die Lautstär-
ke maximal einstellte, wurde als Maß des Aggressionsni-
veaus verwendet. Dieses Maß konnte also zwischen
minimal 0 und maximal 25 variieren.
Auch in der zweiten Studie gab es einen Effekt der Textquelle: Wenn die Studenten erfuhren, dass
der Text aus der Bibel stammte, waren sie hinterher aggressiver als wenn der Text vermeintlich bei
einer Ausgrabung gefunden worden war. Interessanterweise war dieser Effekt unabhängig von der
zuvor berichteten Religiosität. Im Übrigen gab es auch in der zweiten Studie einen geschlechtsspe-
zifischen Effekt: Männer waren gewalttätiger als Frauen. Es zeigte sich jedoch zusätzlich, dass die
Männer empfänglicher waren für die Sanktionierung von Gewalt durch Gott: Männer die zuvor
6Manfred Spitzer / Moral und Religiosität / Textarchiv: TA-2007-9
gelesen hatten, dass Gott die Gewalt angeordnet hatte, waren im nachfolgenden Experiment
gewalttätiger als Männer, welche die entsprechende Textpassage nicht gelesen hatten. Bei Frauen
gab es keinen entsprechenden Unterschied.
Die Studie zeigte also insgesamt, dass Gewalt in religiösen Schriften zu Gewalt in der realen Welt
führen kann. Der Effekt ist bei Männern ausgeprägter und von der religiösen Grundeinstellung
sowie vom Glauben an die Textquelle abhängig. Männer, die ohnehin deutlich gewalttätiger sind als
Frauen, sind zudem empfänglicher für die aggressionsfördernden Auswirkungen religiöser Texte.
„Männer, die deutlich gewalttätiger sind als Frauen, sind zudem empfänglicher für die ag-
gressionsfördernden Auswirkungen religiöser Texte."
Meine Großmutter mütterlicherseits war eine tief religiöse Frau. Sie ging jeden Sonntag in die Kir-
che und war sonntags nachmittags nicht gut drauf, wenn die Kinder (wieder einmal) nicht vollstän-
dig in der Kirche gewesen waren. Dann zog sie einen „Flunsch", wie wir ihren subdepressiven
Habitus mit Scheid'schem Schuldzeiger in Richtung der anderen damals psychiatrisch völlig unpro-
fessionell zu nennen pflegten. Als ich jedoch in der ersten Klasse war, ich erinnere mich noch sehr
genau, ging ich mit ihr eines Sonntags sogar in die Kirche der Nachbargemeinde auf einem nahe
gelegenen Berg. Das hat meine Großmutter sehr gefreut und sie wollte mir auf dem Nachhause-
weg dafür 2 Mark (bei 50 Pfennig Taschengeld im Monat - eine ungeheure Summe!) in die Hand
drücken. Ich lehnte zu ihrer großen Überraschung ab. Geld für einen Kirchgang: Nein, das ging
nicht.
In der dritten Klasse dann hatte ich noch ein Erlebnis mit der Kirche: Wie landesweit alle dritten
Klassen (das weiß ich heute), hatten wir Religionsunterricht beim Kaplan und nicht beim Lehrer,
denn es war die Zeit der Erstkommunion, und in dieser Zeit sollen die „Schäfchen gut behütet" (um
nicht zu sagen: professionell indoktriniert) werden. Der Kaplan warb um Messdiener. Wer sich zur
Verfügung stellte, konnte nicht nur mit einer Eins in Religion fest rechnen. Nein, er durfte auch ins
nahe gelegene Spielwarengeschäft gehen und sich für die monströse Summe von vier Mark und
fünfzig (vom Kaplan spendiert) ein Spielzeugauto aus Metall kaufen. Während des Unterrichts.
Wieder widerstand ich der Versuchung. „Bestechung zum Dienen in der Kirche?" - dachte ich da-
mals: Nein, das geht doch nicht!
Spätestens jetzt dürfte dem Leser klar sein, dass in meiner religiösen Erziehung trotz bester Ab-
sichten nicht alles (zumindest aus Sicht der Kirche) optimal gelaufen ist.
Dabei halte ich es keineswegs mit Richard Dawkins (6), der den Glauben an Gott ganz einfach mit
Wahn gleichsetzt. Warum, muss er sich fragen lassen, sind dann etwa 85 % der Weltbevölkerung
(21) wahnkrank (um nicht zu sagen: wahnsinnig)? Zwar ist es ein Ergebnis der empirischen For-
schung, dass sowohl Religiosität als auch Wahn mit dem Neurotransmitter Dopamin in Verbindung
stehen (20), aber weil alle Dinge sich bei Erwärmung ausdehnen, werden nicht unbedingt im Som-
mer die Tage länger! Wir wissen noch nicht sehr viel über menschliche Religiosität, trotz (oder
vielleicht gerade wegen) der unzähligen theologischen und religiösen Traktate und Schriften. Wa-
rum sind die Menschen religiös? Und vor allem: Wie gehen wir in Zukunft fruchtbringend damit um?
Als Beispiel sei hier Lessings Ringparabel (Abb. 2) angeführt (25). Nathan der Weise soll einem
muslimischen Herrscher die Frage beantworten, welche der drei monotheistischen Religionen (Ju-
dentum, Christentum und Islam) die Wahre sei. Er tut dies mit einem Gleichnis: Ein Mann hat drei
Söhne und einen Ring demjenigen zu vererben, den er am meisten liebt. Dieser Ring weist die
magische Eigenschaft auf, seinen Träger „vor Gott und den Menschen angenehm" zu machen.
Weil der Vater sich nicht entscheiden kann, welchem der drei Söhne er den Ring vererbt, lässt er
zwei Duplikate anfertigen und vererbt so jedem der Söhne einen Ring. Diese streiten sich bald
7Manfred Spitzer / Moral und Religiosität / Textarchiv: TA-2007-9
danach darum, wer den echten Ring besitzt. Der weise Richter will dies auch nicht entscheiden,
erinnert die Söhne aber daran, dass nur der echte Ring die Eigenschaft hat, seinen Träger bei den
Menschen beliebt zu machen; es zeige sich also am Verhalten der Söhne sowie der resultierenden
Beliebtheit, wer der Träger des echten Ringes ist. Aber wie schaffen wir das wirklich?
Abb. 2 Titelblatt des Erstdrucks von Lessings Nathan der
Weise aus dem Jahr 1779. Man kann dies unterschiedlich
interpretieren, die Ideen der Toleranz und der Messung der
Religion an ihren Wirkungen auf die Menschen stecken
jedoch unzweifelhaft in dieser genialen Geschichte aus der
Zeit der Aufklärung (25).
Schaut man sich den Konflikt zwischen dem Fundamentalisten George W. Bush (der Forschungs-
ergebnisse aus ideologischen Gründen unterdrücken oder gar fälschen lässt; 3,11-14,17,22) und
dem kriminellen Pragmatiker Saddam Hussein an, wird man skeptisch, was die Chancen der Lö-
sung dieses Problems aus der Religion heraus (welcher?) anbelangt.
Hand aufs Herz: Noch vor 20 Jahren galt der Atheist als verdächtig; was war mit diesem „gottlosen"
Menschen? Konnte man ihm trauen? Heute kehrt sich die Beweislast um: Dieser Mensch ist religi-
ös – könnte er deswegen gefährlich sein? Kann man ihm trauen? – Ich persönlich bedauere diese
Entwicklung sehr.
Wirklich hoffen kann man in dieser Situation im Grunde nur auf die – ja, ich meine das ganz ernst! –
Wissenschaft. Wer sich auf sie einlässt, der hat sich schon auf Kommunikation und gemeinsame
Standards für die Findung der Wahrheit eingelassen, also unser Streben nach dem Wahren, Schö-
nen und Guten im Grunde schon unterschrieben. Wissenschaft ist so betrachtet das Produkt und
die Weiterführung der Gedanken der Aufklärung: Es geht darum, sich nicht auf Autoritäten (Bücher,
Ärzte, Seelsorger und man könnte ergänzen: Gurus, Trainer, Psychotherapeuten oder Meditati-
onsmeister), sondern auf seinen eigenen Verstand zu beziehen, wenn es um Erkenntnis geht. Am
schönsten hat dies Immanuel Kant (1784) formuliert (Abb. 3), von dem auch der Satz stammt (24):
„Die Maxime, jederzeit selbst zu denken, ist die Aufklärung".
In kultureller Hinsicht leisten Erziehung, Bildung (zum selbstständigen Gebrauch des eigenen Ver-
standes) und die Verbreitung von Wissenschaft viel mehr als nur die Voraussetzungen für unsere
moderne, durch Technik (das heißt, die Früchte des wissenschaftlichen Fortschritts) geprägte Ge-
sellschaft. Es gibt (und das haben gerade die entsprechenden Versuche überdeutlich gezeigt)
8Manfred Spitzer / Moral und Religiosität / Textarchiv: TA-2007-9
keine kommunistische oder islamistische Wissenschaft im Gegensatz zur westlichen. Vielmehr sind
die Standards und die Methoden (und damit die Ergebnisse) unabhängig vom herrschenden Zeit-
geist – allen Relativisten zum Trotz. Genau deswegen gelten die Erkenntnisse des wissenschaftlich
vorgehenden kritischen Verstandes ja auch auf dem Mars oder dem Jupitermond Titan ebenso wie
bei uns! Wenn wir überhaupt eine Chance auf verbindliche „Weltkultur" haben sowie darauf, uns
irgendwann einmal vielleicht sogar über gute/förderliche und schlechte/destruktive Aspekte von
Religion zu verständigen (Mutter Teresa ja, Bomben nein), dann - das ist meine feste Überzeugung
- nur deswegen, weil es dazu eine gemeinsame Basis in der Wissenschaft gibt. Man könnte dann
unter anderem prüfen, welche Effekte die Bahnung mit Sätzen aus der Bergpredigt bei Gläubigen
(verschiedener Religionen) und Ungläubigen hat.
Abb. 3 Beginn des Beitrags „Was ist Aufklärung", der als
Reaktion auf die 1783 in der Berlinischen Monatsschrift publi-
zierte entsprechende Frage des Pfarrers Johann Friedrich
Zöllner ein Jahr später in der gleichen Zeitschrift erschien.
Das Faksimile entstammt der ersten Buchausgabe des Bei-
trags von 1799 (24).
Ich danke meinen Mitarbeitern und Freunden, den Herren Dr. Thomas Kammer, Dr. Manfred Neu-
mann und Dr. Carlos Schönfeldt sowie Frau Claudia Lorenz für Kommentare und Kritik. Warum ich
meine persönlichen Erfahrungen berichte? Macht das meinen Standpunkt nicht schwächer? - Na-
türlich ja, und genau das ist der Punkt: Wenn es um Religion geht, hat jeder seine Erfahrungen;
und es sind letztlich diese, die unsere Meinungen prägen.
Literatur
(1) Allport GW, Ross JM. Personal religious orientation and prejudice. Journal of Personality and
Social Psychology 1967; 5(4): 432-443.
(2) Annis LV Emergency helping and religious behavior. Psychological Reports 1976; 39:151-158.
(3) Baltimore D. Science and the Bush administration. Science 2004; 305:1873.
(4) Bushman BJ, Ridge RD, Das E, Key CW, Busath GL. When God sanetions killing. Effect of
scriptural violence on aggression. Psychological Science 2007; 18:204-207.
9Manfred Spitzer / Moral und Religiosität / Textarchiv: TA-2007-9
(5) Cline VB, Richards JM. A factor-analytic study of religious belief and behavior. Journal of Per-
sonality and Social Psychology 1965; 1(6): 569-578.
(6) Dawkins R. The God Delusion. London: Bantam Press 2006.
(7) Friedrichs RW. Alter versus ego: An exploratory assessment of altruism. American Sociological
Review 1960; 25:496-508.
(8) Georgianna S. Is a religious neighbor a good neighbor? Humboldt Journal of Social Relations
1984; 11(2): 1-16.
(9) Glock CY, Ringer BB, Babbie ER. To comfort and to challenge: A dilemma of the contempo-
rary church. Berkeley: University of California Press 1967.
(10) Juergensmeyer M. Terror in the mind of God: The global rise of religious violence (3rt ed).
Berkeley, CA: University of California Press 2003.
(11) Horgan J. Dark days at the White House. Nature 2007;445:365-366
(12) Kennedy D. Science, information, and power. Science 2007; 315:1053.
(13) Lawler A, Kaiser J. Report aecuses Bush administration, again, of .poüticizing' science. Sci-
ence 2004; 305: 323-324
(14) Mooney C. The Republican War on Science. New York: Basic Books 2005.
(15) Nepstad SE. Religion, violence, and peacemaking. Journal for the Scientific Study of Religion
2004; 43: 297-301.
(16) Oliner SP, Oliner PM. The altruistic personality. New York: Free Press 1988.
(17) Shulman S. Undermining Science: Suppression and Distortion in the Bush Administration.
Berkeley: University of California Press 2007.
(18) Slimak MW, Dietz T. Personal values, beliefs, and ecological risk perception. Risk Analysis
2006; 26:1689-1705.
(19) Smith RE, Wheeler G, Diener E. Faith without works: Jesus People, resistance to temptation,
and altruism. Journal of Applied Social Psychology 1975; 5(4): 320-330.
(20) Spitzer M. Das Gott-Gen. Nervenheilkunde 2005; 24:457-462.
(21) Spitzer M. Neurotheologie? Nervenheilkunde 2006; 25:761-765.
(22) Stokstad E. Appointee .reshaped' science, says report. Science 2007; 316: 37.
(23) Kohlberg L. Die Psychologie der Moralentwicklung. Frankfurt: Suhrkamp 1996.
(24) Kant I. Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung? Berlinische Monatsschrift 1784; 4: 481-
494.
(25) Lessing GE. Nathan der Weise. Ein dramatisches Gedicht, in fünf Aufzügen. 1779.
(26) Spitzer M. Modelle für die Forschung. Nervenheilkunde 2007; 26: 615-617.
_______________________________________________
Zuerst veröffentlicht in: Nervenheilkunde 2007; 26: 545-552
10Sie können auch lesen