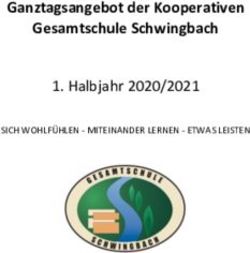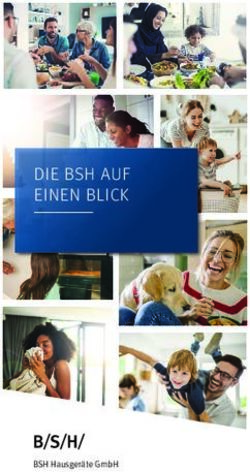NW+ Gymnasium Kirchenfeld 2021/22
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
März 2021 Schulleitung NW+ Gymnasium Kirchenfeld 2021/22
Wahlpflichtfach NW+
Informationen / Anleitung zum Anmeldeverfahren
Liebe Schülerinnen und Schüler der GYM2
Die Antwort der Erziehungsdirektion des Kantons Bern auf den Klimawandel heisst BNE: Bildung zur
nachhaltigen Entwicklung (der Erde). Eine der Umsetzungen von BNE an unserer Schule ist das
Wahlpflichtfach NW+. Ihr Jahrgang ist der zweite, welcher in den Genuss des neuen Kursangebots
aus den Bereichen Naturwissenschaften und BNE kommt.
NW+! Sie erhalten während eines Semesters die Gelegenheit, sich intensiv und interdisziplinär mit
einem relevanten und topaktuellen Thema auseinanderzusetzen.
Allgemeine Informationen
− Das Fach NW+ besteht aus 9 verschiedenen, voneinander unabhängigen Semesterkursen. Die
Kurse sind auf unserer Homepage unter Intern / Dokumente / myGymer-Angebote ausführlich
beschrieben. Weitere Auskunft erhalten Sie von der jeweiligen Kursleitung (vgl. Rückseite).
− Die Kurse richten sich an zukünftige Schüler*innen GYM3 aller Abteilungen und werden
abteilungsübergreifend geführt.
− NW+ ist obligatorischer Unterricht: der besuchte Kurs wird im Portfolio ausgewiesen, aber nicht
benotet.
− Kurse 07 / 08 sind nicht für Schüler*innen mit SF BC.
Durchführung und Besuch
− Jede*r Schüler*in belegt einen Semesterkurs von zwei Wochenlektionen. Die Zuteilung erfolgt
gemäss Ihrer Wahl, ein Kurswechsel ist nach der Zuteilung nur auf gut begründetes Gesuch
möglich.
− Ihr Kurs findet im Verlauf der beiden Semester GYM3 statt (im Ausnahmefall im ersten Semester
GYM4). Die Zuteilung wird von der Schulleitung vorgenommen.
Anmeldung: Was Sie tun müssen
1. Sie melden sich online auf der Intern-Seite unter myGymer-Angebote an und bestätigen Ihre Wahl
per Mausklick.
2. Sie wählen drei (3) Kurse, welche Sie interessieren. Die zwei ersten sind gleichwertige erste Wahl.
3. Sie bestätigen die Wahl von NW+ und Fakultativkursen.
Danke, dass Sie den Termin einhalten!
Das Zeitfenster ist offen ab sofort bis Mittwoch, 7. April 2021, 12.00 Uhr
Im Namen der Schulleitung und der Lehrerschaft wünsche ich Ihnen spannende, interessante und
lehrreiche Lektionen in Ihrem NW+-Kurs.
Freundliche Grüsse
André Lorenzetti, Rektor
2Kursverzeichnis NW+
01 Wasser – das flüssige Gold ................................................................................................................ 4
02 Don’t throw it away. There is no «away» ............................................................................................ 5
03 Wenn jede/r so mobil wäre… Wir untersuchen und hinterfragen unsere Mobilität ............................ 6
04 Erdöl – das schwarze Gold................................................................................................................. 7
05 Können wir die Welt retten? ............................................................................................................... 8
07 Blutkrankheiten: Symptome – Diagnose - Therapie ........................................................................... 9
08 Mikrobiologie – praktisches Arbeiten mit Bakterien und Hefen ........................................................ 10
12 Biodiversitätskrise - Artenvielfalt in Gefahr? ......................................................................................11
13 Simulationen: Computerbasierte Modellierung in der Wissenschaft ................................................ 12
3Titel: 01 Wasser – das flüssige Gold
Verantwortliche: zar
Bedeutung für die Die Sustainable Development Goals (SDGs) sollen bis 2030 global und von
nachhaltige Entwicklung: allen UNO-Mitgliedstaaten erreicht werden. Ziel 6 der SDGs will die
Verfügbarkeit und nachhaltige Bewirtschaftung von Wasser und
Sanitärversorgung für alle gewährleisten. Der Zugang zu Trinkwasser und
sanitären Einrichtungen ist ein Menschenrecht und zusammen mit der
Ressource Wasser ein entscheidender Faktor für alle Aspekte der sozialen,
wirtschaftlichen und ökologischen Entwicklung.
Besonderheiten Ausgehend von den aktuellen und zukünftigen globalen und lokalen
des Projektes? Wasserproblemen suchen wir nach den nötigen Schritten, um nachhaltige
Wassersysteme aufzubauen.
Zielpublikum: Schülerinnen und Schüler, die Interesse an natur- und sozialgeografischen
Themen und Freude an vernetztem Denken haben.
Relevanz Vertiefung in Studienbereiche Geografie / Nachhaltige Entwicklung / Ökologie
Bildungslandschaft: Stärkung der individuellen Allgemeinbildung
Brückenfunktion zwischen Natur- und Sozialwissenschaften
Kurzbeschrieb: Inhalte:
▪ Wasserkrise: Wir lernen verschiedene Aspekte der gegenwärtigen und
zukünftigen Wasserprobleme auf lokaler und globaler Ebene kennen
(Zugang zu Wasser, Wasserverschmutzung, Wassermangel etc.).
▪ Wasser und Macht: Wir denken uns in Konflikte um Wasser hinein
(Fallbeispiele).
▪ Wir entwickeln und diskutieren Massnahmen zur Reduzierung der
Verwundbarkeit gegenüber wasserbezogenen Katastrophen.
Methoden:
▪ Wir eignen uns Fachwissen an.
▪ Wir lernen auf Kurzexkursionen Wasserthemen in unserer Umgebung
kennen.
▪ Wir beschaffen uns selbstständig Informationen und werten diese aus.
▪ Wir vertiefen uns individuell.
▪ Wir entwickeln Vorschläge, wie Forschung, Politik und Wirtschaft
gemeinsam handeln können und präsentieren diese in geeigneter Form.
Produkte: Frei wählbar. Zum Beispiel: Vorträge, Poster, Kurzfilme, etc.
4Titel: 02 Don’t throw it away. There is no «away»
Verantwortliche: def
Bedeutung für die In einer Zeit, in der die globale Entwicklung und unser Wohlstand immer
nachhaltige Entwicklung: stärkere Auswirkungen auf alle Ökosysteme zeigen, rücken ein nachhaltiger
Umgang mit unseren Ressourcen und ein Verständnis für Stoffkreisläufe
vermehrt in den Fokus.
Besonderheiten Wir denken auf allen Skalen und handeln im lokalen Lebensumfeld.
des Projektes?
Zielpublikum: Das Angebot richtet sich an alle, die sich aktiv mit unserem Umgang mit
Ressourcen auseinandersetzen wollen – und das nicht nur unter
ideologischen, sondern auch unter wissenschaftlichen Gesichtspunkten.
Relevanz In kooperativer Weise arbeiten wir an der Methoden- und Kommunikations-
Bildungslandschaft: kompetenz. Der Kurs sieht sich als Beitrag zur Bildung für eine nachhaltige
Entwicklung.
Kurzbeschrieb: Inhalte:
▪ Wir verschaffen uns einen Überblick über die Abfallsituation in allen
Sphären des Systems Erde und auf allen Skalen: lokal (das Gymnasium),
regional (die Stadt), national (die Schweiz), global (der Planet).
▪ Wir beschreiben und beurteilen Lösungsansätze auf chemischer,
ökologischer und ethischer Ebene. Dabei analysieren wir unterschiedliche
Strategien: die Vermeidung, den Abbau, das Recycling.
▪ Wir erkennen wichtige Schritte zur wissenschaftlichen Bearbeitung einer
Fragestellung.
▪ Wir schärfen unseren Blick für Probleme im Zusammenhang mit Abfall auf
unterschiedlichen räumlichen und gesellschaftlichen Grössenebenen.
▪ Wir arbeiten an unseren kommunikativen und medialen Kompetenzen.
▪ Wir räumen auf.
Methoden:
▪ Wir formulieren die Problemstellung.
▪ Wir erstellen ein Forschungsdesign.
▪ Wir führen eine Feldstudie auf lokaler Ebene durch und sammeln Daten.
▪ Wir stellen gesammelte Daten dar, analysieren die Daten und leiten
Handlungsempfehlungen ab.
▪ Wir präsentieren unsere Ergebnisse und Erkenntnisse.
▪ Wir reflektieren den Arbeitsprozess und den Lernweg.
Produkte: Datensammlung zur Abfallproblematik.
Schriftliche Formulierung von Handlungsempfehlungen im Zusammenhang
mit der Vermeidung von Abfällen bzw. dem Umgang mit ihnen.
Kommunikation der Recherche- und Forschungsergebnisse.
5Titel: 03 Wenn jede/r so mobil wäre… Wir untersuchen und
hinterfragen unsere Mobilität
Verantwortlich: ach
Bedeutung für die Unsere Mobilität ist ein Schlüsselfaktor in der nachhaltigen Entwicklung.
nachhaltige Das zunehmende Verkehrsaufkommen führt zu Zielkonflikten in verschiedenen
Entwicklung: Bereichen. In diesem Projekt entwerfen wir Ideen für ein nachhaltigeres
Verkehrsverhalten.
Besonderheiten Wir führen eine Verkehrszählung durch, untersuchen die Auswirkungen unserer
des Projektes: alltäglichen Fortbewegung, suchen nach Alternativen, befragen Personen über
ihre Bereitschaft, den Verkehr nachhaltiger zu gestalten, entwerfen Ideen für die
Mobilität der Zukunft und besuchen bernmobil.
Zielpublikum: Schülerinnen und Schüler, die sich mit der eigenen Mobilität auseinandersetzen,
diese mit anderen vergleichen und daraus Vorschläge für ein innovatives,
nachhaltigeres Verkehrsverhalten ableiten wollen.
Relevanz für die Förderung der Teamarbeit in einer kleinen Forschungsgruppe
persönliche Kritische Analyse der persönlichen Verhaltensmuster
Ausbildung: Steigerung des Problem- und Umweltbewusstseins
Vertiefung in Studienbereiche Nachhaltige Entwicklung / Geografie /
Verkehrsplanung / Ökologie
Kurzbeschrieb: Inhalte:
▪ Wir analysieren die Entwicklung der Mobilität und des Raumbedarfs für
Verkehrsinfrastrukturen in der Schweiz in den letzten Jahrzehnten
▪ Wir erfassen die persönliche Mobilität mit einer App, analysieren sie,
vergleichen sie mit anderen Personen des Gymnasiums und mit dem
Durchschnitt der Schweizer Bevölkerung
▪ Wir analysieren Daten aus dem öffentlichen Verkehr (bernmobil):
Woher kommen unsere Schülerinnen und Schüler? Welche Bus- und
Tramlinien benutzen sie? Wann und wo ist das grösste Verkehrsaufkommen
in der Stadt? Kann es beeinflusst werden?
▪ Wir sprechen mit Verkehrsteilnehmenden über ihre Bedürfnisse und ihre
Bereitschaft zu mehr Nachhaltigkeit im Alltagsverkehr
Methoden:
▪ Wir eignen uns Fachwissen zur Mobilität an: In welchen Bereichen entstehen
durch den Verkehr Zielkonflikte und wie werden sie angegangen?
▪ Wir widmen uns aktuellen Verkehrsfragen, entwerfen Hypothesen, planen
eine Messkampagne zu Mobilitätsthemen und führen diese Erhebung in der
Agglomeration Bern durch
▪ Wir werten unsere Erhebung aus, visualisieren sie (z. B. mit Grafiken,
Kurzfilmen, Interviews) und diskutieren sie mit Verkehrsexperten
▪ Wir analysieren Zielkonflikte, die durch den Verkehr entstehen, und
entwerfen Visionen und Lösungsansätze für ein nachhaltigeres
Verkehrsverhalten, auch für unsere Schule
▪ Wir besuchen bernmobil, blicken in die Fahrplangestaltung und erfahren und
erleben Neues aus dem Projekt «Selbstfahrende Busse» in Bern
Produkte: Vorträge und Expertenrunden, Auswertung von Resultaten aus einer
Messkampagne, Präsentation von Ergebnissen und Lösungsansätzen in
verschiedenen Formen (Folien, Plakate, Audio, Video...)
6Titel: 04 Erdöl – das schwarze Gold
Verantwortlicher: txf
Bedeutung für die Das Erdöl ist gleichsam Wirtschaftsmotor und Machtfaktor. Kann die Ressource
nachhaltige Erdöl nachhaltig sein, wenn sie beim Verbrennen zum Klimawandel beiträgt und
Entwicklung: bei der Produktion die Umwelt schädigt und häufig Menschenrechte verletzt?
Gibt es Alternativen zum fossilen Energieträger Erdöl, die mehr zu einer
nachhaltigen Entwicklung beitragen?
Besonderheiten Wir analysieren die Auswirkungen der Ressource Erdöl auf die Gesellschaft und
des Projektes? die Umwelt früher und heute. Besonders im Fokus stehen die geopolitischen
Aspekte, welche den Erdölmarkt massgeblich beeinflussen.
Zielpublikum: Schülerinnen und Schüler, die Interesse an natur- und sozialgeografischen
Themen haben und in einer immer komplizierteren Welt gerne vernetzt denken.
Relevanz Vertiefung in Studienbereiche Nachhaltige Entwicklung / Geografie / Soziologie
Bildungslandschaft: Stärkung der individuellen Allgemeinbildung
Aneignung überfachlicher Kompetenzen
Überdenken des eigenen Lebensstils
Kurzbeschrieb: Inhalte:
▪ Wir klären die Erdölentstehung, -gewinnung und die Versorgung der
Kunden
▪ Wie verfolgen den Weg des Erdöls von der Quelle zum Endverbraucher
▪ Wir analysieren, wie der Erdölrausch Europa erfasst hat
▪ Wir lernen die Interessen der verschiedenen Player auf dem Erdölmarkt
kennen
▪ Wir wollen die geopolitischen Dimensionen des Erdöls verstehen
▪ Wir entwickeln Szenarien für eine Gesellschaft nach dem Erdölzeitalter
▪ Wir diskutieren die Schweizer Energiestrategie 2050
Methoden:
▪ Wir lesen ein Buch zu den historischen Aspekten des Erdölzeitalters
▪ Wir suchen im Netz zusätzliche Informationen zu den Buchthemen
▪ Wir tauschen die erarbeiteten Informationen in Kurzpräsentationen im
Seminarstil aus
▪ Wir festigen den Wissenszuwachs
▪ Wir lassen wöchentlich die Aktualität im Zusammenhang mit dem Erdöl
einfliessen
▪ Wir schauen und diskutieren Filme
Produkte: Vorträge im Seminarstil, Handouts, Poster, Power Point, Broschüre (variabel)
7Titel: 05 Können wir die Welt retten?
Verantwortlicher: rrt
Bedeutung für die In diesem Kurs erhalten Sie Einblicke in diverse Themen im Bereich
nachhaltige Entwicklung: Wirtschaft, Politik, Gesellschaft und Wissenschaft in Bezug auf eine
nachhaltige Entwicklung.
Besonderheiten Wir fragen uns, was wir selber, die Gesellschaft, die Wirtschaft und die Politik
des Projektes? zur “Rettung der Welt” beitragen können.
Zielpublikum: Ihnen liegt viel an unserer Welt und Sie haben ein breites Interesse in Bezug
auf Nachhaltigkeit.
Relevanz
Bildungslandschaft: Studienbereiche Geografie / Technik / Wirtschaft / Politik / Ethik
Persönliche Allgemeinbildung
Kurzbeschrieb: Inhalte:
▪ Wir gehen auf Nachhaltigkeit in diversen Themenbereichen ein.
Ausserdem gehen Sie einer konkreten Fragestellung nach und
präsentieren Ihre Ergebnisse der Gruppe.
▪ Mögliche Themen/ Fragestellungen:
▪ Wie kann umweltschonend Strom produziert / gespeichert werden?
▪ Was beinhaltet die Agenda 2030 der UNO?
▪ Energiestrategie 2050 der Schweiz/ Netto 0 CO2
▪ Was beinhaltet das neue CO2 -Gesetz der Schweiz?
▪ Um was geht es im Pariser Klimaabkommen?
▪ Sind Elektroautos wirklich umweltfreundlicher als Verbrenner?
▪ Wie kann man Abfall vermeiden?
▪ Plastikrecycling? Bioplastik?
▪ Wie kann man nachhaltig (Nahrungsmittel) produzieren?
▪ Welche Folgen hat der Klimawandel?
▪ Ungleichheiten/ Gleichberechtigung
▪ Zubetonierung der Schweiz
▪ Überbevölkerung
▪ Umgang mit Flüchtlingen
▪ Zunahme der Mobilität/ Ressourcenverbrauch
▪ Was bringen Klimademos?
▪ Foodwaste
▪ Energie sparen/ CO2 einsparen im Alltag
▪ Biodiversitätsverlust
▪ Sie werden einen anonymen Fragebogen zu Ihrem Ressourcenverbrauch
/ CO2-Emissionen ausfüllen und die Ergebnisse mit der Gruppe
vergleichen.
Methoden:
▪ Plenumsunterricht, Diskussionsrunden
▪ aktuelle Artikel, Videosequenzen
▪ SOL, Vorträge
▪ Lesen einer Maturaarbeit
▪ anonyme Umfrage
Produkte: Handlungsmöglichkeiten, die zur “Rettung der Welt” beitragen / Vorträge
8Titel: 07 Blutkrankheiten: Symptome – Diagnose - Therapie
Verantwortliche: guu
Bedeutung für die Die kritische Auseinandersetzung der Hightech-Medizin und deren
nachhaltige Entwicklung: ökologischen beziehungsweise ökonomischen Auswirkungen
Besonderheiten Wichtige diagnostische Methoden kennenlernen und praktisches Arbeiten.
des Projektes? Anhand von Fallbeispielen methodische und fachliche Vorbereitung auf ein
medizinisches Studium.
Zielpublikum: Schülerinnen und Schüler, die Interesse an naturwissenschaftlichen und
medizinischen Themen haben und die nicht das SF BC besuchen.
Relevanz Studienbereich der MINT-Fächer
Bildungslandschaft:
Kurzbeschrieb:
Inhalte:
▪ In einer ersten Phase werden wir Blutkrankheiten (z.B. Hämophilie,
Anämie, Leukämie) von Lerngruppen à 5-8 SchülerInnen nach der
PBL-Methode bearbeiten (Analyse eines Fallbeispiels – Lernziele
formulieren – Recherche – Synthese).
▪ Es folgen die Praktika im Schulhaus, Besuche externer Institutionen
und Inputreferate von Lehrkräften resp. externer Fachleute.
▪ In der dritten Phase werden wir das Wissen vertiefen und stellen
die Ergebnisse einander in geeigneter Form (PP-Präsentationen,
Postersessions) vor.
Methode:
▪ Wir lernen Methoden zur Blutuntersuchung praktisch kennen und
halten uns an die naturwissenschaftliche Vorgehensweise.
▪ Wir führen ein Journal, das unsere Lern- und Arbeitsprozesse
dokumentiert (Inputinformationen, eigene Rechercheergebnisse,
praktische Arbeiten).
Produkte: Vorträge mit Handout, PowerPoint-Präsentationen und/oder Postersessions
9Titel: 08 Mikrobiologie – praktisches Arbeiten mit Bakterien und
Hefen
Verantwortliche: LP Fachschaft B (nnd)
Bedeutung für die Mikroorganismen werden heute genutzt, um aus Abfall Biogas zu erzeugen
nachhaltige Entwicklung: und um CO2-neutrale Kraftstoffe zu produzieren. Auch werden
Mikroorganismen heute immer erfolgreicher eingesetzt um von uns
angerichtete Schäden an der Natur, wie zum Beispiel Verschmutzungen mit
Öl oder anderen Schadstoffen, wieder zu beheben.
Besonderheiten Dieser Kurs bietet Möglichkeiten eigene Forschungsfragen zu stellen und
des Projektes? diese mittels praktischer Arbeit im Labor zu beantworten.
Zielpublikum: Das Angebot richtet sich an Schülerinnen und Schüler aller Abteilungen, die
ein tieferes Verständnis der biologischen Zusammenhänge in unserer Welt
erlangen wollen. Schüler*innen mit Schwerpunktfach BC dürfen dieses
Modul nicht wählen (Grosse Überschneidung mit dem SF-Stoff).
Vertiefung in Studienbereich der Naturwissenschaften und Medizin
Relevanz
Stärkung der individuellen Allgemeinbildung
Bildungslandschaft:
Kurzbeschrieb: Inhalte:
▪ Vielfältige praktische Laborarbeiten mit Bakterien und Hefezellen.
▪ Selbständige Erarbeitung der theoretischen Hintergründe
verschiedener Einsatzgebiete von Mikroorganismen.
▪ Umsetzung des theoretischen Wissens in eigenen praktischen
Forschungsprojekten.
▪ Einblick in mikrobiologische Anwendungen in Wirtschaft, Medizin
und Gesellschaft.
Methoden:
▪ Wir erlernen mikrobiologische Labormethoden (steriles Arbeiten,
Kultivierung und Charakterisierung verschiedener
Bakterienstämme, Färbemethoden, gentechnische Veränderung
von Mikroorgansimen).
▪ Wir setzen Mikroorganismen zur Analyse von Stoffen auf ihre
antibiotische oder krebserregende Wirkung ein.
▪ Wir erarbeiten theoretische Grundlagen zu aktuellen Anwendungen
(z.B. Herstellung genetisch veränderter Mikroorganismen) und
Problemen (z.B. Antibiotikaresistenzen) der Mikrobiologie.
▪ Wir besuchen nach Möglichkeit ausgewählte Institutionen wie z.B.
einen Betrieb der Nahrungsmittelindustrie (z.B. Bierbrauerei,
Molkereibetrieb).
▪ Wir planen eigene Forschungsprojekte, führen Experimente durch und
lernen diese wissenschaftlich korrekt auszuwerten.
Produkte: Die Miniprojekte und der dazu notwendige theoretische Hintergrund werden
in geeigneter Form (PP-Präsentation, Poster Session) den anderen Gruppen
vorgestellt.
10Titel: 12 Biodiversitätskrise - Vielfalt in Gefahr?
Verantwortliche: szd
Bedeutung für die Biologische Vielfalt ist eine Grundlage menschlichen Lebens.
nachhaltige Entwicklung:
Der Erhalt der Artenvielfalt, der genetischen Vielfalt und der Vielfalt der
Ökosysteme steht in verschiedenster Weise im Interesse der Menschheit.
Die im Zusammenhang mit der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung
definierten «Sustainable Development Goals» der UNO umfassen auch Ziele
mit Bezug zur Biodiversität. Konkret geht es um den Erhalt und die
nachhaltige Nutzung allen Lebens im Wasser (Ziel 14) und an Land (Ziel 15).
Besonderheiten Durch das Aufzeigen von Ursachen und Folgen wird vernetztes Denken
des Projektes? gefördert. Neben theoretischen Grundlagen zum Thema erhalten die
Schüler*innen auch Einblick in die praktische Feldarbeit.
Zielpublikum: Schüler*innen mit Interesse an Fragen rund um Sorten-, Arten- und
Lebensraumschutz, Freude an der Arbeit am PC und/oder im Freien.
Relevanz
▪ Einsicht in die aktuelle Forschung rund um Biodiversität
Bildungslandschaft:
▪ Sammeln von praktischen Erfahrungen mit wissenschaftlichen Methoden
▪ Studienbereich Umweltwissenschaften, Biologie (Conservation Biology,
Ökologie)
Kurzbeschrieb: Inhalte:
Grundlagen
▪ Bedeutung der biologischen Vielfalt
▪ Methoden zur Bestimmung der Diversität auf verschiedenen Ebenen
▪ Biodiversität im Verlaufe der Erdgeschichte
▪ Biologische Vielfalt in Kulturlandschaften, Naturlandschaften und im
urbanen Raum
Gefährdung der Biodiversität
▪ Zerstörung von Lebensraum, eingeführte Arten, Übernutzung,
Unterbrechung von Nahrungsketten, Zersiedelung
▪ Klimawandel und biologische Vielfalt
▪ Konsum und biologische Vielfalt
▪ Wilderei und Handel mit Produkten von vom Aussterben bedrohter Arten
Handlungsperspektiven:
▪ Erhaltungskonzepte und Strategien
▪ Naturschutz und Renaturierung (Projekte zur Artenförderung)
▪ Ökologischer Ausgleich (nachhaltige Landnutzungsverfahren)
Methode:
▪ Simulationen/Berechnungen am PC
▪ Diskussion von aktuellen Artikeln zum Thema
▪ Recherche und/oder Expertengespräche zu aktuellen regionalen
und nationalen Projekten
▪ Filmanalyse: z.B. Seed Warrior, Racing Extinction
▪ Botanische und/oder faunistische Exkursion
▪ Praktische Feldarbeit (Mini-Projekte)
Produkte: Die Schüler*innen erarbeiten Handlungsperspektiven zum Erhalt der
Biodiversität.
Präsentation der Mini-Projekte, z.B. mittels Poster.
11Titel: 13 Simulationen: Computerbasierte Modellierung in der
Wissenschaft
Verantwortliche: ros / nar
Bedeutung für die Dank computerbasierten Simulationen kann heute das Verhalten komplexer
nachhaltige Entwicklung: Systeme immer besser vorausgesagt werden (z.B. Klimamodelle,
Ausbreitung eines Virus). So können problematische Entwicklungen
frühzeitig erkannt werden. Ausserdem können Simulationen Versuche
ersetzen (z.B. Medikamente) und so die natürliche Umwelt schonen.
Besonderheiten Der Computer ist das Labor: Wir lernen die Simulation am Computer als
des Projektes? wissenschaftliche Methode kennen. Wir untersuchen Modelle aus der
Biologie mit Hilfe von Simulationssoftware.
Zielpublikum: Schüler*innen mit Interesse an den Naturwissenschaften (insbesondere an
der Biologie), die Freude am Experimentieren und an der Arbeit am
Computer mitbringen.
Relevanz Computerbasierte Modelle und Simulationen erhalten eine immer wichtigere
Bildungslandschaft: Bedeutung in der wissenschaftlichen Forschung.
Kurzbeschrieb: Inhalte:
▪ verschiedene Typen von Computersimulationen (dynamische
Systeme, gitterbasierte Modelle, Multi-Agenten-Systeme)
kennenlernen
▪ Räuber-Beute-Modelle (Lotka-Volterra)
▪ Epidemie-Modelle
▪ Populationsgenetik
Methode:
▪ Wir lernen verschiedene Simulationssoftware kennen.
▪ Wir entwerfen Modelle und setzen diese in Simulationen um.
▪ Wir experimentieren mit Simulationsparametern.
▪ Wir analysieren die Simulationsergebnisse und vergleichen diese mit
wissenschaftlichen Erkenntnissen.
▪ Wir diskutieren über die Aussagekraft von Simulationen.
Produkte: Erstellen eines eigenen Modells oder einer eigenen Simulation und deren
anschliessende Präsentation.
12Sie können auch lesen