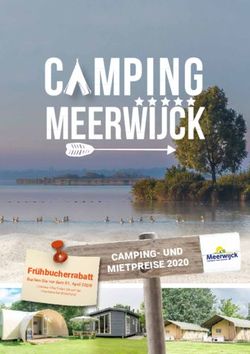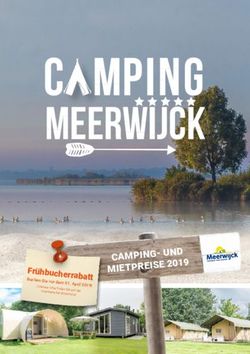Physik im Strandkorb James Trefil - Leseprobe aus
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Leseprobe aus:
James Trefil
Physik im Strandkorb
Copyright © 2008 by Rowohlt Verlag GmbH, ReinbekEinleitung
Die Physik verleiht uns nicht nur die Fähigkeit, das Verhalten aller
möglichen Gegenstände zu beschreiben und vorherzusagen –
von Galaxien bis zu Elektronen –, sie verhilft uns auch zu einer
einzigartigen Sicht auf die Welt. Der Kern dieser besonderen
Sichtweise ist der Begriff des Naturgesetzes. Der Physiker ver-
sucht stets, die grundlegenden Gesetzmäßigkeiten zu finden, die
für das jeweilige Untersuchungsgebiet gelten. Isaac Newton zum
Beispiel fasste im Jahr 1687 die Prinzipien der Mechanik (der
Zweig der Wissenschaft, der sich mit der Bewegung materieller
Systeme beschäftigt) in drei Bewegungsgesetzen zusammen.
Alles, was mit Bewegung zu tun hat – von den Planetenbahnen bis
zum Fall eines Apfels –, ist in diesen drei einfachen Gesetzen ent-
halten. Im 19. Jahrhundert wurden zwei weitere Naturbereiche
auf entsprechende Weise erklärt: zum einen die Wärme (durch
drei Gesetze der Thermodynamik), zum anderen Elektrizität und
Magnetismus (durch vier «Maxwell’sche Gleichungen» ge-
nannte Gesetze). Im 20. Jahrhundert wurden dieser Liste die
Gravitation (ein allgemeines Prinzip der Relativität) und die
Quantenmechanik (vier oder fünf grundlegende Postulate, je
nachdem, auf welcher Seite man bei den aktuellen Debatten
steht) hinzugefügt.
Die Lehre aus diesen Entwicklungen ist: Wenn alles, was in der
Welt geschieht, in das System einiger weniger Naturgesetze ge-
fasst werden kann, dann müssen viele anscheinend verschiedene
Erscheinungen miteinander in Beziehung stehen. Und tatsächlich
ist die Welt, so wie die Physiker sie sehen, wie ein großes, in sich
zusammenhängendes Netzwerk. Angefangen bei dem, was unse-
ren Sinnen unmittelbar zugänglich ist, wird dieses Netzwerk, je
weiter wir es verfolgen, immer enger, bis schließlich jeder Faden
Einleitung 7an einem der oben genannten großen physikalischen Prinzipien endet. Aus dieser Sicht auf die Natur kann eine wichtige Folgerung ge- zogen werden. Wenn jede Erscheinung, der wir begegnen, uns am Ende zu einem der allgemeinen Gesetze führt, dann ist es gleichgültig, wo wir beginnen. Alles kann als Ausgangspunkt für eine Erkundung der materiellen Welt dienen. Man braucht nicht in einem Labor zu beginnen, da eigentlich die ganze Welt ein einziges Physiklabor ist. Diese Wahrheit ist so wichtig, dass sich dieses Buch ausschließlich der Erkundung eines einzigen Ortes widmet, um daraus Anhaltspunkte über die grundlegende Be- schaffenheit des Universums zu gewinnen: des Strandes. Ebbe und Flut, so werden wir erkennen, hängen damit zusam- men, dass niemand von der Erdoberfläche aus die Rückseite des Mondes sehen kann. Die Gezeiten sind mit der Suche nach neuen Planeten im Sonnensystem verknüpft – einer Suche, die auch heute noch nicht abgeschlossen ist. Wellen und Brandung sind mit neuen Kommunikationstechnologien und mit der Er- forschung des früheren Erdklimas verbunden. Etwas so Kurzlebi- ges und Belangloses wie eine Blase in der Schaumkrone einer Welle veranlasst uns, die Kräfte zu betrachten, die einen Atom- kern zusammenhalten. Selbst ein gewöhnliches Segelboot kann uns etwas erzählen und lehren. Auf Schritt und Tritt begegnen uns neue Beweise für die Richtigkeit, aber auch für die Schönheit und Eleganz der Auffassung von der Gesetzmäßigkeit der Na- tur. Bevor wir nun zum Strand hinuntergehen, möchte ich noch et- was zur physikalischen Sichtweise dieses Buches sagen. Vielleicht wird es Sie zuerst verwundern, dass ich ausschließlich Themen diskutiere, die sich mit unbelebten Gegenständen beschäftigen – Wellen, Sand, Steinen und so weiter. Dies kommt nicht etwa da- her, dass ich wild lebende Pflanzen und Tiere am Strand nicht 8 Einleitung
sehe oder nicht mag. Ganz im Gegenteil. Doch als Physiker kann
ich darüber nichts Besonderes aussagen. Weder habe ich eine
zoologische oder botanische Ausbildung, mit deren Hilfe ich das
Netz erkennen könnte, das Sandkrebse und Möwen miteinander
verbindet, noch verfüge ich über mehr als ein laienhaftes Wissen
darüber, aus welchen Gründen sie so geworden sind, wie sie sind.
Daher muss ich mich auf die Themen beschränken, bei denen
meine eigene Spezialausbildung von Nutzen ist. Ich kann also
nur Emersons altem Ausspruch folgen: «Erzähl uns, was du
weißt.»
Der zweite Gesichtspunkt, den ich ansprechen möchte, betrifft
eine Haltung, der ich manchmal bei Menschen begegne, mit
denen ich über wissenschaftliche Vorstellungen diskutiere. Sie
behaupten, irgendwie beeinträchtige es die Wertschätzung der
Schönheit einer Sache, wenn wir erfahren, wie sie funktioniert.
Ich erinnere mich besonders an einen Autor, den ich als Student
im höheren Semester las. Er zitierte einige Zeilen von Keats über
die Schönheit der Sonnenstrahlen auf dem Wasser und hielt ih-
nen eine Textpassage über kleine Wellen aus einem Buch zur
Hydrodynamik entgegen. Ich muss zugeben, dass mich dieser
Trugschluss verwirrte, besonders da ich das Buch am Ufer des La-
gunita-Sees auf dem Campus von Stanford las, eben dort, wo ich
immer meine Mittagspause damit verbrachte, zu lesen und den
Anblick der Sonnenstrahlen auf dem Wasser zu genießen. Doch
von persönlichen Gefühlen einmal abgesehen, habe ich nie ver-
stehen können, wieso etwas dadurch an Schönheit verlieren soll,
dass ich es verstehe. Versteht man das Verhalten von Licht, so be-
deutet das doch nicht, dass dadurch die Schönheit eines Gemäldes
von Botticelli geschmälert würde. Versteht man die Rolle von
Zug- und Druckbelastung in der Architektur einer Kathedrale, so
wird das Umherwandeln darin doch um keinen Deut weniger
faszinierend. In meinen Augen ermöglicht ein tieferes Verständ-
Einleitung 9nis eine reichhaltigere Erfahrung. Da macht der Strand – viel-
leicht einer der angenehmsten Aufenthaltsorte in der Natur –
keine Ausnahme. Ein Forscher, der über den Sand spaziert, sieht
dort dieselben Dinge wie jedermann sonst. Die Tatsache, dass er
über einige dieser Dinge besser Bescheid weiß, schmälert weder
seine Empfänglichkeit für ihre Schönheit noch den Grad seiner
Freude daran.
Mit dieser Versicherung lade ich Sie ein, mich an Ihren Lieblings-
strand mitzunehmen und Ihre Wahrnehmung zu schärfen, indem
Sie ihn durch meine Augen betrachten.
James Trefil
Charlottesville, Virginia1 All das viele Wasser
Kleine Tropfen Wasser,
kleine Körner Sand
bilden den großen Ozean
und das schöne Land.
Julia Carney,
Kleine Dinge
Stellen Sie sich an den Rand Ihres Lieblingsstrandes und sehen
Sie aufs Meer hinaus. Das ist einer der außergewöhnlichsten An-
blicke, die das Universum für uns bereithält: riesige Mengen flüs-
sigen Wassers. Zudem blicken Sie auf Wasser, das seit Millionen
Jahren mehr oder weniger in seinem jetzigen Zustand existiert.
Die Ozeane der Erde werden erst seit kurzem als einzigartige Er-
scheinungen wahrgenommen. Wer Science-Fiction-Literatur ge-
lesen hat, wird sich lebhaft an die «Kanäle auf dem Mars» und die
«Sümpfe auf der Venus» erinnern. Vor weniger als einem Viertel-
jahrhundert gingen die besten wissenschaftlichen Annahmen
über die Beschaffenheit unserer Nachbarplaneten noch davon
aus, dass es dort riesige Wassermengen gebe. Die weißen Polkap-
pen auf dem Mars deuteten auf eine zu niedrige Temperatur für
Wasser in flüssigem Zustand hin, sodass man annahm, es sei in
Eisflächen eingeschlossen. Die Wolkendecke auf der Venus hin-
dert uns zwar daran, einen Blick auf ihre Oberfläche zu werfen,
jedoch nicht daran, uns den Planeten als eine übergroße Ausgabe
der Everglades vorzustellen, jenes Sumpfgebiets an der Südspitze
Floridas. In beiden Fällen war unsere Ansicht über die Nachbar-
planeten von der Erwartung bestimmt, dass das auf der Erde so
All das viele Wasser 11reichlich vorhandene Wasser im übrigen Sonnensystem ebenso reichlich vorhanden sein müsse. Das amerikanische Forschungsprogramm zur Erkundung der Planeten hat viele unserer Sichtweisen auf das Sonnensystem ver- ändert. Die neue Vorstellung vom «Raumschiff Erde» hat unsere Ansichten über die Erde revolutioniert und uns ein Gefühl dafür vermittelt, wie einzigartig es ist, ein Erdling zu sein. Im Gefolge der kopernikanischen Wende hat der Mensch gelernt, die Erde als einen Planeten zu betrachten – und zwar als einen unter vielen, die um die Sonne kreisen. Sir Isaac Newton entwi- ckelte das Bild von einem Universum, in dem die Erde von den- selben physikalischen Gesetzen geformt und bestimmt wird, die überall gelten. Mit einer gewissen Überraschung haben wir des- halb zur Kenntnis genommen, dass diese Gesetze, obwohl sie doch überall wirksam sind, mit der Erde einen Planeten hervor- gebracht haben, der sich grundlegend von seinen Nachbarn un- terscheidet. Nichts macht diesen Unterschied augenfälliger als die Existenz der Ozeane. Die Viking-Raumsonden haben uns vom Mars Fotos einer dür- ren, leblosen Oberfläche gefunkt; die Polkappen stellten sich als gefrorenes Kohlendioxid (Trockenschnee) heraus. Proben erga- ben nichts, das nicht auf der Grundlage gewöhnlicher chemischer Reaktionen erklärt werden könnte – sollte dort Wasser vorhanden sein, so ist es tief im Boden eingeschlossen. Und von der Venus weiß man inzwischen, dass sie mit ihrer Oberflächentemperatur von 427° Celsius viel zu heiß ist, um Wasser führen zu können. Unter allen Körpern unseres Sonnensystems kommen nur auf der Erde Ozeane vor. Wenn die Menschen sich also von der Erdober- fläche wegzubewegen beginnen und unsere Nachfahren die ers- ten ständigen außerirdischen Wohnsiedlungen errichten, dann wird die seit alters geschätzte Wohltat eines Strandspaziergangs längst der Vergangenheit angehören. 12 All das viele Wasser
Also stellen die Ozeane der Erde uns vor ein Rätsel. Was ist denn
– angesichts derselben Naturgesetze, die überall im Sonnensys-
tem gelten – an unserem Planeten so besonders, dass nur wir das
Privileg haben, über große Massen flüssigen Wassers zu verfü-
gen? Welches sind die einzigartigen Kennzeichen, die die Erde
von allen anderen Planeten unterscheiden, obwohl hier dieselben
Gesetze gelten wie anderswo auch?
Um dieses Rätsel zu lösen, müssen wir zwei Kernfragen beant-
worten: Wie kommt die Erde überhaupt zu so viel Wasser, und
wie hat sie es in der Folgezeit bei sich behalten können? Die erste
Frage setzt Kenntnisse über die Entstehung der Erde voraus; die
zweite betrifft die Evolution der Erde und ihrer Atmosphäre.
Wir wissen, dass die Planeten und die Sonne sich in einem einzi-
gen Vorgang gebildet haben, bei dem eine Wolke wirbelnder
Gase sich unter dem Einfluss der eigenen Schwerkraft langsam
zusammengezogen hat. Wie dieses Bild nahe legt, ist der größte
Körper des Sonnensystems im Zentrum entstanden, wo sich die
größte Menge an Gas gesammelt hat. Dieser Körper ist der Stern,
den wir Sonne nennen. Beim Zusammensturz heizten sich die
Gasmassen so weit auf, dass es zu Kernfusionsreaktionen kam,
bei denen Wasserstoffkerne miteinander zu Heliumkernen ver-
schmolzen. Die dabei frei werdende Energie regte weitere Ver-
schmelzungen an. Diese Reaktionen heizten das Sonneninnere
auf, und der damit verbundene Druck hinderte die Sonne daran,
weiter in sich zusammenzufallen. Das dabei erreichte «zeitwei-
lige» Gleichgewicht hält nun schon rund viereinhalb Milliarden
Jahre an. Es dürfte von heute an ungefähr noch einmal so lange
dauern, bis die Sonne all den Brennstoff verbraucht hat, aus dem
sie sich beim Kollaps der Gaswolke zusammengeballt hat. In dem
Moment wird die Sonne sterben.
Außerhalb der Sonne lief im Sonnensystem ein anderer Vorgang
ab – ein Vorgang, den wir noch nicht genau verstehen. Einzelne
All das viele Wasser 13Gasmassen, die sich zu schnell drehten, um in die Ur-Sonne zu fallen, und deshalb in einer Umlaufbahn zurückblieben, began- nen sich zu verbinden und bildeten Masseansammlungen nach genau demselben Schwerkraftmechanismus, der zur Entstehung der Sonne geführt hatte. In Entfernungen von der Sonne, die nun den Umlaufbahnen der Planeten entsprechen, begannen sich solche Gasmassen zusammenzuschließen. Soweit wir wissen, lief dieser Vorgang zufällig ab. Irgendwo innerhalb dieser dünnen, rotierenden Wolke fanden sich ein paar Atome nahe genug bei- einander. Die vergrößerte Schwereanziehung dieser Ansamm- lung zog noch weitere Atome an, die ihrerseits die Anziehungs- kraft wiederum vergrößerten. Es ist nicht schwer einzusehen, dass dieser Vorgang schließlich zur Konzentration einer maximalen Masse in einem Punkt führen musste. So hat man sich eine Zeit lang die Entstehung der Erde vorge- stellt: Ein zufälliges Ereignis verursachte einen solchen Zusam- menbruch, bis alle vorhandene Materie in einem einzigen Körper zusammengedrängt war. Im letzten Jahrzehnt allerdings ist diese Vorstellung verfeinert worden. Die besten zurzeit angebotenen Theorien beschreiben die Entstehung unseres Planeten als einen Vorgang in zwei Schritten. Zuerst fand der oben beschriebene Schwerekollaps statt. Dabei bildeten sich kleine, asteroidenähnli- che Objekte, die so genannten Planetisimalen – einige immerhin so groß wie 1/500 der Erdmasse. Diese Planetesimalen stießen aneinander, und so begannen sich die eigentlichen Planeten auf- zubauen. Die Schauer kleinerer Körper, die auf die stetig wach- sende Erde niedergingen, erhitzten diese so stark, dass die ange- sammelten Materialien schmolzen. Die schwereren Elemente wie zum Beispiel Eisen sackten dabei in Richtung Erdmittelpunkt und formten den Eisenkern, den die Erde heute aufweist. Als der Planet noch ziemlich klein war, nahm ein anderer inter- essanter physikalischer Vorgang seinen Anfang. Schlägt irgendwo 14 All das viele Wasser
Sie können auch lesen