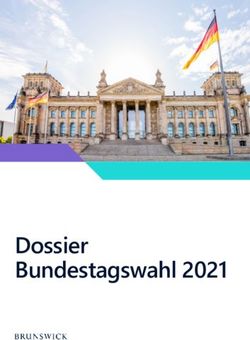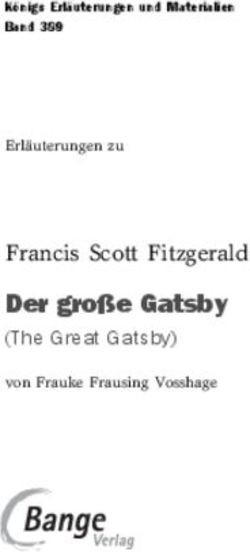Predigt Karfreitag 2020 - pg-12-apostel.de
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Predigt Karfreitag 2020
„DAS GRAB ALS ORT DER TRAUER UND DER HOFFNUNG“
Liebe Schwestern und Brüder
Am Beginn dieser Woche hat sich die Welt an einen der größten Künstler der
Weltgeschichte erinnert: Raffael Sanzio aus Urbino. Am 6.4.1520, also vor 500
Jahren, verstarb er überraschend nach einer kurzen Krankheit. Raffael zählt
neben Michelangelo und Leonardo da Vinci zu den großen Drei der italienischen
Renaissance. Weltberühmte Werke stammen aus seiner Hand: in unserem Land
ist es die sixtinische Madonna, die den Höhepunkt jeden Besuchs in der
sächsischen Landeshauptstadt Dresden bildet. Im vatikanischen Palast hat er sich
in der Ausmalung der Stanzen, in den Teppichen der Sixtina, in seiner
Philosophenschule und in den Portraits der Päpste Julius II und Leo X., deren
absoluter Lieblingskünstler er war, verewigt. Als Baumeister war er seiner
Bedeutung entsprechend natürlich auch am Neubau der Petersbasilika beteiligt.
Ende März 1520 erkrankt der 37jährige an einem Fieber, von der er sich nicht
mehr erholt, und stirbt am Karfreitag, am 6. April, des Jahres 1520. Papst Leo X.,
der Vatikan und die gesamte Kunstwelt versanken in Trauer über den Tod dieses
Genies.
Sein Grab fand er in einer der berühmtesten Kirche der Stadt Rom, im Pantheon,
dem Tempel aller Götter, den um die Zeitenwende Marcus Agrippa, der zweite
Mann im Reiche Kaiser Augustus, bauen ließ, der später zu einer Marienkirche
verändert wurde und als das letzte vollständige Bauwerk der römischen Antike
bis heute hoch in Ehren gehalten wird. Raffaels Grab ist heute noch Wallfahrtsort
für Kunstinteressierte aus aller Welt. Seine Bedeutung bis heute dokumentiert
die Inschrift, die sich auf seinem Grabmal findet:
„ILLE HIC ES RAPHAEL TIMUIT QUO SOSPITE VINCI
RERUM MAGNA PARENS ET MORIENTE MORI”
„HIER LIEGT JENER RAPHAEL, VON DEM (DIE NATUR) DIE HERVORBRINGERIN
ALLER DINGE FÜRCHTETE, ZU LEBZEITEN BESIEGT ZU WERDEN, UND MIT SEINEM
TOD EBENFALLS ZU STERBEN!“
Seine Kunst, seine Deutung der Wirklichkeit war eine Bedrohung der Natur. Er
schuf Werke, die die Natur übertrafen, und nach ihm lag auch die Natur in
1Todeszügen. Größer kann man einen Künstler nicht ehren, und ganz sicher war
auch dem Papst, der eine solche Inschrift genehmigte, klar, auf welche Stufe man
hier Raphael stellte. Er war der Gott der Kunst, der am Karfreitag starb, ebenso
wie der Gott des Leben, Christus, am Karfreitag starb. Diese Gleichsetzung
zwischen Raphael und Jesus hat schon früh und wohl mit Duldung hoher
Kirchenmänner angesetzt. Man beschönigte sein Alter auf 33 Jahre, das Alter
Jesu bei seinem Tod. Man deutete einen wenige Tage vor seinem Tod
entstandenen Riss in der Mauer des Vatikanischen Palastes als Wiederholung der
Ereignisse beim Tod Jesu, als der Vorhang des Tempels entzwei riss und
schließlich erzählte man Jahrzehnte später, dass Raffael vor seine letzten Werk,
einem monumentalen Bild der Verklärung Christi, aufgebahrt wurde. Vieles ist
Legende, die allein den Zweck hat, im Tod den herausragenden Künstler, den
Gott der Natur, dem Gottessohn, dem Gott des Lebens, anzugleichen. Sein Grab
im Pantheon sollte diesen Ruhm für alle Zeiten sichern und die Inschrift jedem
Besucher auch Jahrhunderte später noch in Erinnerung rufen, an der Ruhestätte
welcher bedeutenden Persönlichkeit er steht. Raffael wird Christus angeglichen,
um ihm auch über den Tod hinaus ewige Ehre zu teil werden zu lassen.
Gräber sind nicht nur notwendige Orte, um unsere Verstorbenen würdig aus
dieser Welt zu verabschieden. Sie dienen auch ihrem Andenken und der
lebendigen Erinnerung. Das verbinden wir auch mit dem berühmtesten Grab der
Welt, dem Grab Jesu. Johannes schildert besonders ausführlich die Beisetzung
Jesu nach der Kreuzigung und macht so deutlich, dass der Karfreitag nicht mit
dem Tod Jesu am Kreuz endet, sondern seine vorläufig letzte Ruhe noch ein
wichtiger Moment im Geschehen des Tages ist. Zwei, die sich bisher abseits
gehalten haben, Josef von Arimathäa und Nikodemus, zwei angesehene Männer
im Volk, kommen und bitten um den Leichnam Jesu. Die Bestattung des
augenscheinlichen Verbrechers und Rebellen gestalten sie königlich. Sein Leib
wird mit 33 Kilo, das sind damals 100 Pfund, teuersten Öl gegen die Verwesung
einbalsamiert. Er kommt nicht in die nächste offene Grabkammer. Ihm wird in
einem Park ein ganz neues Grab reserviert. Mit ihrer Beisetzung und dem Grab
bekennen sie ihren Glauben, dass Jesus wirklich der endzeitliche König Gottes ist.
Es ist ein Widerspruch zur Demütigung am Kreuz, über dem der Titel „König der
Juden“ sein Verbrechen angibt. Das Grab Jesu ist nicht der Not geschuldet ein Ort
vorläufiger Versorgung angesichts des nahenden Ruhetages, es ist ein Ort für die
2Ewigkeit, ein Ort der Trauer, der Erinnerung und der Nähe, aber auch ein Ort des
Glaubens.
Wie wohltuend erscheint diese Szene gerade in unseren Tagen, wo gewohnte
Rituale von Beisetzungen im Rahmen der Corona-Epidemie nicht mehr möglich
sind. Wie schwer trifft es in unserem Land viele, dass der Abschied von lieben
Verstorbenen nur im kleinsten Kreis ohne Requiem direkt am Grab vollzogen
wird. Viele, die einem Verstorbenen als Freunde, Kollegen, Vereinskameraden
zugetan waren, haben keine Möglichkeit, öffentlich ihre Achtung vor dem
Verstorbenen zu bezeugen durch Teilnahme, Kondolenz oder gar Trauerreden.
Und letztlich geht es uns damit noch gut.
Aus Verona in Norditalien, meiner Studienstadt, haben Freunde mir vor wenigen
Tagen Bilder aus der Zeitung zukommen lassen, die dokumentieren, wie bei einer
Massenbeisetzung nach vielen Sterbefällen in der Stadt allein der Bischof der
Stadt am Hauptportal des Zentralfriedhofs ein Segensgebet spricht und Männer
in Schutzanzügen mit Baggern möglichst schnell die notwendigen Arbeiten
vollziehen. Auch der Blick nach New York erschüttert, wo man Zelte aufbaut, weil
man keinen Platz mehr für die Verstorbenen hat, und überlegt, vorläufige
Beisetzungen in Parks vorzunehmen. Keine Angehörigen, keine Ehrbekundungen,
nur die wesentlichen religiösen Riten und alles möglichst schnell. Wir spüren,
diese Art der Beisetzung wünschen wir niemand und es wäre für uns sehr
traurig, wenn wir so Abschied nehmen müssten von unseren Verstorbenen.
Es gehört zu unserem Empfinden, geprägt auch durch unsere jüdisch-christliche
Tradition, dass der Abschied und das Sorgen um die Letzte Ruhestätte eines
Toten sehr wichtige Momente im Umgang mit Trauer sind. Auch wenn wir an die
Auferstehung der Toten glauben, wir können nicht einfach nach dem Tod ein
Leben abschließen und zur Tagesordnung übergehen. Die Beisetzung und später
die Pflege der Gräber sind wichtige Momente, um mit dem Tod eines geliebten
Menschen weiterleben zu können.
Ganz sicher war das auch für die Familie und Freunde Jesu so: So dramatisch sein
Leiden vom Abend des Gründonnerstag an verlief, so unfassbar sie seinen Tod
empfanden, so wichtig war es, ihn in Würde beizusetzen, seiner Stellung als
„Erwählter Gottes“ entsprechend. Die Tradition verbindet mit den Ereignissen
3nach seinem Sterben am Kreuz sehr wichtige Erfahrungen. War bisher alles
hektisch, laut, brutal, voller Geschrei und Entsetzen, so sind es jetzt Momente
der Ruhe und Nähe, die das Geschehen bis zur Beisetzung bestimmen. Denken
wir an die Bildmotive der größten Künstler:
Vorsichtig wird Jesus vom Kreuz abgenommen. Es ist nicht lange her, da hat man
dumpfe Hammerschläge gehört, die unbarmherzig Nägel in seine Handwurzeln
trieben.
Man legt ihn in die Arme seiner Mutter. Eine der berührendsten Szenen des
Kreuzweges: Wie damals als kleines Kind ruht der leblose Körper Jesu in den
Armen seiner Mutter. Der junge Michelangelo hat für die Peterskirche wohl die
schönste Pieta geschaffen, als es ihm gelang aus dem harten Marmor den
schlaffen und weichen Körper Jesu zu formen in den Armen einer jungen Frau,
deren Schicksal einen tief bewegt. Nur Stunden zuvor war er in den groben
Händen von Folterknechten und Soldaten, Opfer von Schlägen, Peitschenhieben,
Stoßen und Zerren.
Nikodemus und Josef tragen ihn behutsam in einem Leinentuch und stellen so
die Ehre dessen wieder her, den man seiner Kleider beraubt hat und der
öffentlichen Demütigung preisgab.
In seiner Beisetzung wird auch einen Gegenwelt zum Vormittag entworfen. Viele
können das nachvollziehen. Während die Tage zwischen Tod und Beisetzung oft
voller Hektik durch die Vorbereitungen sind, kehrt mit dem Tag der Beerdigung
eine manchmal belastende, oft aber auch erholsame Ruhe ein. Jetzt kann man
nachdenken. Das Herz schafft Platz für die Erinnerung, von der Dietrich
Bonhoeffer sagt, dass die Dankbarkeit sie zu einer stillen Freude verwandelt. Das
Vergangene, das einen verbindet, so Bonhoeffer, trägt man wie ein kostbares
Geschenk mit sich. Viele Angehörige erleben es so: Die Trennung, das gibt
Bonhoeffer zu, schmerzt immer. Aber langsam entwickelt sich eine Normalität im
Umgang mit denen, die nicht von uns, sondern uns voraus gegangen sind, wie es
Papst Johannes XXIII. einmal ausgedrückt hat. Man redet miteinander, man
findet einen Weg, in Fürbitten und Bildern den Verstorbenen einen Platz bei
wichtigen Familienfeiern zu geben. Man kann erzählen und lachen, sich freuen
über das, was man erlebt hat. Man geht mit den Enkeln an das Grab des
Großvaters oder der Großmutter, die sie unter Umständen gar nicht mehr erlebt
4haben, und erzählt beim Richten der Blumen. Gerade auch für Eltern, die ihr Kind
verloren haben, wird das Grab zu einem Ort, an dem das unruhige und gequälte
Herz Ruhe findet, weil man sich nahe fühlt. Ob glaubend oder nicht, die Kultur
unseres Trauerns hängt eng mit Orten, Riten und Traditionen zusammen.
Schlimm, wenn jemand nicht mehr weiß, wie er sich verhalten soll in so einem
Moment. Der Karfreitag ist ein Tag, der uns auch an die Wichtigkeit einer
Trauerkultur in unserem Land erinnert, die der Würde und Bedeutung einer
unverwechselbaren Lebensgeschichte gerecht wird.
Aber für uns Christen ist das Grab noch mehr. Was Maria und die Treuen noch
nicht wissen können: Dieses Grab wird zum Wendepunkt ihres Lebens. Hier
werden sie dem Auferstandenen begegnen. Der Karfreitag darf nicht in der
Grabesstille enden. Er schreit nach Fortsetzung. Seine Stille ist noch
ohrenbetäubend, wie es vor wenigen Tagen Papst Franziskus formuliert hat. Wir
bekennen, dass Jesus in der Grabesruhe aktiv wird. In einem Satz unseres
Glaubensbekenntnisses heißt es „Hinabgestiegen in das Reich der Toten.“ Die
Tradition, die v.a. in der Ostkirche auch bildlichen Ausdruck gefunden hat, will,
dass jetzt das Leben eingebrochen ist in das bisher so hermetisch abgeriegelte
Reich des Todes. Der Tod hat im Tod verloren. Wie die Natur fürchten musste mit
dem Tode Raffaels zu sterben, so ist der Tod ein für allemal gestorben mit dem
Tode Jesu. Ikonen der Ostkirche zeigen, wie Jesus jetzt in diesem Augenblick die
Tore der Unterwelt zertritt, Adam und Eva an den Handgelenken emporreißt und
die Gerechte aus den Gräbern führt. Die Ruhe des Karfreitags lädt ein zur
Besinnung, aber auch zur Hoffnung. Es geschieht gerade etwas: Die, die eben
noch so siegreich erschienen, stehen am Abgrund. Der Tod, die Gewalt, das
Unrecht, die Menschen scheinbar niederwerfen, sind schon besiegt. Aus dieser
Hoffnung haben viele Menschen im Glauben ihren letzten Weg angetreten. Einer
von ihnen, der Theologe und Widerstandskämpfer Dietrich Bonhoeffer, der am 9.
April 1945, also gestern vor 74 Jahren, noch auf ausdrücklichen Befehl Adolf
Hitlers hingerichtet wurde, konnte schon viele Jahre vor seinem Tod festhalten:
Es ist das Befreiende von Karfreitag und Ostern, dass die Gedanken weit über das
persönliche Geschick hinaus gerissen werden zum letzten Sinn alles Lebens,
Leidens und Geschehens überhaupt und dass man eine große Hoffnung fasst.
Der Karfreitag führt zum Grab, aber er endet hier nicht. Er bereitet vor auf das
Leben, das der Auferstandene schenkt. Wenn wir heute ans Grab Jesu
5mitgenommen werden, dann blicken wir auf die Gräber aller Menschen, die uns
wertvoll und lieb waren, aber auch der Menschen, an die keiner mehr denkt, für
die es keine Orte der Erinnerung mehr gibt, und glauben, dass das Grab nicht
Sackgasse, sondern Vorgarten für Gottes Ewigkeit ist. Raffaels Grab sollte ihn
Christus angleichen. Unsere Gräber sollen uns in Erinnerung rufen, dass wir Gott
gehören und hier nur für seinen Himmel aufbewahrt werden. Amen.
Sven Johannsen, Pfarrer
6Sie können auch lesen