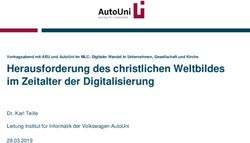Predigt zum 5.Sonntag nach Trinitatis - Juli 2021
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Predigt zum 5.Sonntag nach Trinitatis
4. Juli 2021
Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Liebe Gemeinde, liebe Leserinnen und Leser,
inzwischen dürfen wir in unseren Gottesdiensten – mit Maske freilich – auch
wieder singen und es dürfen auch wieder mehr Menschen direkt
beieinandersitzen. Ich kann also eine herzliche Einladung in unsere
Gottesdienste aussprechen. Für alle, die noch zögern: hier die Predigt für
den Sonntag.
Choral:
Lob getrost mit Singen, frohlock, du christlich Schar (EG 243, 1.2.6).
Gebet:
Ewiger und allmächtiger Gott – wir danken dir dass du diesen Morgen aus
der tiefe der Nacht heraufgeführt hast. Wir ruhen von aller Umtriebigkeit,
treten von unserem Alltag zurück. Wir kommen als deine Gemeinde, mit
allen, die dich bekennen und deine Nähe suchen, zusammen und heiligen so
diesen besonderen Tag. Gib, dass deine gute und gnädige Herrschaft uns
alle findet, damit jedem von uns so geholfen wird, wie er es jetzt braucht.
Lesung:
Als Lesung wählte ich jenen Abschnitt der Abrahamsgeschichte aus, in der
erzählt wird, wie der alte Abraham sein Leben nochmals umkrempelt und
neu anfängt. Sie finden diesen Text im ersten Buch Mose, Kapitel 12, die
Verse 1 bis 4.
Choral:
Wach auf, du Geist der ersten Zeugen (EG 241, 1.2).
Liebe Gemeinde,
am Kreuz, da scheiden sich die Geister. Zumindest seit dem Kruzifix-Urteil
von 1995 ist auch uns Protestanten dies wieder deutlich geworden. Während
das Kreuz in einigen öffentlichen Räumen Süddeutschlands zur Lebenskultur
zu gehören scheint, waren damals immerhin 24 % aller Befragten dafür, dass
Kruzifixe in Klassenzimmern nicht angebracht werden sollten. Am Kreuz
scheiden sich also die Geister.
Aber nicht erst 1995. Schon 1790 zählte Goethe in einer saloppen Äußerung
neben Tabak, Wanzen und Knoblauch auch das Kreuz zu jenen Dingen, die
ihm am meisten zuwider seien. Ob er sich damit nur als Kind der Zeit zu
erkennen gab, das sei dahin gestellt. Jedenfalls wurde im Zuge der
französischen Revolution 1794 die Kathedrale von Notre Dame umbenannt
in: „Tempel der Vernunft“ und wenige Monate später wurde das „Fest des
höchsten Wesens“ eingeführt. Das Kreuz war aus dem öffentlichen Leben
verschwunden, das Christentum war abgeschafft. Als Folge dieser
Entwicklung formulierte sich später die Redewendung: „Leben wie Gott in
Frankreich“. Der Kenntnisreiche unter uns weiß, dass damit nicht ein
besonders gutes und unbekümmertes Leben gemeint ist, denn Gott war in
Frankreich ja abgeschafft. „Leben wie Gott in Frankreich“ das bedeutete:
tot sein. Der christliche Glaube spielte keine Rolle mehr, jetzt galt nur nochdie Vernunft. Am Kreuz also scheiden sich die Geister. Diese Scheidung wird nicht nur in Zukunft Schule machen. Werden doch heute schon Fußballclubs, die in ihrem Wappen ein Kreuz haben und von muslimischen Staaten finanziert werden, höflich aber bestimmt gebeten, dieses Wappen zu ändern. Nein, diese Scheidung wird nicht nur in Zukunft zunehmen, sie hat auch Geschichte. Jüngste Geschichte. Erlebt, als Heinrich Bedford-Strohm und Kardinal Marx 2016 den Tempelberg in Jerusalem besuchten und auf Bitten muslimischer und jüdischer Autoritäten ihre Amtskreuze ablegten. Am Kreuz scheiden sich eben die Geister. Und wenn wir in den Brunnen der Geschichte weiter hinabsteigen und nach einem Anfang fragen, nach einem Anfang, da sich die Geister am Kreuz scheiden, so bekommen wir in der korinthischen Gemeinde wieder festen Boden unter die Füße. Um 50 nach Christus war Paulus zum ersten Mal in dieser quicklebendigen Hafenstadt mit all den Erscheinungen, die zu einer vielbevölkerten Hafenstadt gehören. Doch kaum, dass der Apostel 4 Jahre weg war, da scheint es in diesem St. Pauli des Mittelmeeres, in der ´Stadt der Aphrodite`, wie Korinth gewiss nicht grundlos auch genannt wurde, drunter und drüber gegangen zu sein. Da scheinen sich innerhalb der jungen Gemeinde, die Geister am Kreuz Christi geschieden zu haben. Was sollen wir an einen Gott glauben, der ausgerechnet am Kreuz sich selbst auslegt und der gerade am Kreuz sich zu verstehen gibt? Solch ein Narrenglaube! Gott ja, aber unsere Weisheit sucht ihn irgendwo im Himmel aber doch nicht am Kreuz. Wie der Apostel Paulus diese Nachricht aufnahm, wo sie doch das Zentrum seiner Verkündigung in Frage stellt (V 23) - zwischen den Zeilen kann man es dem Korintherbrief abspüren; und wenn wir uns den Apostel mit glühendem Kopf vorstellen, zugleich aber immer wieder mit werbenden Gedanken, dann ist unser Bild des Paulus sicher nicht falsch. Mit flinker Feder setzt er sich ans Pergament, kein Wort ist zu viel in seinem schnellen Schreiben, kein Rastplatz ist für die Gedanken vorgesehen, zügig schreibt er der Gemeinde nach Korinth: 18. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden; uns aber, die wir selig werden ist's eine Gotteskraft. 19. Denn es steht geschrieben: "Ich will zunichtemachen die Weisheit der Weisen, und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen." 20. Wo sind die Klugen? Wo sind die Schriftgelehrten? Wo sind die Weltweisen? Hat nicht Gott die Weisheit dieser Welt zur Torheit gemacht? 21. Denn dieweil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott wohl, durch törichte Predigt selig zu machen die, so daran glauben. 22. Sintemal die Juden Zeichen fordern und die Griechen nach Weisheit fragen, 23. wir aber predigen den gekreuzigten Christus, den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit; 24. denen aber, die berufen sind, Juden und Griechen, predigen wir Christum, göttliche Kraft und göttliche Weisheit. 25. Denn die göttliche Torheit ist weiser, als die Menschen sind; und die göttliche Schwachheit ist stärker, als die Menschen sind. (1. Kor. 1, 18-25). Doch hat die ungeschriebene Stimme, die Paulus so in Aufregung bringt, hat sie nicht recht? Ist die Abwehr, Gott ausgerechnet im Kreuz zu verstehen, nicht zu tiefst verständlich? Muss man nicht um Jesu und Gottes Willen „Nein“ zum Kreuz sagen. Ist das Wort vom Kreuz im Grunde nicht immer wieder ein dunkles Wort, ein Trauerwort? Bei einem Besuch fragte mich einmal der von mir Besuchte: warum musste Gott gerade diesen Weg wählen, um die Menschen mit sich in Einklang zu bringen, warum musste gerade das Kreuz im Mittelpunkt stehen, hätte er das nicht auch anders machen können? Wahrscheinlich flüchtete ich mich damals in irgendwelche
theologische Formeln, um mein Unwissen zu verbergen, blieb aber letztlich die Antwort wohl doch schuldig. Paulus sieht sich hier Juden und Griechen gegenüber. Statt des Wortes vom Kreuz verlangen die Juden ein Zeichen (V 22). Ein Zeichen, das deutlich macht, dass das Kreuz nicht im Widerspruch zum Alten Testamentes steht. Deshalb nennen sie die Verkündigung des gekreuzigten Christus einen Skandal. Und die Griechen - sie verlangen nach Weisheit (V 22), und sehen im gekreuzigten Christus nur eine lächerliche Verrücktheit, ein Gott am Kreuz, das ist für jeden Weisen doch nur zum Lachen. Wie Paulus diese beiden Menschengruppen vor sich sieht, da fällt ihm auf, dass sich in ihnen die typischen Möglichkeiten der Menschen überhaupt darstellen. So sind die Menschen. So sind wir. Die einen erwarten von Gott ein Machtwort, das durch seinen Erfolg beeindruckt und klar zur Sache redet. Die anderen erwarten ein Weisheitswort, das durch seine Einsichten fasziniert. Und so unterschiedlich die beiden Typen auch sind, die durch alle Zeiten hindurch in verschiedenen Nuancen immer wieder auftreten, sie gleichen sich in dem einen Punkt: sie stellen Bedingungen: das Wort vom Kreuz soll nun mal so einleuchten, dass es sich den eigenen Erwartungen fügt. Nach unseren Einsichten und Kriterien soll sich Gott fügen. Doch damit wird unser Denken zum Spiegelsaal unserer Eitelkeiten. Wir lassen die Kreuzesbotschaft an unsern Wunschbildern und Maßstäben zerschellen. Und plötzlich ist nicht mehr das Wort vom Kreuz im Mittelpunkt sondern unsere Vorstellungen darüber, wie denn Gott bitteschön sein möchte. So aber erkennt man im Wort vom Kreuz nur noch Torheit (V 18). Denn Torheit kann Gott und Kreuz nicht zusammenbringen, sie sieht darin nur eine Schwachheit Gottes. Welch ein Gott, der am Kreuz sich zu verstehen gibt. Ein schwacher Gott? Doch nun lässt Paulus nicht locker. Auch wenn die Welt darin Torheit, und nichts als Narrenglauben erkennen will, gerade in dieser Schwachheit ist Gott der Welt nahe. Alles stellt das Wort vom Kreuz auf den Kopf, denn es gibt unserem Gottesverhältnis eine ganz neue Bestimmung. Nicht mehr unsere Vorstellungen sind im Brennpunkt, das Gottesverhältnis ist allein eine Angelegenheit des Glaubens. Deshalb geht es in Kirche und Theologie, so sie recht Kirche und Theologie sein will immer erst in zweiter Linie um Moral und Frömmigkeit und in erster Linie um den Glauben. Das Wort vom Kreuz ist ein Wort des Umdenkens und auch der Umkehr, ein Wort, das den Menschen lehrt ganz anders über sich selbst und über Gott zu denken. Wie das? Dazu möchte ich Ihnen die Geschichte von Oskar erzählen. Diese Geschichte ist festgehalten in dem kleinen Buch von Eric-Emmanuel Schmitt. Es trägt den Titel: „Oskar und die Dame in Rosa“. Oskar ist 10 Jahr alt und hat Krebs. Er liegt im Krankenhaus. Am Ende des Büchleins wird Oskar sterben. Vorher aber beginnt er, Briefe an Gott zu schrieben und seine Fragen mit Gott zu teilen. Bis er sich eines Tages auf den Weg in die Kapelle macht, um Gott zu besuchen. Er findet Gott in Form eines Kruzifixes, das dort steht. In seinem nächsten Brief an Gott schreibt Oskar: „Ich habe natürlich einen Riesenschreck bekommen, als ich Dich dort hängen sah, als ich dich in diesem Zustand gesehen habe, fast nackt, ganz mager an deinem Kreuz, überall Wunden, die Stirn voller Blut durch die Dornen, und der Kopf, der dir nicht mal mehr gerade auf den Schultern saß. Das hat mich an mich selbst erinnert. Ich war empört. Wäre ich der liebe Gott, wie Du, ich hätte mir das nicht gefallen lassen.“ (63 f). Oskar begreift, dass der Gekreuzigte, den er dort sieht, dort nicht hängt, weil er das unbedingt müsste. Hätte er als Gott nicht die Kraft, das alles von sich fern zu halten? So wie die Erwachsenen das Leid von sich fernhalten, die in der Gegenwart Oskars nur noch flüstern, und sich nicht getrauen, ihm die Wahrheit über seinen Gesundheitszustand zu sagen. Gott tut das nicht. Er hält das Leid nicht von sich fern. Er nimmt das Lied in sich selbst auf. Erfahrbar wird das aber nur, wen wir begreifen, dass es Gott ist, der da am Kreuz hängt, nicht nur der fromme Prediger aus Nazareth, der Wanderrabbi Jesus. Der kleine Junge sieht Gott am Kreuz. Und dann passiert auf einmal etwas:
„Das hat mich an mich selbst erinnert.“ (63). Oskar versteht auf einmal, dass diese Geschichte am Kreuz für ihn selbst geschieht. Dass dort der einzige stirbt, der sein – Oskars – Kreuz tragen kann. In dem Moment, in dem Oskar die Geschichte Gottes als seine Geschichte begreift, in der sein eigenes Leben vorkommt, da wird ihm das „Wort vom Kreuz“ zu einer Kraft, die ihn von innen heraus erfüllt. Damit ist freilich nicht alles gelöst. Oskar wird am Ende des Buches sterben. Doch ohne Kreuz sind Gott und Welt, ja Gott und Mensch nie zusammen zu bringen. Wer sich am Kreuz orientiert, der wird auch dem Leben gerecht. Denn er sieht Gott in seiner ganzen Schwachheit und braucht deshalb auch selbst nicht die Augen vor dem Leben zu verschließen. Da muss einer nicht mehr den starken Mann markieren, da muss einer nicht mehr sich seiner Schwachheiten schämen - mehr noch, da muss einer sich nicht einmal mehr seiner Schwachheiten fürchten. Vor Gottes unüberbietbarer Schwachheit im Kreuz Jesu Christi bleiben unsere kleinen Schwachheiten zurück. Und so kann, wer sich an die Schwachheit des Gekreuzigten klammert und dem Wort vom Kreuz nicht flieht, auch nüchtern und tapfer ins Leben hineinschauen. In ein Leben, das uns wahrlich nichts schenkt und vieles nimmt: Freude, Hoffnungen und immer wieder Menschen. Ein Leben, das uns immer wieder die Frage diktiert: Warum und Wozu? Doch gerade die Erfahrung dieser extremen menschlichen Situationen drängt zum Wort, drängt zur klärenden, tröstenden und verarbeitenden Sprache. Wir stehen an dieser Stelle mit dem Wort vom Kreuz nicht stumm da. Paulus sagt es mit seinen Worten: „Uns aber, den Geretteten, ist es eine Kraft Gottes.“ (V 18). Fast ist man ja verwundert, dass wir mit diesem Satz gemeint sein sollen, dass wir zu denen gehören, die gerettet sein sollen. Wir von uns aus hätten das nicht so gesagt. Doch Paulus plagt sich mit keinem Zweifel: den Leser seines Briefes, uns, ist das Wort vom Kreuz eine Gotteskraft. So ist das Wort vom Kreuz kein Trauerwort, das das Leiden verherrlicht, festschreibt oder verewigt. Es ist vielmehr ein Wort des Lebens, weil es der denkbar schärfste Einspruch gegen alle Todesresignation und gegen den Irrglauben an die Allmacht des Todes ist. Deshalb ist das Wort vom Kreuz, an dem sich die Geister scheiden, kein dunkles Wort, sondern durch und durch ein Freudenwort. Amen. Choral: Herr, wir stehen Hand in Hand, die dein Hand und Ruf verband (EG 594, 1.3.5). Gebet: Du treuer Gott, wir sind bewahrt geblieben in mancher Gefahr, Du bist unerkannt bei uns gewesen und hast uns beschützt. Vergib uns unsere Angst, unsere unnötigen Sorgen und unseren Kleinglauben. Du bist unser Halt, der Grund, der uns trägt, das Dach unter dem wir wohnen, der Frieden in dem wir ruhen – dafür danken wir dir. Wir bitten dich für die Menschen, die keinen Frieden finden, für die Verirrten, Verstrickten und Verzweifelten; für die Zerstrittenen, die unfähig sind, sich zu versöhnen; für die Schuldiggewordenen, die an Vergebung nicht glauben können. Überwinde ihre Not durch deine nimmer endende Güte. Vaterunser Segen: Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.
Sie können auch lesen