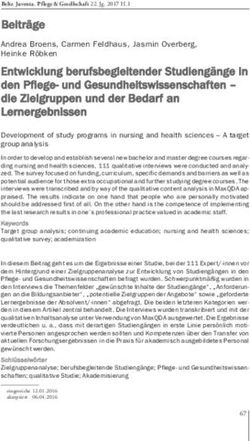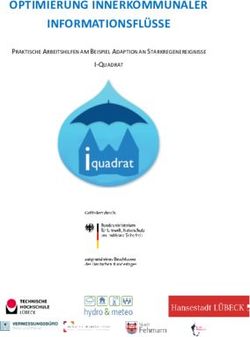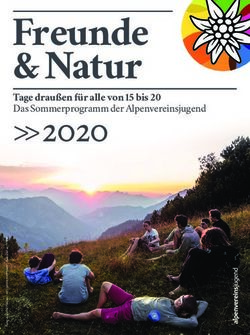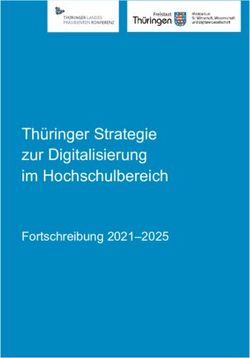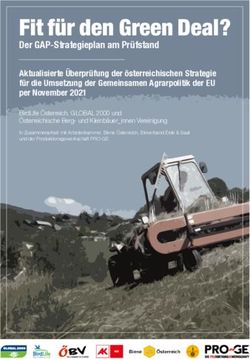PROJEKTBERICHT BEDARFSANALYSE WOLLISHOFEN - Zenodo
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Bedarfsanalyse Wollishofen
Projektzeitraum: März 2018 – Dezember 2018
Simon Lindegger
Hochschule Luzern – Soziale Arbeit
Studienrichtung: Soziokulturelle Animation
Begleitperson: Annina Friz
Eingereicht am 23. Februar 2019
Diese Arbeit ist Eigentum der Hochschule Luzern – Soziale Arbeit. Sie enthält die persönliche
Stellungnahme des Autors/der Autorin bzw. der Autorinnen und Autoren.
Veröffentlichungen – auch auszugsweise – bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung durch die Leitung
Bachelor.
2Originaldokument gespeichert auf LARA – Lucerne Open Access Repository and Archive der Zentral- und
Hochschulbibliothek Luzern
Dieses Werk ist unter einem
Creative Commons Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Keine Bearbeitung 3.0 Schweiz Lizenzvertrag
lizenziert.
Um die Lizenz anzuschauen, gehen Sie bitte zu https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ch/
Oder schicken Sie einen Brief an Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California
95105, USA.
Urheberrechtlicher Hinweis
Dieses Dokument steht unter einer Lizenz der Creative Commons Namensnennung-Keine kommerzielle
Nutzung-Keine Bearbeitung 3.0 Schweiz http://creativecommons.org/
Sie dürfen:
Teilen — das Material in jedwedem Format oder Medium vervielfältigen und weiterverbreiten
Zu den folgenden Bedingungen:
Namensnennung — Sie müssen angemessene Urheber- und Rechteangaben machen, einen Link zur
Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden. Diese Angaben dürfen in jeder
angemessenen Art und Weise gemacht werden, allerdings nicht so, dass der Eindruck entsteht, der Lizenzgeber
unterstütze gerade Sie oder Ihre Nutzung besonders.
Nicht kommerziell — Sie dürfen das Material nicht für kommerzielle Zwecke nutzen.
Keine Bearbeitungen — Wenn Sie das Material remixen, verändern oder darauf anderweitig direkt
aufbauen dürfen Sie die bearbeitete Fassung des Materials nicht verbreiten.
Im Falle einer Verbreitung müssen Sie anderen die Lizenzbedingungen, unter welche dieses Werk fällt,
mitteilen.
Jede der vorgenannten Bedingungen kann aufgehoben werden, sofern Sie die Einwilligung des Rechteinhabers
dazu erhalten.
Diese Lizenz lässt die Urheberpersönlichkeitsrechte nach Schweizer Recht unberührt.
Eine ausführliche Fassung des Lizenzvertrags befindet sich unter https://creativecommons.org/licenses/by-nc-
nd/3.0/ch/legalcode.deA BSTRACT
Das soziokulturelle Projekt «Bedarfsanalyse WoLei» versucht sich an einer, für die OJA Wollishofen &
Leimbach, neuen Bedarfserhebungsmethode, um näher an der Lebenswelt und den Bedürfnissen der
Jugendlichen zu sein. Das Projekt beabsichtigt eine nachhaltige Angebotsgestaltung mit und für
Jugendliche aus Wollishofen und soll zur Förderung ihres Kompetenzerwerbs beitragen.
Ziel ist es mittels einer Online-Umfrage wichtige Erkenntnisse über die Jugendlichen und ihre
Lebenswelt zu erhalten. Über ein Anreizsystem, in Form eines Wettbewerbs, bei welchem attraktive
Preise verlost werden, wird versucht, möglichst viele Jugendliche aus Wollishofen für eine Teilnahme
an der Umfrage zu gewinnen. Bei einem mit den Jugendlichen partizipativ veranstalteten Anlass
werden die Resultate präsentiert und die Preise verlost. Dieser Anlass dient auch als Startschuss für
neue, gemeinsame Projekte.
3I NHALTSVERZEICHNIS
Abstract ................................................................................................................................................... 2
1. Ausgangslage ................................................................................................................................... 6
2. Projektidee ...................................................................................................................................... 7
3. Situationsanalyse............................................................................................................................. 7
4. Ziele ................................................................................................................................................. 8
4.1. Definition der Zielgruppe ........................................................................................................ 8
4.1.1. Primäre Zielgruppe .......................................................................................................... 8
4.1.2. Sekundäre Zielgruppe...................................................................................................... 8
4.2. Zielbaum .................................................................................................................................. 8
5. Projektorganisation ....................................................................................................................... 10
6. Zeitplanung .................................................................................................................................... 11
7. Umsetzung..................................................................................................................................... 12
8. Evaluation ...................................................................................................................................... 15
8.1. Zielerreichung........................................................................................................................ 16
8.2. Partizipation .......................................................................................................................... 19
8.3. Aufbau- und Ablauforganisation ........................................................................................... 21
8.3.1. Umfrage ......................................................................................................................... 21
8.3.2. Abschlussveranstaltung ................................................................................................. 23
8.4. Analyse der Umfrageresultate .............................................................................................. 24
8.5. Nachhaltigkeit........................................................................................................................ 26
8.6. Interventionspositionen ........................................................................................................ 27
9. Projektfinanzierung ....................................................................................................................... 28
10. Schlussfolgerungen/Empfehlungen .......................................................................................... 29
Quellenverzeichnis ................................................................................................................................ 31
Anhänge ................................................................................................................................................ 33
4A BBILDUNGSVERZEICHNIS
Abbildung 1: Projektorganisation............................................................................................................ 9
Abbildung 2: Zeitplan ............................................................................................................................ 10
Abbildung 3: Umfrageaushang .............................................................................................................. 12
Abbildung 4: Flyer Abschlussanlass ....................................................................................................... 13
Abbildung 5: Flyer Evaluationsdesign.................................................................................................... 14
Abbildung 6: Partizipation ..................................................................................................................... 19
Abbildung 7: Interventionspositionen................................................................................................... 26
Abbildung 8: Projektfinanzierung .......................................................................................................... 27
51. A USGANGSLAGE
Um die Bedürfnisse der Jugendlichen aus Wollishofen & Leimbach zu erheben, hat die OJA Wollishofen
& Leimbach (OJA WoLei) bisher verschiedene Methoden zur Bedarfserhebung von Jugendlichen
angewendet: Nebst informellen Gesprächen mit Jugendlichen, erhob die OJA WoLei die Bedürfnisse
durch schriftliche Befragungen in unseren Räumlichkeiten sowie bei Ideen-Schulworkshops während
einer Lektion, in Form einer angepassten und verkürzten Zukunftswerkstatt.
Die Erfahrungen aus vergangenen Workshops hatten gezeigt, dass es den Jugendlichen schwer fiel,
Bedürfnisse zu äussern, die sie selbst noch nicht kennen. Zudem erschwerte die knappe Zeit die
Entwicklung neuer Ideen (20 Minuten). Bei den Schulworkshops war festzustellen, dass sich
Jugendliche, zu welchen die OJA WoLei bereits eine Beziehung pflegte, aktiver am Workshop
beteiligten. Zudem zeigten diese auch einen grösseren Bedarf an Freizeitangeboten durch die OJA. Bei
den letzten Workshops war auffallend, dass das Interesse an Konsumangeboten zugenommen und die
Bereitschaft, Freiwilligenarbeit zu leisten, im Vergleich zum Vorjahr abgenommen hat. Nach dem
Konsum- und Transfermodell von Jean-Claude Gillet (1998, zit. in Gabi Hangartner, 2010, S. 306) sind,
gemäss dem konsumistischen Modell, jene Angebote zu verstehen, die dem Individuum und Gruppen
zum Konsum angeboten werden, welche die Zielgruppe/n auf eine passive Haltung reduziere. Im
Vergleich zum Vorjahr wurde die Kategorie Ausflüge als neue Kategorie aufgenommen, welches ein
konsumorientiertes Angebot darstellt.
Aufgrund der Raumsituation in Wollishofen konnten keine regelmässigen Angebote der OJA WoLei
durchgeführt werden, was sich wiederrum negativ auf das Beziehungsnetz zu den Jugendlichen in
Wollishofen auswirkte. Dies stand möglicherweise auch im Zusammenhang mit einer tieferen
Bereitschaft zur Freiwilligenarbeit.
Zusätzlich erschwerend wirkte sich der Zeitfaktor von 45 Minuten dieser Schulworkshops aus. In 45
Minuten eine Beziehung zu den Jugendlichen aufzubauen und dazu noch ihre Bedürfnisse
aufzunehmen und zusammen mit ihnen daraus Angebote zu entwickeln, war ein sehr hochgestecktes
Ziel. Zudem befand sich die OJA WoLei bei der Durchführung dieser Schulworkshops in einem
Spannungsfeld zwischen einem Zwangskontext der Schule und der Freiwilligkeit der Offenen
Jugendarbeit.
62. P ROJEKTIDEE
Die OJA WoLei hat den Anspruch, partizipativ mit Jugendlichen Angebote zu gestalten, die ihrer
Lebenswelt und Bedürfnissen entsprechen. Um diese Bedürfnisse abzuholen, bedarf es einer
passenden Erhebungsmethode. Eine bereits bestehende Beziehung zu den Jugendlichen begünstigt
dabei eine Erfragung dieser und wirkt sich positiv auf die Freiwilligenarbeit aus. Um den Zwangskontext
zu umgehen, zielt das Projekt auf die Freiwilligkeit der Teilnehmenden. Das von der Projektleitung (PL)
geplante Autorenprojekt beinhaltet eine alternative, für die OJA WoLei neue
Bedarfserhebungsmethode, welche möglichst viele Jugendliche erreicht und im freiwilligen Kontext
stattfindet (Alex Willener, 2007, S. 42). Zudem soll durch das Projekt der Beziehungsaufbau mit den
Jugendlichen gefördert werden.
3. S ITUATIONSANALYSE
Bei der Situationsanalyse wurde durch die Projektleitung (PL) in verschiedenen Bereichen recherchiert.
Die Stakeholderanalyse brachte wichtige Erkenntnisse über die verfügbaren Ressourcen, aber auch
über die möglichen Stolpersteine, für das Projekt. Durch die Auseinandersetzung mit Fachliteratur
wurde von der PL eine wichtige fachliche Basis bezüglich unterschiedlichen
Bedarfserhebungsmethoden gelegt. Dank verschiedenen informellen Gesprächen und einer
Dokumentenanalyse gewann die PL Wissen über weitere Tools und zusätzliche Möglichkeiten von
Bedarfserhebungsmethoden. Der fachliche Diskurs mit der Praxisanleitung (PA) sowie dem Team
ermöglichte einen angeregten Austausch über die Ziele und Wirkungen, aber auch der Realisierbarkeit
der verschiedenen Bedarfserhebungsmethoden. Durch den anschliessenden Austausch mit einem
Stellenleiter und einer Stellenleiterin, in Form von Expert_inneninterviews, erhielt die PL weitere
wichtige Erkenntnisse über die Bedarfserhebungsmethoden in anderen OJAs. Zudem konnten die
bisherigen Erkenntnisse mit den Expert_innen besprochen werden.
Die Erkenntnisse aus der Situationsanalyse wurden anschliessend mit dem Team besprochen.
Aufgrund der vorhandenen Zeit- und Personalressourcen sowie der beschränkten Anzahl an
Jugendlichen in der definierten Zielgruppe, entschied sich die PL zusammen mit dem Team, nur eine
Bedarfserhebungsmethode durchzuführen. Um die definierte Zielgruppe adressat_innengerecht zu
erreichen, entschied sich die PL und das Team, eine Online-Umfrage durchzuführen. Wie aus der
Ausgangslage hervorging und bei der Situationsanalyse bestätigt wurde, war der persönliche Kontakt
zu den Jugendlichen von grosser Bedeutung. Durch Gespräche mit der Schulleitung des
Oberstufenschulhauses in Wollishofen erhielt die PL die Möglichkeit, die Umfrage im Ein- und
7Ausgangsbereich der Schule durchzuführen. Dies gewährleistete einen direkten, persönlichen Kontakt
sowie die Erreichbarkeit vieler Jugendlichen.
4. Z IELE
4.1. D EFINITION DER Z IELGRUPPE
4.1.1. P RIMÄRE Z IELGRUPPE
Aufgrund der Ausgangslage und der anschliessenden Situationsanalyse wurden durch die PL und dem
Team der OJA WoLei die Zielgruppen sowie die Ziele mit ihren angestrebten Wirkungen definiert.
Die primäre Zielgruppe besteht aus allen Jugendlichen, welche das Sekundarschulhaus Hans Asper in
Wollishofen besuchen. Bei der Durchführung der Umfrage waren dies 183 Schüler_innen. Bei den
potentiellen Teilnehmenden wird auf eine Geschlechter- sowie Klassenausgeglichenheit (1.-3. Sek)
geachtet. Der Fokus wird bewusst auf Wollishofen gelegt, da die OJA in Leimbach durch das Angebot
der offenen Turnhalle und des Jugendtreffs präsenter ist und dadurch die stärkeren Beziehungen
pflegt.
4.1.2. S EKUNDÄRE Z IELGRUPPE
Die sekundäre Zielgruppe besteht aus sämtlichen Jugendlichen zwischen 12 und 16 Jahren, die in
Wollishofen wohnhaft sind, jedoch nicht im Quartier zur Schule gehen. Gemäss dem Quartierspiegel
der Stadt Zürich sind rund 550 Jugendliche im Alter zwischen 12 und 16 Jahren in Wollishofen wohnhaft
(Quartierspiegel Wollishofen, 2014). Nach Abzug der primären Zielgruppe wären dies ca. 370
Jugendliche in der sekundären Zielgruppe.
4.2. Z IELBAUM
Vision
Die OJA Wollishofen & Leimbach kennt die Bedürfnisse der Jugendlichen, gestaltet ihre Angebote
danach und setzt diese nach Möglichkeit partizipativ mit ihnen um.
Hauptziel
Die OJA Wollishofen setzt im Freiwilligenkontext eine alternative Bedarfserhebungsmethode um und
veranstaltet partizipativ mit den Jugendlichen einen Anlass, bei welchem die Resultate präsentiert
werden und eine Aktivierung der Jugendlichen stattfindet.
Leistungsziel 1
Die OJA setzt eine alternative Bedarfserhebungsmethode um.
8Indikatoren
- Es nehmen mindestens 100 Personen an der Umfrage teil.
- Die Umfrage wird im ausserschulischen Kontext umgesetzt.
- Die Teilnahme an der Umfrage ist freiwillig.
Wirkungsziel 1
Die OJA WoLei verfügt über ein neues Instrument zur Erhebung der Bedürfnisse der Jugendlichen und
kennt deren Bedürfnisse und Lebenswelt.
Indikatoren
- Das Projekt ist detailliert dokumentiert.
- Der Zugang zu den Dokumenten steht allen Mitarbeitenden der OJA WoLei zur Verfügung.
- Der Miteinbezug von allen Mitarbeitenden der OJA WoLei ist gewährleistet.
- Die OJA WoLei erfragt die Jugendlichen nach ihren Wünschen bezüglich Freizeitaktivitäten mit
der OJA.
- Die OJA WoLei erfragt die Jugendlichen über ihre geografischen und digitalen Aufenthaltsorte
und die damit verbunden Aktivitäten.
Leistungsziel 2
Der Anlass ist partizipativ mit Jugendlichen umgesetzt.
Indikatoren
- Mindestens vier Jugendliche nehmen an Planungssitzungen teil, übernehmen Verantwortung
und engagieren sich während des Anlasses.
- Die Jugendlichen sind über die Möglichkeiten und Rahmenbedingungen aufgeklärt.
- Die Ideen der Jugendlichen werden umgesetzt.
Wirkungsziel 2
Die vier Kompetenzbereiche (Sozial-, Selbst-, Methoden- und Fachkompetenz) des
Organisationskomitees des Anlasses sind gefördert.
Indikatoren
- Das Organisationskomitee nimmt an Planungssitzungen teil, übernimmt Verantwortung und
engagiert sich während des Anlasses.
- Das Organisationskomitee lernt Kompromisse zu schliessen (Beobachtung durch die PL).
- Das Organisationskomitee gewinnt wichtige Erkenntnisse – Überprüfung durch die PL bei der
Evaluation mit dem Organisationskomitee.
9Leistungsziel 3
Erste Projekte mit den Jugendlichen sind aufgrund der Aktivierung geplant.
Indikatoren
- Informelle Gespräche über die Realisierung von Projekten finden statt.
- Mindestens zwei Projekte werden an dem Anlass zusammen mit Jugendlichen initiiert.
Wirkungsziel 3
Die Selbstwirksamkeit der an der Umfrage teilnehmenden Jugendlichen ist gestärkt.
Indikatoren
- Die Jugendlichen sind über die geplanten Schritte des Projektes aufgeklärt.
- Die Antworten sind ernsthaft.
- Die Jugendlichen interessieren sich für die Umfrageresultate.
Um diese Zielgruppen, Ziele und Wirkungen zu erreichen, hat sich die PL zusammen mit dem Team der
OJA WoLei entschieden, eine Online-Befragung im ausserschulischen Kontext durchzuführen. Um den
Anreiz an der Umfrage teilzunehmen, zu erhöhen, wurden, an einer mit Jugendlichen partizipativ
organisierten Party, Preise verlost.
5. P ROJEKTORGANISATION
Die unten aufgeführte Darstellung gibt eine Übersicht, der am Projekt beteiligten Personen.
Abbildung 1: Projektorganisation (eigene Quelle)
106. Z EITPLANUNG
Die unten aufgeführte Darstellung gibt einen Überblick über die genaue Zeitplanung und Aufgaben der Projektbeteiligten.
Abbildung 2: Zeitplan (eigene Quelle)
117. U MSETZUNG
Nach der Erstellung des Konzeptes begann nach den Sommerferien die Ausarbeitung der Fragen für
die Online-Umfrage. Wie im Wirkungsziel 1 definiert, sollte das Projekt die Bedürfnisse der
Jugendlichen aus Wollishofen und deren Lebenswelt in Erfahrung bringen. Um diese möglichst
umfassend ergründen zu können, war es der PL wichtig, quantitative sowie qualitative Fragen zu
formulieren. Es wurde Wert daraufgelegt, einen lustvollen Fragebogen zu entwickeln, welcher es
zulässt, genügend Fragen zu stellen, ohne die Aufmerksamkeit der Befragten zu verlieren.
Nach Rolf Porst (2014) ist es eine unabdingbare Voraussetzung, einen entworfenen Fragebogen vor
der Hauptbefragung einem Pretest zu unterziehen (S. 190). Aufgrund dessen machte die PL nach der
Erstellung eines ersten Entwurfes des Fragebogens mit einigen Jugendlichen einen Pretest. Dieser
zielte darauf ab, die Verständlichkeit und die Art der Fragen zu überprüfen. Die ersten durchgeführten
Pretests zeigten der PL, dass die Fragen verständlich formuliert und die Art der Fragen lustvoll zu
beantworten waren, der Fragebogen für die Jugendlichen jedoch zu viel Zeit in Anspruch nahm.
Aufgrund dieser Erkenntnisse hat die PL ein, zwei Fragen rausgestrichen und nochmals weitere
Pretests mit anderen Jugendlichen durchgeführt. Auch bei diesen Pretests empfanden gewisse
Jugendliche den Fragebogen als zu lang, weshalb die PL, in Absprache mit dem Team der OJA WoLei,
die Reihenfolge der Fragen anpasste. Gemäss Porst hat diese eine grosse Auswirkung auf das
Antwortverhalten (S. 138). Zuerst zwei, drei einfache Fragen zum Einstieg, danach zwei, drei Fragen,
bei denen etwas mehr Denkleistung erforderlich ist und zum Schluss wieder einfachere Fragen. Bei
erneutem Pretest mit Jugendlichen, empfanden diese den Fragebogen nicht mehr als zu lang. Dass der
Fragebogen als lustvoll empfunden wurde, zeigte auch die Einschätzung der beanspruchten Zeit, um
den Fragebogen auszufüllen. Sie schätzten die Zeit auf zwei bis drei Minuten. In Wirklichkeit waren es
jedoch ca. zehn Minuten. Die PL befragte zudem vereinzelte Jugendliche, was für Verlosungspreise sie
attraktiv fänden. Die Antworten der Jungen und Mädchen hatten eine hohe Schnittmenge. Als Resultat
dieser Befragungen, wurden einen UE Boom Lautsprecher, eine Powerbank, ein Kopfhörer sowie zwei
Kinogutscheine zum Gewinn in Aussicht gestellt.
Während der Ausarbeitung des Fragebogens führte die PL Gespräche mit der Schulleitung des
Oberstufenschulhauses Hans Asper. Die Schulleitung war dem Projekt gegenüber von Beginn an sehr
wohlgesinnt. Dank ihrer Unterstützung war es möglich, die Umfrage im Ein- und Ausgangsbereich des
Schulhauses durchzuführen. Zudem unterstützte die Schule das Projekt mit infrastrukturellen
Ressourcen.
Dies ermöglichte die Online-Umfrage, in einem einladend eingerichteten Ein- und Ausgangsbereich
des Schulhauses, durchführen zu können.
12Beim Haupteingang des Schulhauses wurde eine
Sofalounge mit Stehtischen errichtet. Bei einer
Stellwand war der Projektverlauf mit den Preisen
dargestellt (siehe Abbildung 3). Eine OJA
Beachflag kennzeichnete den eingerichteten Ein-
und Ausgangsbereich. Während die einen
Jugendlichen bei den Stehtischen mit
Mitarbeitenden der OJA, mittels eines Tablets,
die Umfragen ausfüllten, spielten andere in der
Sofalounge Spiele. Während vier Wochen
wurden die Umfragen jeweils donnerstags und
freitags nach der Schule durchgeführt.
Nebst der Befragung der
Oberstufenschüler_innen des Schulhauses Hans
Asper, wurden durch die PL auch Jugendliche,
welche nicht ins Schulhaus Hans Asper zur Schule
Abbildung 3: Umfrageaushang (eigene Quelle)
gehen, aber in Wollishofen wohnhaft sind, befragt. Die sekundäre Zielgruppe wurde via Whatsapp mit
einem Umfragelink angeschrieben. Der Adressstamm der sekundären Zielgruppe basierte auf den in
den 6. Klassworkshops erhaltenen Telefonnummern. Dies ermöglichte uns 109 Jugendliche
anzuschreiben, die in Wollishofen wohnen, jedoch nicht in Wollishofen zur Schule gehen.
Insgesamt nahmen 119 Jugendliche aus Wollishofen an der Umfrage teil. Davon waren 92 aus dem
Schulhaus Hans Asper und 27 aus anderen Schulhäusern, wie nahe an Wollishofen gelegene
Sekundarschulhäuser, Gymnasien oder Privatschulen.
Eine Analyse der Umfrageresultate ist im Kapitel 8.4. vorzufinden. Die detaillierten Antworten sind
dem Anhang zu entnehmen.
Weiter brachte die OJA WoLei in Erfahrung, welche Jugendlichen gerne die Verlosungsparty
mitorganisieren wollten. Von den 119 Teilnehmenden hatten 41 Jugendliche Interesse, den Anlass
mitzugestalten. Nach Abschluss der Umfrage schrieb die PL die 41 Jugendlichen via Whatsapp an, ob
sie noch interessiert sind, die Party mit zu organisieren. Die meisten Jugendlichen hatten zwar noch
Interesse, waren jedoch mit Prüfungen und Projekten bereits zu fest in der Schule eingebunden, um
13noch Zeit zu finden, sich in ihrer Freizeit freiwillig zu engagieren. So resultierte ein
Partyorganisationsteam mit drei Jugendlichen.
Während vier Treffen wurde die Party von drei Jugendlichen, mit der Unterstützung von der PL,
vorbereitet. Beim ersten Treffen informierte die PL das Organisationskomitee der Party über das
gesamte Projekt und die Gestaltungs- und Mitwirkungsmöglichkeiten des Organisationskomitees. Im
Sinne einer verkürzten Zukunftswerkstatt erfragte die PL das Organisationskomitee nach ihren
Wünschen und Ideen für die Party, losgelöst von der Realisierbarkeit. In einer anschliessenden
Diskussion tauschte man sich über die Realisierbarkeit der vielen gesammelten Wünschen und Ideen
aus. Aufgrund der Anzahl an Mitorganisierenden machte die PL die Jugendlichen darauf aufmerksam,
das Angebot den Möglichkeiten der Mitorganisierenden und Helfenden anzupassen. Ohne bereits
erste Ideen zu verwerfen, wurden die Zuständigkeiten der Aufgaben, den Präferenzen der
Jugendlichen entsprechend, zugeteilt. Beim ersten Treffen nahmen sich zwei Jugendliche des Designs
des Flyers an und ein Jugendlicher begann erste Lieder einer Playlist hinzuzufügen. Abschliessend zum
ersten Treffen, motivierte die PL das Organisationskomitee weitere Jugendliche anzufragen, um
möglichst viele Ideen von ihnen umsetzen zu können.
Beim zweiten Treffen einigte sich das
Organisationskomitee, welche Ideen konkret
umgesetzt werden. Da sie keine weiteren
Organisator_innen oder Helfer_innen für die Party
gewinnen konnten, einigten sie sich darauf, das
Angebot zu reduzieren: ein DJ und zwei an der Bar.
An der Bar soll es Snacks und alkoholfreie Cocktails
geben. Nachdem das Organisationskomitee den Preis
für die Cocktails festgesetzt hatte, wurden der Flyer
und die Playlist fertiggestellt.
In der folgenden Woche wurde die Party durch das
Organisationskomitee und der PL, mit Unterstützung
des Teams der OJA WoLei, bei Pausenplatzaktionen
in Wollishofen und Leimbach mittels Flyer beworben.
Bei den Treffen drei und vier wurden verschiedene
Rezepte von Cocktails rausgesucht und getestet
sowie den Einkauf für die Party getätigt. Abbildung 4: Flyer Abschlussanlass (eigene Quelle)
Zur Erinnerung erhielten einen Tag vor der Party sämtliche Jugendliche, welche an der Umfrage
teilgenommen haben, eine Whatsapp-Nachricht mit Informationen zum Event und der Verlosung.
14Die Party wurde von ca. 50 Jugendlichen, vorwiegend aus Wollishofen, besucht. Eine detaillierte
Evaluation der gesamten Umsetzung wird im folgenden Kapitel vorgenommen.
8. E VALUATION
In diesem Kapitel werden die Methoden der Evaluation aufgezeigt und reflektiert sowie die
Zielerreichung und deren Wirkung überprüft. Zudem wird das Projekt in Bezug auf die Partizipation,
die Aufbau- und Ablauforganisation, die gesellschaftliche Differenzierung sowie auf die Nachhaltigkeit
ausgewertet.
Eine Projektauswertung kann und soll laut Alex Willener (2007) auf zwei Arten erfolgen: einerseits
laufend, durch Zwischenauswertungen, welche der Steuerung, Korrektur, Optimierung oder als
Grundlage, für den Entscheid das Projekt weiterzuführen, dienen; andererseits am Ende gesamthaft
(S.218).
Folgende Darstellung gibt einen Überblick über die angewendeten Evaluationsmethoden.
Abbildung 5: Evaluationsdesign (eigene Quelle)
158.1. Z IELERREICHUNG
Die einzelnen Ziele und Wirkungen werden aufgrund ihrer Indikatoren überprüft.
Leistungsziel 1
Die OJA setzt eine alternative Bedarfserhebungsmethode um.
Indikatoren
- Es nehmen mindestens 100 Personen an der Umfrage teil.
- Die Umfrage wird im ausserschulischen Kontext umgesetzt.
- Die Teilnahme an der Umfrage ist freiwillig.
An der Umfrage haben 119 Jugendliche aus Wollishofen teilgenommen. Die Umfrage wurde zwar zu
einem grossen Teil im Schulhaus Hans Asper umgesetzt, jedoch nicht während des Schulunterrichts. In
diesem Setting, wie auch durch die Möglichkeit via Whatsapp an der Umfrage teilzunehmen, war die
Freiwilligkeit gegeben. Die Erhebung erfolgte per Online-Umfrage, was für die OJA WoLei neu war.
Somit wurde das Leistungsziel 1 vollumfänglich erreicht.
Wirkungsziel 1
Die OJA WoLei verfügt über ein neues Instrument zur Erhebung der Bedürfnisse der Jugendlichen und
kennt deren Bedürfnisse und Lebenswelt.
Indikatoren
- Das Projekt ist detailliert dokumentiert.
- Der Zugang zu den Dokumenten steht allen Mitarbeitenden der OJA WoLei zur Verfügung.
- Der Miteinbezug von allen Mitarbeitenden der OJA WoLei ist gewährleistet.
- Die OJA WoLei erfragt die Jugendlichen nach ihren Wünschen bezüglich Freizeitaktivitäten mit
der OJA.
- Die OJA WoLei erfragt die Jugendlichen über ihre geografischen und digitalen Aufenthaltsorte
und die damit verbunden Aktivitäten.
Die Dokumentation des Projektes ist durch die Erstellung eines detaillierten Projektberichts gesichert.
Der Projektbericht ist auf dem internen Server der OJA WoLei abgelegt und für alle Mitarbeitende der
OJA WoLei zugänglich. Beim Projekt waren alle Mitarbeitenden der OJA WoLei von der
Konzeptionsphase bis zur Evaluation involviert. Wie im Anhang dem Fragebogen zu entnehmen ist,
16wurden die Jugendlichen über ihre Wünsche bezüglich ihrer Freizeitaktivitäten mit der OJA sowie über
ihre geografischen und digitalen Aufenthaltsorte und ihre damit verbundenen Aktivitäten befragt.
Für eine noch detailliertere Dokumentation wären Impressionen auf Foto oder Video festgehalten
wünschenswert gewesen. Ansonsten wurde das Wirkungsziel 1 erreicht.
Leistungsziel 2
Der Anlass ist partizipativ mit Jugendlichen umgesetzt.
Indikatoren
- Mindestens vier Jugendliche nehmen an Planungssitzungen teil, übernehmen Verantwortung
und engagieren sich während des Anlasses.
- Die Jugendlichen sind über die Möglichkeiten und Rahmenbedingungen aufgeklärt.
- Die Ideen der Jugendlichen werden umgesetzt.
Das Organisationsteam des Anlasses bestand aus drei Jugendlichen. Die Jugendlichen wurden bei der
ersten Sitzung über ihre Möglichkeiten und Rahmenbedingungen aufgeklärt. Aufgrund dessen setzten
sie, ihren Ressourcen entsprechend, ihre Ideen um. 41 Jugendliche zeigten bei der Umfrage Interesse,
den Anlass mitzuorganisieren. Trotz den 41 Interessierten, waren es am Schluss nur drei Jugendliche,
die den Anlass geplant und umgesetzt hatten. Eine Ursache für die tiefe Beteiligung war die fehlende
Zeit neben der Schule. Speziell im Dezember sei die Belastung in der Schule sehr hoch, erklärten viele
Jugendliche. Vielleicht hätten einige von den 41 Jugendlichen, das Häkchen nicht bei „Interessiert
mitzuorganisieren“ gesetzt, wenn sie den Fragebogen alleine, ohne unsere Anwesenheit, ausgefüllt
hätten. Zudem stellten wir in der Vergangenheit schon fest, dass Jugendliche, zu denen wir bereits
eine Beziehung pflegen, sich eher freiwillig engagieren, als Jugendliche, die wir noch nicht oder noch
nicht so gut kennen. Viele der 119 Befragten kannten wir nur sehr flüchtig oder noch nicht. Aufgrund
der geringen Anzahl organisierender Jugendlichen wurde das Leistungsziel 2 nur teilweise erreicht.
Wirkungsziel 2
Die vier Kompetenzbereiche (Sozial-, Selbst-, Methoden- und Fachkompetenz) des
Organisationskomitees des Anlasses sind gefördert.
Indikatoren
- Das Organisationskomitee nimmt an Planungssitzungen teil, übernehmen Verantwortung und
engagieren sich während des Anlasses.
- Das Organisationskomitee lernt Kompromisse zu schliessen (Beobachtung).
- Das Organisationskomitee gewinnt wichtige Erkenntnisse – Beobachtende Überprüfung bei der
Evaluation mit dem Organisationskomitee.
17Das Organisationskomitee nahm an sämtlichen vereinbarten Terminen teil, zeigte dadurch eine hohe
Verbindlichkeit und Übernahme von Verantwortung. Die Jugendlichen leisteten nicht nur bei den
Vorbereitungssitzungen, sondern auch während des Anlasses grossen Einsatz. Zu dritt eine Party für
50 Jugendliche zu organisieren und umzusetzen bedingte ein sehr grosses Engagement. Die
Planungsphase war auch geprägt von Aushandlungsprozessen, da nicht alle Ideen umgesetzt werden
konnten. Dies erforderte von sämtlichen Jugendlichen, Kompromisse einzugehen. Die PL stellte dabei
fest, dass diese Kompromissbereitschaft nicht bei allen Jugendlichen gleich hoch war. Durch die
Einnahme der Vermittlungsposition gelang es der PL, die Kompromissbereitschaft sämtlicher
Beteiligten herzustellen und dadurch gemeinsame Lösungen zu erschliessen. Mittels der „Feedback-
Hand“-Methode hat die PL eine Schlussauswertung mit dem Organisationskomitee durchgeführt.
Aussagen wie: „Man sollte immer abklären, ob irgendwo in der Nähe gleichzeitig eine
Konkurrenzveranstaltung stattfindet“ oder „Das nächste Mal müssen wir früher Werbung machen“
oder „Mehr Deko wäre fürs Ambiente gut gewesen“, zeigten der PL, dass das Organisationskomitee
wichtige Erkenntnisse gewonnen hat. Ein Jugendlicher sagte, dass er viel über Cocktails gelernt habe,
da er zuvor noch nie selber Cocktails mixte. Das Wirkungsziel 2 wurde somit erreicht.
Leistungsziel 3
Erste Projekte mit den Jugendlichen sind aufgrund der Aktivierung geplant.
Indikatoren
- Informelle Gespräche über die Realisierung von Projekten finden statt.
- Mindestens zwei Projekte werden an dem Anlass zusammen mit Jugendlichen initiiert.
Während dem Anlass wurden mehrere informelle Gespräche über potentielle Anlässe mit
verschiedenen Jugendlichen und Gruppen geführt. Einigen Jugendlichen war die OJA noch nicht
bekannt und zeigten grosses Interesse, wie man eine Veranstaltung oder ein Projekt mit der OJA
realisieren könnte. Ideen wie eine Hallenbadparty, einen Backnachmittag oder eine Party wurden
während dem Anlass besprochen. Eine Projektgruppe wurde noch nicht erstellt und einen konkreten
Termin, um eine Veranstaltung zu planen, wurde nicht vereinbart. Dieses Leistungsziel wurde folglich
nur teilweise erreicht.
Wirkungsziel 3
Die Selbstwirksamkeit der an der Umfrage teilnehmenden Jugendlichen ist gestärkt.
Indikatoren
- Die Jugendlichen sind über die geplanten Schritte des Projektes aufgeklärt.
- Die Antworten sind ernsthaft.
18- Die Jugendlichen interessieren sich für die Umfrageresultate.
Bei den Umfragen im Schulhaus Hans Asper wurden die Jugendlichen über die geplanten Schritte und
ihre Partizipationsmöglichkeiten informiert. Die Jugendlichen, welche per Whatsapp angeschrieben
wurden, wurden prägnant über das Projekt aufgeklärt. Da die Umfragen im Schulhaus von einer
Jugendarbeiterin oder einem Jugendarbeiter mit jeweils einer Jugendlichen oder einem Jugendlichen
durchgeführt wurden, kann davon ausgegangen werden, dass die Antworten der Wahrheit
entsprechen. Bei den Teilnehmenden via Whatsapp kann aufgrund der Antworten ebenfalls davon
ausgegangen werden, dass diese seriös gemacht wurden. Die Umfrageresultate waren in einem
separaten Raum ausgestellt. Der Zulauf der Jugendlichen und die stattgefundenen Gespräche
verweisen auf ein grosses Interesse an den Resultaten. Diese Erkenntnisse zeigen, dass auch das
Wirkungsziel 3 erreicht wurde.
Aufgrund der Erreichung sämtlicher Leistungs- und Wirkungszielen wurde auch das angestrebte
Hauptziel, wie oben bei der Zieldefinition (Kapitel 4), erreicht.
8.2. P ARTIZIPATION
Das Projekt liess für verschiedene Akteur_innen unterschiedliche Partizipationsmöglichkeiten zu. Nach
dem Partizipationsstufenmodell von Maria Lüthringhaus (2000, zit. in Alex Willener, 2007, S. 66-68)
werden die unterschiedlichen Partizipationsformen der einzelnen Akteur_innen folgend evaluiert.
19Abbildung 6: Partizipation (eigene Quelle)
20Der Informationsfluss der Stufe 1 war für sämtliche Beteiligte gewährleistet. Wie bereits oben
beschrieben, wirkten drei Jugendliche bei der, auf die Umfrage gefolgte, Party mit und entschieden
über die wesentlichsten Bestandteile der Party. Auch wirkten verschiedene Jugendliche bei der
Ausgestaltung des Fragebogens und der Bestimmung der Preise mit. Durch den laufenden Austausch
mit dem Team der OJA WoLei sowie der Stellenleitung wirkten diese auf die Entscheidungen der PL
mit. Die Stellenleitung sowie die Geschäftsleitung stand der PL jederzeit als beratende Instanz zur
Verfügung und zeigte sich mit den gefällten Entscheidungen einverstanden.
Da die Finanzierung des Projektes eine zentrale Rolle spielte, war es wichtig, die Vorgesetzten als erste
Instanz in dieses Projekt miteinzubeziehen. Anschliessend bildete die Mitwirkung der Schule ein
Grundstein für das Gelingen des Projekts. Aufbauend auf diesem, war es wichtig und gut die
Jugendlichen detailliert über das Projekt und ihre Partizipationsmöglichkeiten aufzuklären. Um
überhaupt eine adressat_innengerechte Umfrage durchzuführen, war es auch entscheidend, die
Jugendlichen im Vorfeld miteinzubeziehen und mitentscheiden zu lassen. Weiter war der regelmässige
Austausch mit dem Team gewinnbringend und förderte die Identifikation des gesamten Teams mit
dem Projekt.
8.3. A UFBAU - UND A BLAUFORGANISATION
Folgend werden die wichtigsten Aspekte in Bezug auf die Aufbau- sowie der Ablauforganisation
evaluiert. Dies wird in die zwei Teilbereiche Umfrage und Veranstaltung unterteilt.
8.3.1. U MFRAGE
Das Projekt „Bedarfsanalyse Wollishofen“ beinhaltete zwei Projekte in einem. Zum einen die Online-
Umfrage, welche die Bedürfnisse der Jugendlichen in Bezug auf die OJA sowie ihre Lebenswelt erhob.
Zum anderen die Planung und Umsetzung des Abschlussanlasses mit und für Jugendliche. Im folgenden
Abschnitt wird die Projektorganisation der Online-Umfrage evaluiert.
Die Schlussevaluation mit dem Team der OJA WoLei zeigte, dass die Zusammenarbeit und die
Partizipationsmöglichkeiten für alle Beteiligten zur vollsten Zufriedenheit ausfielen. Die
Schlussevaluation mit dem Team der OJA WoLei war unterteilt in die Bereiche
Zusammenarbeit/Partizipation, Planung (Umfrage & Party), Umsetzung (Umfrage & Party),
Wirkung/Lerngewinn (Jugendliche & Team) sowie Zufriedenheit allgemein.
Das Team fühlte sich durch die PL immer gut informiert und miteinbezogen. Die transparente und
stetige Kommunikation seitens der PL waren hierbei sicherlich förderliche Faktoren. Die regelmässigen
und gut vorbereiteten Sitzungen wurden hierbei positiv erwähnt. Auch wurden die gemeinsamen
21Brainstorming-Sitzungen sehr geschätzt. Gemäss den Feedbacks des Teams war es für sie hilfreich
anhand der gesetzten Ziele, Ideen für das Projekt mitzuentwickeln. Der Einbezug des Teams von Beginn
des Projekts steigerte die Identifikation des Teams mit dem Projekt.
Die Planung der Umfrage wurde durch die PL vorgenommen. Eine Zeitplanung mit genügend Reserven
erleichterte der PL die Planung der Umfrage. Dadurch konnte die Umfrage zum geplanten Zeitpunkt
durchgeführt werden. Um einen Fragebogen für Jugendliche zu entwickeln, war es eminent, die
Jugendlichen in die Ausarbeitung des Fragebogens miteinzubeziehen. Dank den wertvollen Inputs der
Jugendlichen, konnte ein adressat_innengerechter Fragebogen erstellt werden.
Um ein solches Projekt in einem freiwilligen Kontext umsetzen zu können und dabei möglichst viele
Jugendliche zu erreichen, war die Zusammenarbeit mit der Schule von grosser Wichtigkeit. Dank der
Schulleitung des Schulhaus Hans Asper war es möglich das Projekt im Ein- und Ausgangsbereich der
Schule umzusetzen und so möglichst viele Schüler_innen in einem freiwilligen Setting zu erreichen. Bei
der Erstellung des Projektkonzepts wurde damit gerechnet, einen Teil des Projektes in der Schule
umsetzen zu können, ohne mit dieser diesbezüglich bereits in Kontakt getreten zu sein. Dies war ein
bewusster Entscheid der PL, da zur Zeit der Erstellung des Konzeptes, die Arbeitsbelastung in der
Schule besonders hoch war. Durch die gute Zusammenarbeit mit der Schule in der Vergangenheit, ging
die PL davon aus, dieses Projekt wie geplant umsetzen zu können. Diese Annahme war jedoch eine
Unsicherheit, die es auszuhalten gab. Ein negativer Bescheid der Schule hätte grosse Auswirkungen
auf das Konzept und die gesetzten Ziele gehabt.
Das Interesse der Schüler_innen war von Beginn an gross. Das Interesse galt jedoch nicht primär der
Umfrage, sondern mehr den zu gewinnenden Preisen. Dies erstaunte jedoch nicht sonderlich. Wie Rolf
Dobelli (2014) in seinem Buch, die Kunst des klaren Denkens, festhält, reagieren Menschen auf
Anreizsysteme und ändern ihr Verhalten. Wichtig dabei sei, dass Absicht und Anreiz sich gut decken
(S. 69-70).
Aus Sicht der PL konnte dank dieses Anreizsystems eine hohe Beteiligungsrate sichergestellt werden.
Der PL strebte dabei auch eine möglichst hohe Gender- sowie Klassenausgeglichenheit (1.-3. Sek) an.
Wichtig dabei war auch eine Ausgeglichenheit von Sek A und Sek B Schüler_innen abzubilden. Nach
den ersten zwei Befragungsnachmittagen zog die PL, zusammen mit dem Team, eine erste
Zwischenbilanz. Diese zeigte, dass deutlich mehr Sek A Schüler_innen teilnahmen. Durch das
Nachfragen bei den Schüler_innen nach den Gründen, stellte sich heraus, dass viele Sek B
Schüler_innen den hinteren Ein- und Ausgang benützten. Folglich bot die PL mehr Mitarbeitende auf.
Dadurch konnte man beide Ein- und Ausgängen abdecken. Durch ein vorgängiges Abklären dieses
Umstandes hätte die PL dies in die Einsatzplanung der Mitarbeitenden fliessen lassen können und von
22Beginn an Sek A und Sek B Schüler_innen erreichen können. Immerhin konnte durch die von Willener
vorgeschlagene Zwischenauswertung des Projektes eine wichtige Korrektur vorgenommen werden.
Nach Abschluss der Umfrage wurde die Auswertung der digitalen Daten durch die PL vorgenommen.
Wie im Anhang aus den Resultaten zu entnehmen ist, waren die Antworten sehr divers. Die PL erstellte
aus den Daten für jede Frage ein Balkendiagramm mit den Antworten, die mindestens zweimal
genannt wurden. Um die Antworten abzubilden, welche nur einmal genannt wurden, erstellte die PL
mittels der Homepage www.wordart.com eine Word Cloud. Diese Arbeit stellte sich als besonders
zeitintensiv heraus und wurde von der PL etwas unterschätzt. Es bedurfte eines grossen Aufwands, um
einerseits die Gross- und Kleinschreibung zu korrigieren und anderseits die Rechtschreibfehler
auszumerzen. Zudem mussten Antworten, die dasselbe meinten, jedoch anders formuliert wurden,
miteinander angeglichen werden.
Aufgrund der kritischen Reflexion der PL, wurde festgestellt, dass man diesen Aufwand, durch eine
bessere Instruktion der Befragenden hätte reduzieren können: beispielsweise klar instruieren, dass
alle Antworten mit einem Grossbuchstaben beginnen sollen und auf die Rechtschreibung geachtet
werden soll; oder als weiteres Beispiel, auf die Frage: „Was machst du gerne in deiner Freizeit?“,
anstatt Antworten wie: abmachen, rausgehen, mich mit Kollegen treffen, etc, sich von Beginn an auf
einen festen Begriff einigen, wie: Freunde treffen. Auch war es zum Teil schwierig zu verstehen, was
mit einer Antwort genau gemeint ist. Dort hätte man besser nachfragen müssen, was sie genau
meinen. Beispielsweise auf die Frage, was sie mit der OJA gerne machen würden, war eine Antwort:
Fantreffen. Mit Nachfragen hätte man eruieren können, welches Fantreffen genau gemeint ist.
8.3.2. A BSCHLUSSVERANSTALTUNG
Bei der Erstellung des Konzeptes und dem damit verbunden Zeitplan hatte die PL frühzeitig den Raum
für die Abschlussveranstaltung vom 15. Dezember 2018 beim Gemeinschaftszentrum (GZ) Wollishofen
reserviert. Da dieser Raum des GZ der einzig grössere Veranstaltungsraum in Wollishofen ist und oft
von Quartierbewohner_innen gemietet wird, war es wichtig, diesen frühzeitig zu reservieren.
Ansonsten hätte man auf den eigenen, kleineren Raum, in Leimbach ausweichen müssen.
Über die Organisation und die Gestaltung des Abschlussanlasses bestimmte, mit der Unterstützung
durch die PL, das Organisationskomitee. Die Bildung dieses wurde oben bereits beschrieben und
reflektiert. Das Organisationskomitee setzte sich zusammen aus einem 2. Sek B Schüler aus dem
Schulhaus Hans Asper, einem Sek3 Schüler sowie einem Schüler aus einer integrativen Schule
ausserhalb von Wollishofen. Die Gruppendynamik des Organisationskomitees zeigte sich
entsprechend anspruchsvoll.
23Während der Organisation des Anlasses gab es ein, zwei offene Interessenskonflikte, die durch die PL
gelöst werden mussten. Einerseits musste die PL auf der Ebene der Arbeitsorganisation, des Verhaltens
wie aber auch auf der Ebene der Rollen der Jugendlichen untereinander in der Vermittlungsposition
steuernd eingreifen. In Eskalationsstufen nach Glasl (2008) gesprochen, befanden sich die Konflikte
auf der Stufe 1 oder 2 (S. 141-155). Entsprechend waren diese Konflikte durch eine vermittelnde Rolle
durch die PL lösbar. Dank der Lenkung der PL und deren gezielten Förderung der Ressourcen der
einzelnen Mitglieder des Organisationskomitees gelang es den Jugendlichen, sich auf den Prozess
einzulassen und gemeinsam eine Party zu organisieren.
Die gemeinsame Schlussevaluation mit dem Organisationskomitee zeigte, dass dieses mit dem Anlass
grundsätzlich zufrieden war. Bei der Zielerreichung wurden bereits einige Erkenntnisse des
Organisationskomitees beschrieben. Darüber hinaus zeigten sich bei der Schlussevaluation noch
weitere Lerngewinne. Ein Jugendlicher sagte, dass er viel über die Zubereitung von alkoholfreien
Cocktails gelernt habe. Ein anderer erwähnte, dass er sein Wissen über die Erstellung von Flyern
erweitern konnte. Die angewandte 5 Finger Feedback-Methode erwies sich als sehr geeignet für die
Auswertung eines solchen Anlasses. Wichtig dabei war es, darauf zu achten, dass diese Reflexion jeder
für sich alleine machte, da es bei dieser Methode darum geht, die eigenen Erkenntnisse und
Lerngewinne festzuhalten, ohne Beeinflussung durch einen Freund oder eine Freundin.
Dieses Beispiel zeigt exemplarisch, wie die OJA WoLei ihren Bildungsauftrag versteht und wahrnimmt.
Im Positionspapier «Bildungsauftrag der OJA Zürich» sieht die OJA Zürich Bildung als ein zentrales
Element ihres Auftrages. Nebst der Schulbildung und der Berufsbildung erachtet die OJA die Bildung
in der Freizeit als eine wichtige «dritte Säule» für eine umfassende Bildung (OJA, 2017). Auch
wiederspiegelt dieses Beispiel die Zuschreibung von Albert Scherr (2002) bezüglich der Offenen
Jugendarbeit. Er beschreibt diese als subjektorientierte Bildung, welche «an den Erfahrungen,
Bedürfnissen und Interessen ihrer Adressat_innen ansetzt und darauf abzielt, sie zu einer bewussten
Gestaltung ihrer Lebenspraxis zu befähigen» (S. 94).
8.4. A NALYSE DER U MFRAGERESULTATE
Insgesamt nahmen 119 Jugendliche aus Wollishofen an der Umfrage teil. Das Geschlechterverhältnis
bei der Teilnahme war ausgeglichen. Von den 183 Schüler_innen des Schulhauses Hans Asper nahmen
92 an der Umfrage teil. Von diesen 92 Schüler_innen waren Sek A Schüler_innen eine leichte Mehrheit
gegenüber Sek B Schüler_innen. Davon besuchten 12 Schüler_innen die Sek3. Sek3 ist eine im
Schulhaus Hans Asper integrierte Sekundarschule für gehörlose und schwerhörige Jugendliche. Vom
Schulhaus Hans Asper nahmen verhältnismässig mehr Jugendliche aus der 1. und 2. Oberstufe an der
Umfrage teil.
24Wie in der Ausgangslage beschrieben, erweist sich die Beziehungspflege zu den Jugendlichen aufgrund
der Raumsituation als schwierig. Für die OJA WoLei sind deshalb die jährlich durchgeführten 6. Klass-
Schulworkshops über drei Lektionen, umso wichtiger. Da dieser Workshop bei den 1. und 2.
Sekschüler_innen näher zurückliegt als bei den 3. Sekschüler_innen, besteht dadurch ein noch
gefestigteres Beziehungsnetz zu den 1. und 2. Sek. Schüler_innen. Dies könnte ein Grund für eine
höhere Beteiligung von 1. und 2. Sekschüler_innen sein.
Von den 109 via Whatsapp angeschriebenen Jugendlichen nahmen 27 an der Umfrage teil. Viele dieser
Schüler_innen wohnen zwar in Wollishofen, halten sich aufgrund des geografischen Standorts ihrer
Schulen jedoch vermehrt ausserhalb des Quartiers auf. Deswegen, und wegen unserer fehlenden
Sichtbarkeit im Quartier, war es nur möglich, diese Jugendliche via Whatsapp zu erreichen. In
Anbetracht dieser Umstände übertraf diese Quote sogar die Erwartungen der PL. Die PL führt diese
unerwartet „hohe“ Whatsapp-Teilnehmerzahl auf die Preisverlosung zurück.
Die PL ist mit dem Rücklauf der Umfrage sehr zufrieden. Auch wenn im Verhältnis weniger 3.
Sekschüler_innen an der Umfrage teilnahmen, erzielte die Umfrage eine äusserst hohe
Ausgeglichenheit in Bezug auf Gender und Stufen. Diese Ausgeglichenheit und die hohe Beteiligung
ergab für die OJA WoLei eine repräsentative Schnittmenge der angestrebten Zielgruppe.
Wie in der Umsetzung erwähnt, wird folgend vertiefter auf die Umfrageresultate eingegangen.
Zum Einstieg wurden die Jugendlichen nach ihrem Lieblingsort im Sozialraum Wollishofen befragt.
Wenig erstaunlich war die meist genannte Antwort die Seepromenande. Erstaunlich war jedoch die
zweitmeist genannte Antwort, ihr Zuhause. Ebenfalls interessant zu sehen war, dass mehr als die Hälfte
der Befragten in einem oder mehreren Vereinen eingebunden sind. Auffällig dabei war die Breite an
Vereinen. Diese Diversität wiederspiegelte sich auch in der Beantwortung auf die Frage nach ihrer
Freizeitgestaltung. Auch wenn Freunde treffen die klare Nummer eins ist, gefolgt von Gamen und
Fussballspielen, wurden 56 Aktivitäten nur einmal genannt. Wenig erstaunlich waren die Ergebnisse
der Frage, was sie gerne mal ausprobieren möchten. Die Neurowissenschaftler, Kerstin Konrad,
Christine Firk und Peter J. Uhlhaas (2013), schreiben in ihrem Artikel zur Hirnentwicklung in der
Adoleszenz, dass das Verhalten von Jugendlichen oft durch eine höhere Risikobereitschaft
gekennzeichnet sei (S. 425). Entsprechend waren Bungee-Jumping und Fallschirmspringen sehr
beliebte Antworten bei den Jugendlichen. Erfreulich zu sehen, war der Fakt, dass die meisten
Jugendlichen ihre frei zu gestaltende Freizeit als genügend einstuften. Auffallend dabei war, dass das
Empfinden eine sehr individuelle Wahrnehmung ist und diese nicht an Klassen oder Stufen
festzumachen war, jedoch die Sek A - und Gymischüler_innnen, ihre Freizeit tendenziell als zu wenig
empfanden.
25In Bezug auf ihr Lieblingsessen wurde unser Erfahrungswissen durch die Umfrage bestätigt. Am
meisten genannt wurde Pizza. Der neuste Dokumentarfilm, Generation Selfie, von Vanessa Nikisch
(2019), belegt, dass Pizza das beliebteste Essen auf Instagram ist. Laut der James Studie der ZHAW
(2018) ist Instagram bei den 12-15-Jährigen das beliebteste App. Auch bei dieser Erhebung wurde
Instagram als beliebtestes App genannt. Beeindruckend ist zudem, dass lediglich 15% der Jugendlichen
keine Serien schauen und/oder keine Games spielen. Bei den konsumierten Serien zeigt sich eine
grosse Vielfalt. Nur gerade 15 von 102 schauen dieselbe Serie, Riverdale. Bei den Games ist hingegen
Fortnite das beliebteste Spiel.
Die Umfrage bildet eine sehr grosse Heterogenität ab. Viele Jugendliche sind in unterschiedlichsten
Vereinen aktiv. Die Freizeitgestaltung wiederspiegelt diese hohe Heterogenität. Als Gemeinsamkeit ist
klar festzumachen, dass sich die Jugendlichen gerne in der Peergroup aufhalten (Freunde treffen) und
sie dies vor allem zu Hause tun.
Ziel dieser Umfrage war es, nicht nur die Lebenswelt der Jugendlichen besser zu kennen, sondern auch
ihre Bedürfnisse im Allgemeinen sowie in Bezug auf die OJA WoLei. Das Interesse der Jugendlichen
über eine Freizeitgestaltung mit der OJA fällt sehr unterschiedlich aus. Einige kennen die OJA nicht sehr
gut, andere wiederum besser. Entsprechend sind schon Ideen und Wünsche vorhanden oder eben
auch weniger. Die Ideen und Wünsche sind sehr divers. Grösster Beliebtheit erfreuen sich Partys,
Graffiti-Workshops, Fussballturniere oder Backen. Es wurden jedoch viele Ideen nur von einzelnen
genannt. Insgesamt wurden 126 Ideen oder Wünsche für Angebote, Veranstaltungen oder Projekte
genannt.
8.5. N ACHHALTIGKEIT
Nachhaltigkeit in seiner Alltagsbedeutung, wie Willener (2007) es nennt, heisst so viel wie, etwas sollte
eine langandauernde oder dauerhafte Wirkung haben. Das sollte zu den Grundsätzen eines
soziokulturellen Projektes gehören (S. 101).
Auf der Ebene der individuellen Entwicklung der Adressat_innen wirken nach Willener (2007, S. 102)
nachhaltig die Erfahrung der Selbstwirksamkeit sowie der Wissenszuwachs und Lerngewinn des
Organisationskomitees. Dies wurde im Kapitel 8.1 beschrieben. Für das Team der OJA WoLei wirken
die gemeinsamen Zwischenauswertungen und die Schlussauswertung nachhaltig. Darüber hinaus hat
die Erstellung des Konzeptes und dieses Berichtes über das Projekt eine wichtige Funktion bezüglich
einer nachhaltigen Erkenntnis- und Wissenssicherung für das Team der OJA WoLei und der gesamten
OJA der Stadt Zürich. Aufgrund des positiven Feedbacks der Schule, der Schüler_innen sowie einer
positiven Schlussauswertung der OJA WoLei, ist die Grundlage für eine regelmässige Durchführung
dieser Form von Bedarfsanalyse, zumindest für die OJA WoLei, gegeben. Für eine nachhaltige Wirkung,
26welche über die bereits festgestellten Wirkungen hinausgeht, ist es entscheidend, wie mit den
gesammelten Daten weitergearbeitet wird.
8.6. I NTERVENTIONSPOSITIONEN
Gabi Hangartner (2010) beschreibt im Handlungsmodell der Soziokulturellen Animation (SKA) vier
unterschiedliche Interventionspositionen (S. 298). Im Rahmen dieses Projektes wurden durch die PL
alle vier Interventionspositionen eingenommen. Diese sind nachfolgend dargestellt und reflektiert.
Abbildung 7: Interventionspositionen (eigene Quelle)
279. P ROJEKTFINANZIERUNG
Abbildung 8: Projektfinanzierung (eigene Quelle)
28Die höher ausgefallenen Kosten sind damit zu erklären, dass die PL bei der Erstellung des Budgets
fälschlicherweise nur mit 120 Arbeitsstunden der PL kalkulierte, anstatt mit 180
Arbeitsaufwandstunden. Die PL ging davon aus, dass die Erstellung des Konzeptes als Arbeitsstunden
mitberechnet wird.
10. S CHLUSSFOLGERUNGEN /E MPFEHLUNGEN
Die PL sowie das Team der OJA WoLei können auf ein sehr gelungenes Projekt zurückblicken. Die
Zielsetzungen sowie die intendierten Wirkungen wurden bis auf wenige Ausnahmen vollumfänglich
erreicht. Aufgrund des detailliert erstellten Konzeptes der PL, konnte eine wichtige Basis für ein
erfolgreiches Projekt geschaffen werden. Insbesondere für dieses Projekt waren die
Auseinandersetzung mit Fachliteratur zum Thema und ein anschliessender Austausch mit
Fachpersonen in Form von Expert_inneninterviews aus der Praxis für die Wissens- und
Erkenntnisbildung wichtige Grundbausteine. Eine Online-Umfrage durchzuführen, welche nahe an der
Lebenswelt der Jugendlichen ist, erwies sich als zielführend. Dies unterstreicht auch die aktuelle James
Studie (2018), die besagt, dass 100% der Jugendlichen über ein Handy, 99% einen Computer oder
Laptop und 97% über einen Internetzugang verfügen und nutzen (S.18).
Dank der Kooperation mit der Schule und der uns gebotenen Möglichkeit, die Umfrage im Ein- und
Ausgangsbereiches des Schulhauses zu machen, war es überhaupt möglich diese Reichweite zu
erreichen, ohne uns in einem Klassensetting bewegen zu müssen. Dies stellte sicher, dass wir sämtliche
Jugendliche aus dem Schulhaus erreichten, ohne Verpflichtung dieser, an der Umfrage teilnehmen zu
müssen.
Von dem Freiwilligenkontext ausgehend, erwies sich das Anreizsystem über eine Verlosung von
Preisen, bei einer Teilnahme an der Umfrage, als wichtiger Bestandteil des Projekts. Es war zu
beobachten, dass vor allem Jugendliche, zu denen die OJA WoLei noch keine Beziehung pflegte, auf
dieses Anreizsystem ansprachen. Ohne dieses hätten viel weniger Schülerinnen und Schüler an der
Umfrage teilgenommen und entsprechend kleiner wäre die Aussagekraft der Umfrage gewesen.
Wichtig dabei war, die Umfrage mit den Jugendlichen «face to face» durchzuführen. Dies ermöglichte
einen Austausch mit den Jugendlichen. Denn das Pflegen und Knüpfen von Kontakten ist das
Elementarste für die Offene Arbeit mit Jugendlichen. Nach Marcel Spierz (1998) ist das
Kontakteknüpfen die erste Kernaufgabe der Soziokulturellen Arbeit (zit. in Hangartner, 2010, S. 296).
Zentral war auch der Einbezug der Jugendlichen in der Entstehungsphase des Fragebogens. Die
Pretests ermöglichten einen adressat_innen gerechten Fragebogen zu erarbeiten. Durch das Einbinden
der Jugendlichen bei der Preisgestaltung konnte sichergestellt werden, dass die verlosten Preise als
Anreizsystem auch ihre Wirkung zeigten.
29Sie können auch lesen