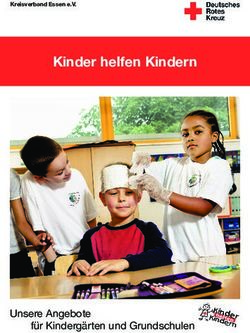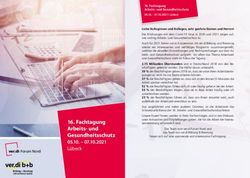Regionale Herausforderungen der Energiewende - Prof. Dr. Erik Gawel - Reklim
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Übersicht
Energie und Klima
Die Energiewende
• Ziele
• Rolle der Regionen
• Regionale Umsetzungs-Aspekte
Beispiele regionaler Herausforderungen
• Regionales Kosten-/Nutzenkalkül
• Landnutzungskonflikte
• Regionale Energiekonzepte
• Lokaler Widerstand
• Klimaanpassung im Energiesektor
FazitEnergie und Klima
Klimapolitischer „Schlüsselsektor“ Energie:
Mitigation: Mehr als 80 % der deutschen
Treibhausgasemissionen sind energiebedingt
→ primärer Stellhebel in der Klimapolitik
Energiekonzept der Bundesregierung: Hebung dieses
Potenzials durch weitgehende Dekarbonisierung
(-80/-95% bis 2050)
Relevanz auch für Anpassungsprozesse
Struktur des zukünftigen Energiesystems eher dezentral:
Regionale Ebene gewinnt an Bedeutung
→ Energiewende als Herausforderung und Chance für die
RegionenDie Energiewende
Substitution von Energieträgern:
Ausstieg aus der Atomenergie bis 2022
Ausbau erneuerbarer Energien
Zudem: Kompletter Systemumbau!
Steigerung der Energieeffizienz / Energieeinsparung
(-25% bis 2050 nach BReg)
Systemumbau: E-Mobilität, Netz- und Speicherausbau,
Komplementärkraftwerke, Demand-Side-Management, …Die Energiewende
Rolle der Regionen bei der Energiewende
Länder und Regionen zuständig für:
• Regionale Energiekonzepte
→ Nationale Ziele müssen heruntergebrochen und auf
Länder- und Regionalebene neu definiert werden
(ökonomisches Effizienzproblem)
• Raumordnung
• Standortplanung
→ Handlungsbedarf, aber auch Handlungsspielraum für
Regional- und LokalpolitikDie Energiewende
Regionale Aspekte
Deutliche Disparitäten des
EE-Anteils in den Ländern
Deutliche Disparitäten im
Trägermix = unterschiedliche
zeitliche Verfügbarkeit
→ höherer länderübergreifender
Stromtransfer als bisher:
Netzausbau notwendig
→ Alternative: verbrauchsnahe
Erzeugung?
(ähnlich: Speicherung vs.
Back-up-Kapazität)Die Energiewende Regionale Aspekte Regionale Erzeugungs-Disparität induziert beträchtliche Finanzflüsse zwischen den Ländern (EEG-Umlage) Momentan Bayern größter „Profiteur“, NRW „Netto- Zahler“ Sachsen/Thüringen als „Verlierer“? EEG-Finanzausgleich als vulgärökonomisches Konstrukt! Betrachtung weiterer Wertschöpfungsaspekte führt zu anderen Einschätzungen …
Bruttobeschäftigung Erneuerbare Energien
Die Energiewende pro 1000 Arbeitnehmer
Regionale Aspekte
Anteil der EE an Brutto-
beschäftigung auch in Sachsen
und Thüringen über dem
Bundesdurchschnitt
→ Partialbetrachtungen für
Gesamtbewertung unzulänglich!
→ Positive Gestaltung des
Gesamtbilds ist übergeordnete
regionale HerausforderungBeispiele regionaler Herausforderungen Abwägung von Kosten und Nutzen / Optimierung der Benefit- Cost-Ratio bei Aufbau von EE-Infrastruktur Landnutzungskonflikte Harmonisierung / Konsistenz regionaler Energiekonzepte Überwindung lokaler Widerstände (NIMBY)
Regionale Herausforderungen
Regionales Kosten-/ Nutzenkalkül
Lokaler Nutzen: Wertschöpfung durch z.B.
• Arbeitsplatzschaffung,
• Einkommensgenerierung,
• örtliches Steueraufkommen
Lokale Kosten:
• Geräusch- und Geruchsemissionen,
• Ästhetik,
• Landnutzungskonflikte
→ Ziel: Optimierung der Benefit-Cost-RatioRegionale Herausforderungen
Stellschrauben der Benefit-Cost-Ratio
Optimierung durch:
• Identifikation der Alternativen mit hoher Wertschöpfung vor
Ort:
Wertschöpfung Betrieb > Wertschöpfung Investition
Finanzierungsstruktur: höhere regionale Wertschöpfung
durch regionale Finanzierung
Regionaler Anlagenbetreiber = 100 % Gewerbesteuer
• Minimierung der Kosten:
Einbezug der Externalitäten in die Technologie- und
Standortwahl
Stakeholder-Partizipation zur Nutzung dezentralen
Kostenwissens und zur Senkung der ProtestkostenRegionale Herausforderungen
LandnutzungskonflikteHerausforderungen
Raumbedarf Erneuerbarer
bedingt Landnutzungskonflikte
Kulturlandschaften der Zukunft
= Energielandschaften?
Landnutzungskonflikte implizieren politische Trade-offs:
vs.?
Klimaschutz Naturschutz/Artenschutz
Reg. Wertschöpfung Biodiversität
Arbeitsplätze Landschaftsbild
Selbstversorgung Nahrungsmittelsicherheit
… …Regionale Herausforderungen
Regionale Energiekonzepte
Beispiel: 100%-Erneuerbare-Regionen
Beispiel Stadt Kalbe (Milde)
• Teil der Bioenergieregion Altmark
• Produziert 334% des eigenen Stromverbrauchs aus EE
• Überwiegend Windkraft (88%) von auswärtigen Investoren:
Gutteil der Wertschöpfung fließt aus der Region ab
Wie die meisten 100%-Regionen sehr geringe
Bevölkerungsdichte und geringe Flächenknappheit: für
Ballungszentren schwer umsetzbar („Rosinenpicken“)
100% Deckungsgrad ≠ Versorgungssicherheit / Autarkie
(z. B. überlokale Back-up-Kapazität)Regionale Herausforderungen
Regionale Energiekonzepte
Energieziele in den neuen Bundesländern bis 2020:
Brandenburg:
EE-Anteil am Primärenergieverbrauch: 20 % (Wind: 9,2 %, Solar: 1,8 %)
EE-Anteil am Bruttostromverbrauch: 90 %
Sachsen-Anhalt:
EE-Anteil am Primärenergieverbrauch: 20 %
EE-Anteil am Bruttostromverbrauch: 35 %
Sachsen:
EE-Anteil am Primärenergieverbrauch: k.A.
EE-Anteil am Bruttostromverbrauch: 33 %
Thüringen:
EE-Anteil am Primärenergieverbrauch: 30 %
EE-Anteil am Bruttostromverbrauch: 45 %
Mecklenburg-Vorpommern:
Keine relativen ZieleRegionale Herausforderungen
Regionale Energiekonzepte
Autonome Planung von Energiezielen auf regionaler Ebene
birgt Risiko der Inkonsistenz!
M-V 2012: Anteil EE am Stromverbrauch: 84 % (lt. BDEW)
dena: Vollständige Umsetzung der Länderziele:
Ökostromanteil in Deutschland 2020: 52-58 %
Ziel der Bundesregierung 2020 aber nur: 35 %
→ Diskrepanz zwischen Netzplanung des Bundes und EE-Ausbau
→ Harmonisierung auf übergeordneter (Länder- / Bundes-) Ebene
dringend notwendig!Regionale Herausforderungen
Lokaler Widerstand
Not In My Backyard
(NIMBY-Problem)
Ökonomisches Problem:
Verstoß gegen das
Prinzip der fiskalischen
Äquivalenz
Lokale Kosten,
überlokale Nutzen (Spillover)
Nutzen
Kosten
Entscheider Kosten Nutzen
EntscheiderRegionale Herausforderungen
Lokaler Widerstand
NIMBY in der Praxis:
• Die meisten Erneuerbaren
generell positiv bewertet.
• Aber lokaler Widerstand bei
konkreten Umsetzungsplänen vor Ort
Ist NIMBY nur ein wissenschaftliches Konstrukt?
• Einige Studien können keine Korrelation zwischen Nähe zum
Anlagenstandort und Widerstand feststellen.
• Aber: Ergebnisse möglicherweise verzerrt:
Sorge der Selbst-Brandmarkung der Befragten?Regionale Herausforderungen
Lokaler Widerstand – Beispiel Beelitz
Geplant: Windpark in Waldstück der Stadt Beelitz
Proteste von lokaler Bevölkerung und Wirtschaft:
Argumente:
• Entwertung der Grundstücke
• Existenzgefährdung einer örtlichen Klinik
• Störung der ökologischen Funktion des Waldes
• Waldbrandgefahr
• Störung von Flora und Fauna
Anwohner-Statement:
„Das Land Brandenburg und der Kreis Potsdam-Mittelmark hat genügend Flächen, die
ausgewiesen werden können […], aber nicht unmittelbar hier in unserer Gegend …“.Regionale Herausforderungen
Lokaler Widerstand
Empirie: Zustimmungskurve hat U-förmigen Verlauf:
Widerstand in der Umsetzungsphase am größten
→ hier Handlungsbedarf
Wie lässt sich Widerstand „berücksichtigen“?
• Frühzeitige Einbindung der Stakeholder
• Kommunikation der regionalen Vorteile
• Möglichkeit zur finanziellen Partizipation der Betroffenen
(Ownership)
Substitute für Infrastruktur beachten (Energieeinsparung,
verbrauchsnahe Erzeugung, Speicher, …)Regionale Herausforderungen
Klimaanpassung im Energiesektor
Anpassungsstrategie Sachsen-Anhalt:
Herausforderungen:
• Wetterextreme schaffen neue Herausforderungen:
Kühlwassermangel, Biomasse-Ernteausfälle, Sturmschäden
an Leitungen und Windrädern, …
• Nachfrageverhalten ändert sich infolge von Klimaänderung
Handlungsoptionen:
• Berücksichtigung von Extremereignissen bei
Standortplanung
• Ertüchtigung der Netze (Widerstandsfähigkeit ↑)
• Flexible Tarifstrukturen zum Lastspitzenausgleich
• Neubewertung der Energieversorgungsstrategie unter
Berücksichtigung aktueller KlimaszenarienFazit
Energiewende als herausragende Komponente der
Vermeidungsstrategie der Bundesregierung …
… relevant aber auch für die Klimaanpassung.
Dezentrale Energieversorgung: größere Bedeutung der
Regionen
Herausforderung, aber auch Chance für die Regionalpolitik
Ziel muss sein:
• Regionale Wertschöpfung
• Lösung von Landnutzungskonflikten / Politik-Trade-offs
• Überregionale Harmonisierung
• Lokale Widerstände „berücksichtigen“
• Wende als Fenster für Anpassung nutzenVielen Dank! www.ufz.de/economics
Sie können auch lesen