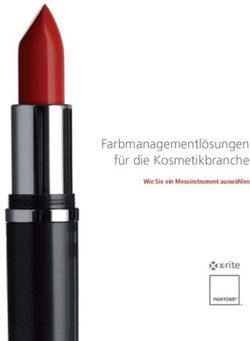Rote Listen Sachsen-Anhalt
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Rote Listen Sachsen-Anhalt
Berichte des Landesamtes 73 Dickkopffliegen
für Umweltschutz Sachsen-Anhalt (Diptera: Conopidae)
Halle, Heft 1/2020: 885–889
Bearbeitet von Matthias Jentzsch und Andreas Arnold wicht des Parasitoides beträgt etwa ein Viertel bis
(2. Fassung, Stand: Dezember 2018) ein Drittel der Körpermasse seines Wirtes, wodurch
das Wirtsspektrum auf Arten entsprechender Größe
Einführung eingeengt wird (Arnold 2011). Nicht zuletzt aufgrund
ihrer parasitoiden Reproduktion sind einige Arten der
Die in Deutschland heimischen Dickkopf- oder Bla- Conopidae recht selten und da auch ältere Daten nur
senkopffliegen sind kleine bis mittelgroße Fliegen von sehr regional vorliegen, ist eine Einschätzung des Ge-
3,5 bis 18 mm Länge. In Körperform und -zeichnung fährdungsgrades in Sachsen-Anhalt mit dem gegen-
erinnern viele Arten insbesondere der Unterfamilie wärtigen Kenntnisstand bei der Mehrzahl der Arten
Conopinae, weniger der Dalmanniinae und Myopinae, nur mit Vorbehalt möglich.
an Wespen oder wespenähnliche Schwebfliegen. Der
Kopf erscheint bei den meisten Arten relativ groß und Datengrundlagen
aufgeblasen. Ein weiteres Kennzeichen vieler Arten
der Familie ist ein meist mehr als kopflanger, ein- bis Die Faunistik der Dickkopffliegen ist in Deutschland
zweifach geknieter Rüssel, der in Ruhestellung zu- nach wie vor unzureichend untersucht, was aus der
sammengeklappt in einer rinnenförmigen Vertiefung natürlichen Seltenheit der meisten Arten resultiert.
des Kopfes liegt. Die Spitze der so genannten Analzel- Daher kommt es trotz intensiver Besammlung zu-
le reicht bei den meisten Arten bis zum Flügelhinter- meist nur zu relativ wenigen Nachweisen. Für das Ge-
rand. Bei den verschiedenen Arten mehr oder weniger biet der Bundesrepublik Deutschland werden aktuell
markant ist das weibliche Eiablage-Organ, die Theca. 54 Arten geführt, wovon bisher 39 (72 %) in Sachsen-
Die Imagines sind von April bis September bei Anhalt nachgewiesen wurden. Dies ist zum einen das
der Nahrungsaufnahme von Nektar an Blüten (vor Ergebnis der Entomofaunistik, zum anderen wurden
allem der Compositae, Labiatae und Umbelliferae), „Sammelarten“, die bei näherer Betrachtung jeweils
aber auch an anderen Aktivitätsplätzen ihrer Wirte mehrere Spezies vereinten, einer Revision unterzogen
(aculeate Hymenopteren wie Hummeln, Wespen, (Rivosecchi & Mei 1998, Kassebeer 1999, Schumann 2002,
Honigbienen und solitär lebende Bienenarten), wie Stuke 2002, Stuke & Clements 2005, Stuke 2006, Stuke
beispielsweise deren Tränken oder Nesteingängen, & Clements 2008, Mei & Stuke 2008), wodurch einige
anzutreffen. Wie viele ihrer erst zum Teil bekann- frühere Belege neu bewertet werden müssen. Den
ten Wirtsarten werden auch einige Dickkopffliegen vorgenannten Veröffentlichungen folgt die Syste-
häufig auf Trocken- und Halbtrockenrasen sowie matik der Arten (s. a. Arnold & Jentzsch 2016). Keine
Zwergstrauchheiden angetroffen und weisen auf ihre der Dickkopffliegen-Arten ist besonders gesetzlich
Eignung als Indikatoren für diese wertvollen Lebens- geschützt.
räume hin. Auch artenreiches Grünland, Ackerbra- Einen wichtigen Beitrag zur Erfassung der Cono-
chen und -randstreifen sowie Hecken sind wichtige pidenfauna Sachsen-Anhalts leisteten bereits eini-
Lebensräume für einige Blasenkopffliegen und ihre ge Entomologen, die Ende des 19. und Anfang des
Wirtsarten. Mehrere im Frühjahr aktive Myopa-Arten 20. Jahrhunderts Daten publizierten (Jänner 1937,
sowie Conops vesicularis Linnaeus, 1761 sind an blü- Kleine 1909, Lassmann 1934, Loew 1857) und weitere,
henden Obstbäumen und blütenreichen Sträuchern wie z. B. Maertens und Riedel, die an der Erstellung der
wie Crataegus und Prunus anzutreffen. Monographie über die Fliegen Thüringens (Rapp 1942)
Weibchen der Dickkopffliegen heften in der Regel beteiligt waren. Insgesamt sieben Arten, die in der
ein Ei an einen Segmentrand des Hinterleibes ihrer damaligen Zeit belegt wurden, müssen gegenwärtig
Wirte. Die zur Eiablage erforderlichen Angriffe auf die in Sachsen-Anhalt als ausgestorben oder zumindest
Wirte sind häufig zu beobachten. Derartige Attacken verschollen eingestuft werden. Das ältere Samm-
werden jedoch zumindest bei einigen Arten auch von lungsmaterial aus Sachsen-Anhalt ist über zahlreiche
den Männchen ausgeführt (Arnold 2010). Museen und Institute verteilt. Erste Auswertungen
Die Larve lebt zunächst frei schwimmend in der liegen bereits in publizierter Form vor (Stuke 1997, Ar-
Hämolymphe, später parasitisch von den nicht un- nold 2001, Jentzsch 2005, 2014, 2016, Jentzsch & Jänicke
mittelbar lebenswichtigen Organen des Wirtes, wird 2014, Stuke & Kehlmaier 2008).
aber gegen Ende ihrer Entwicklung zum Parasitoiden, Seit etwa 2001 erfolgten wieder gezielte Er-
indem sie ihren Wirt tötet und sich in dessen Abdo- fassungen. Diese haben zu verschiedenen regiona-
men verpuppt, wo sie in der Regel auch im Puppen- len Publikationen und Belegarbeiten (Arnold 2004,
stadium überwintert. Die meisten Dickkopffliegen Jentzsch & Steinborn 2007, 2008, Steinborn 2007, Link et
schlüpfen im Folgejahr, einzelne können jedoch auch al. 2012) sowie einer ersten Gesamtschau der Dick-
im Puppenstadium mehrmals überwintern. Das Ge- kopffliegen-Fauna Sachsen-Anhalts (Jentzsch 2009)
885Dickkopffliegen
1 2
Abb. 1: Conops flavipes ist ein häufiger Blütenbesucher dessen Larven nach Haupt & Haupt (1998) in Nestern von Erdhummeln und bei Soli-
tärbienen der Gattung Osmia leben (25.08.2019, Montal, Südtirol, Italien. Foto: M. Jentzsch). Abb. 2: Conops quadrifasciatus besucht häufig
und gern violette Blüten. Ihre Larven entwickeln sich in den Nestern der Steinhummel (Haupt & Haupt 1989) (25.08.2019, Montal, Südtirol,
Italien. Foto: M. Jentzsch).
geführt. Hervorzuheben sind zudem die im Auftrag Flecken“ in Sachsen-Anhalt zu tilgen. Zu den aktuell
des Förder- und Landschaftspflegevereins Biosphären- wenig oder nicht besammelten Gebieten zählen bei-
reservat „Mittelelbe“ e. V. durchgeführten Erfassun- spielsweise der Harz und der Flechtinger Höhenzug.
gen Blüten besuchender Insekten in Streuobstwiesen Insgesamt ergaben sich Nachweise von 39 Arten für
in den Jahren 2012 und 2013, die zahlreiche Conopi- Sachsen-Anhalt (Arnold & Jentzsch 2016). Davon wur-
den-Nachweise erbrachten (leg. K. Bäse, B. Krummhaar, den zwei als ausgestorben oder verschollen und 14 in
C. Saure). Im Ziegelrodaer Forst konnten im gleichen eine Gefährdungskategorie eingeordnet. Weitere vier
Zeitraum mittels Autokescher-Fängen bemerkens- Arten befinden sich nunmehr auf der Vorwarnliste.
werte Nachweise erzielt werden (leg. T. Glinka, J. Link; Noch immer ist es bei mehreren Spezies aufgrund der
Jentzsch et al. 2017) und es kamen zahlreiche Beifän- unzureichenden lokalen Erfassungen schwierig, ge-
ge aus Untersuchungen für Managementplanungen naue Gefährdungskategorien zu formulieren und die
des Landesamtes für Umweltschutz zur Auswertung Kategorien „G“ und „D“ geben für diese Arten aktuell
(alle det., Coll. Jentzsch). Bei einigen dieser Erfassun- am genauesten den Kenntnisstand auch unter Be-
gen waren Vorkommen überregional bedeutsamer rücksichtigung der Untersuchungen in benachbarten
Arten belegbar, wie z.B. von Zodion kroeberi Szilády, Bundesländern wider. Für Abrachyglossum capitatum
1926 in der Klietzer Heide (Stuke et al. 2006). Die erste (Loew, 1847), Sicus abdominalis Kröber, 1915 und Sicus
Fassung der Roten Liste (Arnold & Jentzsch 2004) war fusenensis Ôuchi, 1939 sind dabei Gefährdungskate-
vor allem als Anregung zur Intensivierung der Erfas- gorien höher als „3“ sehr wahrscheinlich.
sungen gedacht. Dennoch gilt es immer noch, „weiße
Tab. 1: Übersicht zum Gefährdungsgrad der Dickkopffliegen Sachsen-Anhalts
Gefährdungskategorie Rote Liste Gesamt
0 R 1 2 3
Artenzahl (absolut) 2 - - 1 4 7 39
Anteil an der Gesamtartenzahl (%) 5,1 - - 2,6 10,2 17,9
886Dickkopffliegen
Tab. 2: Übersicht zu den sonstigen Kategorien.
Kategorien Sonstige Gesamt Gesamt
G D V
Artenzahl (absolut) 7 2 2 11 39
Anteil an der Gesamtartenzahl (%) 17,9 5,1 5,1 28,2
Gefährdungsursachen und erforderliche stärksten bedrohten Insektengruppen. Gefährdungs-
Schutzmaßnahmen ursachen sind Flurbereinigung und Verarmung der
Landschaft an kleinteiligen Strukturelementen. Durch
Als Parasitoide oder Prädatoren sind Conopiden selte- Beräumung, Versiegelung, Überbauung, Sukzession,
ner als ihre Wirte. Viele Arten haben jedoch ein sehr infolge Nährstoffbelastung usw. gehen viele Nistplät-
großes Areal, das sich bei manchen von Westeuropa ze verloren. Als Tränken geeignete Pfützen werden
bis nach Japan erstreckt. vielerorts durch Befestigung von Wald- und Feldwegen
Voraussetzung für ihren Schutz sind Schutzmaß- vernichtet. Die Intensivierung der Landwirtschaft hat
nahmen für ihrer Wirts- bzw. Beutetiere, die Hymeno- einen qualitativen und quantitativen Rückgang des
pteren. Wie bei fast allen als sogenannte r-Strategen Blütenangebotes zur Folge und die Belastung durch
reproduzierenden Kleintieren ist ein effektiver Schutz bienenschädliche Insektizide hat stark zugenommen.
nur durch Erhaltung ihrer Lebensräume, also die Be-
wahrung der Lebensräume aculeater Hymenopteren Vergleich zur Roten Liste 2004 (Analyse)
möglich. Denn von der Mehrzahl der Conopiden-Ar-
ten sind die Wirtsarten bisher nicht oder nur teilweise Im Vergleich zur ersten Roten Liste der Conopiden
bekannt. Laut Roter Liste der Biotoptypen des Landes Sachsen-Anhalts (Arnold & Jentzsch 2004) beruhen
Sachsen-Anhalt (Schuboth & Fiedler 2020) sind die für die aktuellen Einschätzungen auf einer deutlich um-
Dickkopffliegen und ihre Wirte wichtigsten Biotop- fangreicheren Datengrundlage (vgl. Arnold & Jentzsch
typen in die Gefährdungskategorien 2 (Zwergstrauch- 2016). Insbesondere gelangen zahlreiche Wieder-
heiden) bis 3 (Trockenrasen, artenreiches Grünland, funde von Arten, die im Nachgang also lediglich als
Ackerbrachen, Hecken) eingestuft. verschollen und nicht als ausgestorben einzuschätzen
Über das Phänomen „Insektensterben“ wird waren und die deutliche Reduktion der Arten der
gegenwärtig viel diskutiert. Aculeate Hymenopteren Kategorie „0“ in Tab. 3 erklären.
und damit auch ihre Parasitoide gehören zu den am
Tab. 3: Änderungen in der Anzahl der Einstufungen in die Gefährdungskategorien im Vergleich der Roten Listen der Dickkopffliegen Sach-
sen-Anhalts aus den Jahren 2004 und 2020.
Rote Liste 2004 Rote Liste 2020
Gefährdungskategorie
(AZ = 33) (AZ = 39)
(absolut) (%) (absolut) (%)
0 – Ausgestorben oder verschollen 19 57,6 2 5,1
R – Extrem seltene Arten mit geographischer
1 3,0 - -
Restriktion
1 – Vom Aussterben bedroht - - - -
2 – Stark gefährdet 1 3,0 1 2,6
3 – Gefährdet 2 6,1 4 10,2
Gesamt 23 69,7 7 17,9
Danksagung fangreiche Unterstützung bei der Datensammlung
gedankt.
An dieser Stelle sei insbesondere den Herren K. und Dank gilt den o. g. Kuratoren der Museumssamm-
W. Bäse (Lutherstadt Wittenberg), F. Dziock (Berlin), lungen, die Material entliehen oder vor Ort Einblick in
T. Karisch (Dessau) und J.-H. Stuke (Leer) für die um- die Sammlungen gewährten.
887Dickkopffliegen
Art (wiss) Kat. Bem.
Abrachyglossum capitatum (Loew, 1847) G
Conops strigatus Wiedemann in Meigen, 1824 0 o. D. 01)
Dalmannia aculeata (Linnaeus, 1761) 0 1884 02)
Dalmannia dorsalis (Fabricius, 1794) G
Dalmannia punctata (Fabricius, 1794) G
Leopoldius signatus (Wiedemann in Meigen, 1824) D
Myopa dorsalis Fabricius, 1794 3
Myopa hirsuta Stuke & Clements, 2008 D
Myopa stigma Meigen, 1824 3
Myopa variegata Meigen, 1804 3
Myopotta rubripes (Villeneuve, 1909) G
Physocephala chrysorrhoea (Meigen, 1824) G
Physocephala vittata (Fabricius, 1794) V
Sicus abdominalis Kröber, 1915 G
Sicus fusenensis Ôuchi, 1939 G
Thecophora bimaculata Preyssler, 1791 V
Thecophora melanopa Rondani, 1857 3
Zodion kroeberi Szilády, 1926 2
Die Nomenklatur orientiert sich an Kassebeer (1999).
Abkürzungen und Erläuterungen, letzter Nachweis/Quelle 01)
o.D.: Historischer Beleg ohne Datum, Wernigerode,
(Spalte „Bem.“) Coll. Naturkundemuseum Leipzig (Arnold 2001)
02)
1884, Weißenfels, leg. V. v. Röder, Coll. Martin-Luther-
Universität Halle-Wittenberg (Jentzsch 2009)
Literatur
Arnold, A. (2001): Die Dickkopffliegen (Diptera: Cono- halts. Ein Kompendium der Biodiversität. – Natur +
pidae) der Sammlung des Naturkundemuseums Text, Rangsdorf, 1.132 S.
Leipzig. – Veröffentlichungen des Naturkundemu- Haupt, J. & H. Haupt (1998): Fliegen und Mücken. Be-
seums Leipzig (Leipzig) 20: 66 –76. obachtung, Lebensweise. – Naturbuch-Verlag,
Arnold, A. (2004): Bombyliidae, Conopidae und Mi- Augsburg: 351 S.
cropezidae (Diptera) aus dem Osten des Kreises Jänner, G. (1937): Diptera, Fliegen (1). In: Rapp, O.
Bitterfeld/Sachsen-Anhalt. – Studia dipterologica (Hrsg.): Die Natur der mitteldeutschen Landschaft
(Halle) 11: 524 –528. Thüringens. – Beitr. Fauna Thür. (Erfurt) 3: 98 –100.
Arnold, A. (2010): Scheinangriffe männlicher Dick- Jentzsch, M. (2005): Fliegennachweise aus der Samm-
kopffliegen (Diptera, Conopidae) auf Wirte zwecks lung Willy Schlüter et al. im Museum der Natur
Gewöhnung (Habituation) gegenüber Eiablage- Gotha (Diptera: Asilidae, Athericidae, Bombylii-
Versuchen der Weibchen. – Entomol. Nachr. Ber. dae, Conopidae, Hypodermatidae, Stratiomyidae
(Dresden) 54(2): 151–152. et Syrphidae). – Studia dipterologica (Halle) 12:
Arnold, A. (2011): Lebendgewichte einiger Dickkopf- 229 –234.
fliegen (Diptera, Conopidae) sowie Trauer- und Jentzsch, M. (2009): Die Dickkopffliegen (Insecta,
Wollschweber (Diptera, Bombyliidae) mit Schluss- Diptera: Conopidae) Sachsen-Anhalts. – Natur-
folgerungen zum Gewichtsverhältnis zwischen wissenschaftliche Beiträge des Museums Dessau
Wirt und Parasitoid bei den Conopidae. – Entomol. (Dessau) 21: 61–79.
Nachr. Ber. (Dresden) 55(2–3): 84 – 87. Jentzsch, M. (2014): Fliegen-Belege in der Sammlung
Arnold, A. & M. Jentzsch (2004): Rote Liste der Dick- des Museums für Naturkunde und Vorgeschichte
kopffliegen (Diptera: Conopidae) des Landes Sach- Dessau (Diptera: Asilidae, Conopidae, Hippobosci-
sen-Anhalt. – Berichte des Landesamtes für Um- dae, Stratiomyidae et Syrphidae). – Naturwissen-
weltschutz Sachsen-Anhalt (Halle) 39: 417– 419. schaftliche Beiträge des Museums Dessau (Des-
Arnold, A. & M. Jentzsch (2016): Dickkopffliegen (Dipte- sau) 26: 115–123.
ra: Conopidae). – S. 1100 –1103. – In: Frank, D. & P. Jentzsch, M. (2016): Die Stink-, Waffen- und Dickkopf-
Schnitter (Hrsg.): Pflanzen und Tiere Sachsen-An- fliegen des Phyletischen Museums Jena (Insecta:
888Dickkopffliegen
Diptera: Coenomyidae, Stratiomyidae, Conopi- Conopidae). – Tijdschr. Entomol. (Amsterdam) 151:
dae). – Thüringer Faunistische Abhandlungen 3 –10.
(Erfurt) 21: 211–224. Rapp, O. (1942): Die Fliegen Thüringens unter beson-
Jentzsch, M. & M. Jänicke (2014): Verschiedene Fliegen- derer Berücksichtigung der faunistisch-oekologi-
familien aus der Sammlung des Museums für schen Geographie. – Selbstverlag, Erfurt, 574 S.
Naturkunde Gera. – Veröffentlichungen Museum Rivosecchi, L. & M. Mei (1998): Note sinonimiche su
für Naturkunde Gera. Naturwissenschaftliche alcuni Conopidi decritti da Camillo Rondani (Diptera,
Reihe 39: 30–35. Conopidae). – Fragmenta Entomoloica (Rom) 30:
Jentzsch, M. & E. Steinborn (2007): Dipteren-Nachweise 271–277.
aus dem Naturschutzgebiet „Sprohne“ und seiner Schuboth, J. & B. Fiedler (2019): Biotoptypen. – In: Lan-
Umgebung. – Naturschutz im Land Sachsen-An- desamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt (Hrsg.
halt (Halle) 44: 38 – 44. (2019): Rote Listen Sachsen-Anhalt. – Berichte des
Jentzsch, M. & E. Steinborn (2008): Zur Dipteren-Fauna Landesamtes für Umweltschutz Sachsen-Anhalt
von Trockenstandorten der Porphyrlandschaft bei 1: 29–54.
Halle (Diptera: Bombyliidae, Conopidae et Syrphi- Schumann, H. (2002): Erster Nachtrag zur „Checkliste
dae). – Entomol. Mitt. Sachsen-Anhalt (Schöne- der Dipteren Deutschlands“. – Studia dipterologica
beck) 16: 51–58. (Halle) 9: 437– 445.
Jentzsch, M., Glinka, T., Link, J. & B. Lehmann (2017): Steinborn, E. (2007): Untersuchung ausgewählter
Einsatz eines Autokeschers im Ziegelrodaer Dipterengruppen auf Trockenstandorten in der
Forst – Ergebnisse und Bemerkungen zur Methode Porphyrlandschaft nördlich von Halle. – Bachelor-
(Arachnida: Araneae, Pseudoscorpiones; Insecta: arbeit, Hochschule Anhalt, Bernburg.
Ephemeroptera, Odonata, Hemiptera, Coleoptera, Stuke, J. (1997): Conopidenbelege aus Deutschland
Hymenoptera, Lepidoptera, Mecoptera, Diptera). – aus dem Überseemuseum Bremen (Diptera, Cono-
Hercynia N. F. 50: 91– 93. pidae). – Studia dipterologica (Halle) 4: 377–382.
Kassebeer, C. F. (1999): Conopidae. In: Schuhmann, H.; Stuke, J. (2002): Physocephala laticincta (Brullè, 1832)
Bährmann, R. & Stark, A. (Hrsg.): Entomofauna neu für Deutschland (Diptera: Conopidae). – Stu-
Germanica 2. Checkliste der Dipteren Deutsch- dia dipterologica (Halle) 9: 128.
lands. – Studia dipterologica, Supplement (Halle) Stuke, J. (2006): Thecophora pusilla auct. – ein Arten-
2: 145 –146. komplex. – Beitr. Entomol. (Berlin) 56: 269 –279.
Kleine, R. (1909): Zur Kenntnis der Dipteren. – Mitt. Stuke, J. & D. K. Clements (2005): The interpretation of
Entomol. Ges. Halle (Berlin) 1: 8 –16. some Conopidae (Diptera) described by Robineau-
Lassmann, R. (1934): Beitrag zur Dipterenfauna von Desvoidy. – Zootaxa (Auckland) 886: 1–12.
Halle und Umgebung. – Mitt. Entomol. Ges. Halle Stuke, J. & D. K. Clements (2008): Revision of Myopa
(Berlin) 13: 9 –23. testacea-Group in the Palaearctic Region (Diptera:
Link, J., Fischer, L., Glinka, T., Merkel, M. & M. Jentzsch Conopidae). – Zootaxa (Auckland) 1713: 1–26.
(2012): Dipteren-Nachweise aus Bernburg-Strenz- Stuke, J. & C. Kehlmaier (2008): Westpaläarktische
feld. – Entomol. Mitt. Sachsen-Anhalt (Schöne- Conopidae (Insecta: Diptera) in der Sammlung des
beck) 20(2): 51– 61. Museums für Tierkunde der Staatlichen Natur-
Loew, H. (1857): Eine dipterologische Razzia auf dem historischen Sammlungen Dresden. – Faunistische
Gebiet des naturwissenschaftlichen Vereins für Abhandlungen Museum Tierkunde Dresden (Dres-
Sachsen und Thüringen. – Zeitschr. gesammt. den) 26: 137–147.
Naturwiss. (Berlin) VIII: 97–112. Stuke, J.; Saure, C. & M. Jentzsch (2006): Zum Vorkom-
Mei, M. & J. Stuke (2008): Remarks on Zodion nigritar- men von Zodion kroeberi Szilády, 1926 (Diptera,
sis (Strobl, 1902) and other European species of Conopidae) in Deutschland. – Entomofauna (Ans-
Zodion Latreille, 1796, with a revised key (Diptera, felden) 27: 117–124.
Anschrift der Autoren:
Andreas Arnold Prof. Dr. Matthias Jentzsch
Zur schönen Aussicht 25 Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden
04435 Schkeuditz Fakultät Landbau/Landespflege
E-Mail: an_h_arnold@yahoo.de Pillnitzer Platz 2
01326 Dresden
E-Mail: matthias.jentzsch.2@htw-dresden.de
889Sie können auch lesen