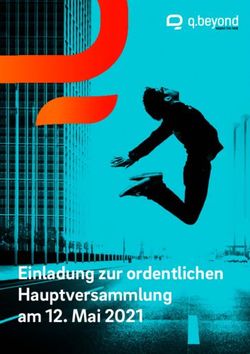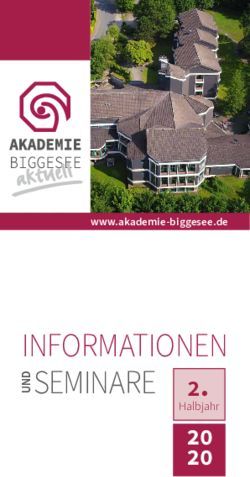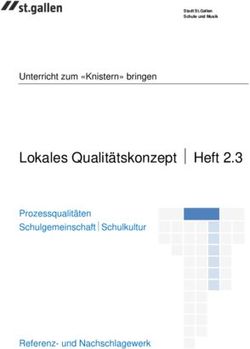Schulführung Orientierungsraster für die Schulentwicklung und Schulevaluation an den Volksschulen des Kantons Aargau August 2017 - Q2E
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Schulführung
Orientierungsraster für die Schulentwicklung und Schulevaluation
an den Volksschulen des Kantons Aargau
August 2017
1Inhalt
Einleitung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 11. Information und Kommunikation nach innen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Aufbau des Orientierungsrasters. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 12. Information und Kommunikation nach aussen /
externe Zusammenarbeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Die vier Qualitäts- und Entwicklungsstufen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
13. Verwaltung und Organisation der Schule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Die 17 Dimensionen zur Beurteilung der Schulführung im Überblick. . . . . . . . . . . . 6
14. Umgang mit Ressourcen (Finanzmittel, Sachmittel, Infrastruktur) . . . . . . . . 38
Dimensionen – Leitsätze – Qualitätsstufen, Aspekte und Indikatoren 15. Weiterentwicklung der Führungskompetenzen
(als Einzelpersonen / als Gremium). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
1. Aufteilung der Rollen und Zuständigkeiten innerhalb der Schulführung . . . . 8
16. Sich führen lassen / Akzeptanz von Führung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
2. Führen mit langfristigen Zielen (Visionen, Zukunftsperspektiven) . . . . . . . . 10
17. Verantwortungsbewusster Umgang
3. Initiieren und Steuern der Schul- und Unterrichtsentwicklung. . . . . . . . . . . . . 12 mit dem eigenen Gestaltungsspielraum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
4. Führen und Entwickeln des Personals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
5. Pädagogische Führung des Kernprozesses Unterricht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
6. Förderung und Unterstützung der schulinternen Zusammenarbeit. . . . . . . 20
7. Leitung und Moderation von Sitzungen, Konferenzen
und Veranstaltungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
8. Gestaltung von Entscheidungsprozessen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
9. Herstellen und Sicherstellen von Verbindlichkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
10. Umgang mit schwierigen Situationen (Probleme, Konflikte, Krisen). . . . . . 28
2Einleitung
Die Ansprüche und Erwartungen an Schule und Unterricht sind unter- und jenen, die geführt werden, verstanden werden muss. Um ihre päda-
schiedlich und es braucht für die Steuerung der Entwicklungsprozesse gogische Arbeit gut erfüllen zu können, brauchen Lehr- und Fachpersonen
unterschiedliche Strategien. In der Schulentwicklung wird der Blick heute einen klar umrissenen Gestaltungsraum. Dies setzt zum einen voraus,
vermehrt auf die Schule als Ganzes gerichtet: Wichtige Aufgaben, wie dass ihnen grösstmögliche Eigenverantwortung und Selbstverantwortung
soziokulturelle Integration, Umgang mit Gewalt usw. lassen sich immer zugestanden wird. Zum anderen müssen die Lehr- und Fachpersonen aktiv
weniger individuell durch die einzelne Lehrperson bewältigen, sondern an gesamtschulischen Prozessen partizipieren und diese mitbeeinflussen
machen eine gemeinsame Problemlösungsstrategie notwendig. Dies setzt und mitverantworten können. Damit verbunden besteht die Erwartung,
voraus, dass Kooperationsgefässe für die schulinterne Zusammenarbeit dass die Lehr- und Fachpersonen verantwortungsbewusst mit ihrem Ge-
aufgebaut und Entwicklungs- und Problemlösungsprozesse in der betref- staltungsraum umgehen und geltende Abmachungen und Vereinbarungen
fenden Schule geführt werden. In diesem Sinne gilt die Professionalisie- mittragen und sie als Rahmenbedingungen für ihre pädagogische Arbeit
rung der schulinternen Führungsstrukturen als wichtige Voraussetzung, ebenso akzeptieren, wie das grundsätzliche Vorhandensein einer institutio-
damit die Schule die heutigen Herausforderungen wirksam zu bewältigen nellen Führung. In diesem Sinne sind die Mitglieder der Schulführung und
vermag. Abgestützt auf die empirische Schulforschung kann die Schul die Lehr- und Fachpersonen Partner/innen mit unterschiedlichen Rollen
führung heute unbestritten als einer der zentralen Qualitätsfaktoren der und Aufgaben. Auf dem Hintergrund des jeweiligen Auftrages leisten
guten Schule bezeichnet werden. Ihre Bedeutung wird noch dadurch ver- «Leader/innen» und «Follower» wichtige Beiträge zur Qualitätsentwicklung
stärkt, dass sie auf verschiedene andere qualitätsbestimmende Faktoren und -sicherung von Schule und Unterricht.
einen starken Einfluss ausübt, wie z.B. die Personalförderung, die Qualität
der administrativen und organisatorischen Prozesse, die Steuerung des Im vorliegenden Orientierungsraster Schulführung werden in den Di-
Qualitätsmanagements, die Steuerung der Schul- und Unterrichtsentwick- mensionen 1 bis 15 eher die «Leadership-Qualitäten» dargestellt. In den
lung, die Kooperation unter den Lehrpersonen, das Betriebsklima. Dimensionen 16 und 17 geht es schwerpunktmässig um die «Followership-
Qualitäten».
Im Sinne des systemischen Ansatzes werden als Leadership-Qualitäten
alle Interaktionen verstanden zwischen Führungspersonen, Lehr- und Die Schule bewegt sich in einem dynamischen Umfeld, was immer wie-
Fachpersonen, Schülerinnen und Schülern, Eltern und Fachpersonen der Klärungs- und Aushandlungsprozesse zwischen dem Umfeld, den
ausserhalb der Schule. Systemische Führung, wie sie dem vorliegenden Führungspersonen und den Lehr- und Fachpersonen nötig macht. Deshalb
Raster zu Grunde liegt, orientiert sich an autonomen, selbständigen und sind regelmässige Evaluations- und Reflexionsprozesse auf der Basis eines
selbstorganisierten Subsystemen. Um die negativen Folgen direktiver gemeinsamen thematischen Orientierungsrahmens wichtig. Mit dem vor-
Übersteuerung und Überregulierung zu vermeiden, spielen insbesondere liegenden Orientierungsraster Schulführung sollen schulinterne Evalua-
Partizipation, Kooperation und teilautonome Arbeits- / Projektgruppen tions- und anschliessende Entwicklungsprozesse unterstützt werden.
eine wichtige Rolle. Auch Schulen sind Systeme, die nie vollständig «von
oben» durchorganisiert sein können. Die Führungspersonen sind nur eine
der vielen Kontextfaktoren, die auf die Geführten («Follower») wirken. So
wird im vorliegenden Orientierungsraster dem Zusammenspiel zwischen
den Schulführungspersonen (Leadership) und den Lehr- und Fachperso-
nen (Followership) ein wichtiger Stellenwert beigemessen. Dies unter der
Prämisse, dass Führung als Wechselwirkung zwischen denen, die führen,
3Aufbau des Orientierungsrasters
Der Orientierungsraster «Schulführung» versteht sich als Hilfestellung Der Orientierungsraster ist nach der folgenden Struktur aufgebaut:
für die Entwicklungs- und Evaluationsarbeiten, die im Rahmen der
Einzelschule vor Ort zu leisten sind. Er zeigt den Schulen auf, welches
Dimensionen Leitende Vierstufige Qualitäts-
die wünschenswerten Ziele und leitenden Werte in den beschriebenen
und Aspekte Qualitätsansprüche beschreibungen
Entwicklungsfeldern sind. Die Schule kann sie einsetzen um zu erkennen,
(Leitsätze) (Indikatoren)
wo sie im Entwicklungsprozess steht (Standortbestimmung) und wo sie
gezielt Massnahmen zur Verbesserung und (Weiter-)Entwicklung einleiten
sollte. Auf diese Weise erhält die Schule eine Planungs- und Entschei-
dungsgrundlage für die weitere Umsetzung der aktuellen Entwicklungs
■■ Dimensionen und Aspekte
vorhaben.
Das jeweilige Thema («Entwicklungsfeld») wird zunächst aufgegliedert in
mehrere Teilthemen, von denen angenommen wird, dass sie in der Praxis
als wahrnehmungs- und handlungsleitende Kategorien hilfreich sein kön-
nen. Diese Teilthemen («Dimensionen») werden wiederum in Unterthemen
(«Aspekte») aufgegliedert. Eine Dimension setzt sich somit aus mehreren
Aspekten zusammen.
■■ Leitende Qualitätsansprüche (Leitsätze)
Zu jeder Dimension wird ein Leitsatz festgelegt, der als normativer Ori-
entierungspunkt für die Praxisgestaltung dient. Diese Leitsätze sollen auf
einer übergeordneten, relativ abstrakten Ebene deutlich machen, was
von einer «guten Schule» im betreffenden Praxisfeld erwartet wird und
was somit ein sinnvolles Entwicklungsziel im Prozess der lokalen Schul
entwicklung sein könnte.
■■ Vierstufige Qualitätsbeschreibungen (Indikatoren)
Zu jedem Leitsatz werden Indikatoren auf vier verschiedenen Entwick-
lungsstufen beschrieben, wobei die zur jeweiligen Dimension zugehö
rigen Aspekte zur Gliederung dienen. Die dritte Stufe verdeutlicht, was
die U
msetzung des Leitsatzes auf einer konkreteren Ebene bedeutet.
Evaluationstechnisch gesprochen handelt es sich um Indikatoren, an
denen man eine gute Praxis im Sinne des Leitsatzes erkennen kann.
4Die vier Qualitäts- und Entwicklungsstufen
Die vierstufigen Qualitätsbeschreibungen bilden das eigentliche Kernstück Als empfohlene Zielstufe gilt die fortgeschrittene Entwicklungsstufe
der Orientierungsraster: Auf vier verschiedenen Qualitätsstufen wird mit (Stufe 3). Die Defizitstufe (Stufe 1) umreisst den negativen Orientierungs-
Hilfe von Indikatoren ein mögliches Erscheinungsbild («Szenario») der punkt, den es im Entwicklungsprozess zu vermeiden bzw. zu überwin-
Praxis umrissen. Die vier Stufen verstehen sich als Beschreibungen von den gilt.
unterschiedlichen Entwicklungszuständen der Schule:
Der vorliegende Orientierungsraster enthält eine Fülle von Ansprüchen
an die Praxisgestaltung. Damit er die ihm zugedachte Unterstützungs
■■ Defizitstufe
funktion erfüllen kann, sind verschiedene Hinweise – insbesondere
Wenig entwickelte Praxis im genannten Bereich. «Defizit» meint hier,
zur inhaltlichen Reduzierung und thematischen Fokussierung – zu
dass mit Blick auf die spezifischen Anforderungen und Qualitäts
beachten. Diese Hinweise sind in der Einleitungsbroschüre zu den fünf
ansprüche die Praxis noch deutliche Mängel aufweist, welche die
Orientierungsrastern beschrieben.
Zielerreichung behindern und bezüglich derer ein dringender Entwick-
lungsbedarf besteht.
■■ Elementare Entwicklungsstufe
Grundlegende Anforderungen an eine funktionsfähige Praxis sind
erfüllt. Die elementaren Ziele werden erreicht, gute Ansatzpunkte sind
vorhanden und lassen sich weiterentwickeln. Optimierungsbedarf zeigt
sich vor allem im Fortschreiten vom individuellen Bestreben einzelner
Lehrpersonen zu einer institutionell und schulkulturell getragenen,
gemeinsamen Praxis.
■■ Fortgeschrittene Entwicklungsstufe
Die Schule weist im betreffenden Bereich ein gutes Niveau auf. Sie
verwirklicht das, was von Expertinnen und Experten aus Theorie und
Praxis als gute Praxis bezeichnet wird, wobei sowohl die individuellen
als auch die institutionellen Aspekte angemessen berücksichtigt sind.
■■ Excellence-Stufe
Die Schule übertrifft im betreffenden Bereich die normalen Erwartun-
gen und geltenden Ansprüche an eine gute Praxis. Sie erfüllt – zu-
sätzlich zu den wünschbaren Qualitäten aus der fortgeschrittenen
Entwicklungsstufe – gewisse Anforderungen, die nur mit einem über-
durchschnittlichen Engagement und mit einer aussergewöhnlichen
Praxisexpertise auf diesem Gebiet realisiert werden können. In diesem
Sinne hat die Schule hier eine Qualitätsstufe erreicht, die als heraus
ragend bezeichnet werden kann.
5Die 17 Dimensionen zur Beurteilung der Schulführung
im Überblick
1. Aufteilung der Rollen und Zuständigkeiten 6. Förderung und Unterstützung
innerhalb der Schulführung der schulinternen Zusammenarbeit
■■ Schulführungsstruktur ■■ Unterstützung der Zusammenarbeit durch die Schulleitung
■■ Festlegung der Führungsrollen ■■ Institutioneller Rahmen der kollegialen Kooperation
■■ Transparenz der Schulführungsstrukturen ■■ Koordination unter Lehr- und Fachpersonen
■■ Delegation von Aufgaben und Verantwortung ■■ Zufriedenheit mit kollegialer Kooperation
2. Führen mit langfristigen Zielen 7. Leitung und Moderation von Sitzungen,
(Visionen, Zukunftsperspektiven) Konferenzen und Veranstaltungen
■■ Strategisch-pädagogische Ausrichtung ■■ Vor- und Nachbereitung
■■ Langfristige Ziele ■■ Strukturiertheit und Zielorientierung
■■ Transparenz der strategischen Orientierung ■■ Einbezug der Teilnehmenden
■■ Identifikation des Kollegiums mit den Zielen und Visionen ■■ Transparenz der Funktion der Traktanden
■■ Zufriedenheit der Teilnehmenden
3. Initiieren und Steuern der Schul- und
Unterrichtsentwicklung 8. Gestaltung von Entscheidungsprozessen
■■ Entscheidungsbereitschaft / Entscheidungsverhalten
■■ Strategische Ausrichtung der Schulentwicklung
■■ Vorbereitung von Entscheidungsprozessen
■■ Aktivitäten zur Weiterentwicklung der Schule
■■ Einbezug der Betroffenen in den Entscheidungsprozess
■■ Organisation und Steuerung von Entwicklungsprozessen
■■ Transparenz von Entscheidungsprozessen
■■ Umgang mit vorhandenen Entwicklungsressourcen
■■ Nachvollziehbarkeit von Entscheidungen
■■ Innovationsbereitschaft im Kollegium
4. Führen und Entwickeln des Personals 9. Herstellen und Sicherstellen von Verbindlichkeit
■■ Verschriftlichung von Regelungen und Beschlüssen
■■ Stellenwert der Personalführung
■■ Kontrolle der Umsetzung / Einhaltung von Vereinbarungen
■■ Personalförderung und Weiterbildung
■■ Verbindlichkeitsbereitschaft / -kultur im Kollegium
■■ Praxis des Mitarbeitendengesprächs
■■ Grundlagen für die Herstellung von Verbindlichkeit
■■ Arbeitsqualität der Mitarbeitenden
■■ Verbindlichkeitswahrnehmung im Kollegium
■■ Planung des Personaleinsatzes
■■ Einführung neuer Mitarbeitenden
10. Umgang mit schwierigen Situationen
5. Pädagogische Führung des Kernprozesses (Probleme, Konflikte, Krisen)
Unterricht ■■ Einstellung gegenüber schwierigen Situationen
■■ Problemlöseverhalten / Problemlösungsprozesse
■■ Unterrichtsbezogene Qualitätsansprüche
■■ Umgang mit gravierenden Problemen und Konflikten
■■ Überwachung der Unterrichtsqualität durch die Schulleitung
■■ Zufriedenheit des Kollegiums mit der schulinternen Problemlösungskultur
■■ Absprachen zur Unterrichtsarbeit
■■ Institutionelle Rahmenbedingungen für unterrichtsbezogenes Lernen
■■ Aktivitäten zur Weiterentwicklung des Unterrichts
611. Information und Kommunikation nach innen 16. Sich führen lassen / Akzeptanz von Führung
■■ Informations- und Kommunikationsgefässe / -praxis ■■ Akzeptanz von Vorgaben und Rahmenbedingungen der Schulführung
■■ Übereinstimmung von Informationsbedarf und Informationspraxis ■■ Übernahme von Aufgaben und Verantwortung / Mittragen schulorganisatorischer
■■ Gestaltung der Kommunikation zwischen Schulleitung und Mitarbeitenden Prozesse
■■ Zusammenspiel von Bring- und Holprinzip ■■ Aktives Einlassen auf Impulse der Schulführung / Mitwirkung an der
■■ Gestaltung der Kontakte zu den Schülerinnen und Schülern Entscheidungsfindung
■■ Konstruktives Verhalten bei Auffassungsdifferenzen
12. Information und Kommunikation nach aussen /
17. Verantwortungsbewusster Umgang
externe Zusammenarbeit
■■ Ausrichtung der Kommunikationspraxis nach aussen
mit dem eigenen Gestaltungsspielraum
■■ Planung und Gestaltung der Elternkontakte ■■ Die Lehr- und Fachperson als Teil der Schule als Ganzes
■■ Kooperation und Vernetzung mit ausserschulischen Partnern ■■ Einsatz für verlässliche Rahmenbedingungen
■■ Öffentlichkeitsarbeit der Schule ■■ Eigenverantwortliche Nutzung der vorhandenen Kooperationsstrukturen
■■ Balance zwischen eigenverantwortlichem Handeln und dem Beiziehen von
Unterstützung
13. Verwaltung und Organisation der Schule ■■ Reflexion der eigenen Rolle
■■ Funktionsfähigkeit der Schuladministration
■■ Organisation und Regelung der Verwaltungsprozesse
■■ Führung der Schuldokumentation
■■ Erreichbarkeit der Schulleitung
■■ Arbeitsqualität des Sekretariats
14. Umgang mit Ressourcen
(Finanzmittel, Sachmittel, Infrastruktur)
■■ Transparenz und Steuerung des Budget- und Finanzprozesses
■■ Sinnvoller Einsatz und Verteilung der Ressourcen
■■ Zustand von Sachmitteln und Infrastruktur
■■ Nutzung und Wartung der Infrastruktur (inkl. PC-Infrastruktur)
15. Weiterentwicklung der Führungskompetenzen
(als Einzelpersonen / als Gremium)
■■ Grundhaltung bezüglich der eigenen Kompetenzentwicklung
■■ Selbstreflexion der Führungskräfte / Einholen von Feedback
■■ Aktivitäten zur eigenen Kompetenzentwicklung
■■ Selbstmanagement der Führungspersonen
■■ Zufriedenheit der Betroffenen
71.
Aufteilung der Rollen und Zuständigkeiten
innerhalb der Schulführung
Es gibt eine funktionsfähige Rollen-, Zuständigkeits- und
Aufgabenteilung der Schulführung (Schulbehörde und
Schulleitung), die für Beteiligte und Betroffene trans
parent ist und sich in der Praxis als effizient und effektiv
erweist.
8 Schulführung – Dimension und LeitsatzDefizitstufe Elementare Fortgeschrittene Excellence-Stufe
Entwicklungsstufe Entwicklungsstufe
1.1 Schulführungsstruktur
■■ Die Aufgaben und Zuständigkeiten der Schul ■■ Die Aufgaben und Rollen innerhalb der Schul- ■■ Es gibt ein Schulführungskonzept mit einer ■■ Das Schulführungskonzept (Verteilung der
führungsmitglieder sind zum grossen Teil ungeklärt; führung sind in wichtigen Punkten geklärt. Es gibt klaren Rollen-, Zuständigkeits- und Aufgabenzutei- Zuständigkeitsbereiche, Schnittstellenmanage-
ein Funktionendiagramm existiert nicht. ein Funktionendiagramm, das sich in der Praxis lung (Funktionendiagramm). Wichtige Schnittstellen ment) wird in regelmässigen Abständen evalu-
■■ Die Aufgabenteilung wird als wenig effizient allerdings nur teilweise bewährt: Es gibt noch viele sind geklärt. Es gibt wenig Doppelspurigkeiten und iert, reflektiert, optimiert. (Es existieren entspre-
wahrgenommen. ungeklärte Schnittstellen, die zu Konflikten und zu wenig Zuständigkeitslücken. chende Prozesse, Instrumente, Gefässe.)
Doppelspurigkeiten führen. ■■ Die Aufgabenteilung wird als effizient wahr
■■ Die Aufgabenverteilung wird teilweise als wenig genommen.
effizient empfunden.
1.2 Festlegung der Führungsrollen
■■ Die Funktionsfähigkeit der Schulführung ist auf ■■ Die Rollenfestlegungen sind in verschiedenen ■■ Die Schulführungsarchitektur mit der vorgesehe- ■■ Die Schulführungsstruktur (bzw. die
Grund von unklaren Rollen stark eingeschränkt. Punkten nicht optimal an die Erfordernisse des nen Rollen-, Zuständigkeits- und Aufgabenteilung Adäquatheit und die Passung der festgelegten
■■ Es existieren wenige bis keine expliziten Fest- Schulalltags angepasst; im Schulalltag kommt es erweist sich als funktionsfähig, ist der Grösse der Führungsrollen auf die Schulstruktur) wird in
legungen, vieles basiert auf ad-hoc-Absprachen, häufig zu Abweichungen zwischen festgeschriebe- Schule angepasst und entspricht den Erfordernis- regelmässigen Abständen evaluiert, reflektiert,
die oft zu Konfusionen, zu Konflikten, zu vielen nen Rollen und der effektiven Rollengestaltung. sen des Schulalltags. optimiert. (Es existieren entsprechende Pro
Leerläufen führen. ■■ Es gibt eine – der Schulgrösse angepasste – zesse, Instrumente, Gefässe.)
Verteilung der Management- und Steuerungsfunk-
tionen.
1.3 Transparenz der Schulführungsstrukturen
■■ Insgesamt herrscht an der Schule wenig Klarheit ■■ Für das Kollegium ist die Rollenverteilung inner- ■■ Im Kollegium herrscht Klarheit über die Rollen, ■■ Es liegt eine adressatengerechte Verschrift-
über die Aufgaben und Zuständigkeiten der Schul- halb der Schulführung noch wenig transparent; Aufgaben und Zuständigkeiten der Schulführungs- lichung der Führungsstrukturen vor, die zur
führungsmitglieder. es herrscht wenig Klarheit über die Aufgaben und mitglieder. Transparenz beiträgt.
Zuständigkeiten der Schulführungsmitglieder.
1.4 Delegation von Aufgaben und Verantwortung
■■ Schulpflege und Schulleitung können nicht ■■ Es gibt Beispiele für sinnvolle Delegationen von ■■ Schulpflege und Schulleitung nehmen in gegen- ■■ Schulpflege und Schulleitung sorgen mit
delegieren. Sie machen alles selber, delegieren Aufgaben, sowohl der Schulpflege als auch der seitiger Absprache die Delegation von Aufgaben bewusst geschaffenen formellen und informel-
nur unangenehme Aufgaben, übertragen keine Schulleitung. bewusst und geplant vor. Sie steht sowohl im len Strukturen / Gefässen / Plattformen dafür,
Ausführungsverantwortlichkeit, neigen zu «Rück Dienste der effizienten Schulpflegearbeit, der dass Prozesse der Selbstorganisation und der
delegationen» (sobald Schwierigkeiten auf Schulleitungsentlastung als auch im Dienste des Selbststeuerung im Kollegium genügend Raum
tauchen). Kompetenzaufbaus innerhalb des Kollegiums. erhalten.
Schulführung – Qualitätsstufen, Aspekte und Indikatoren – 1. Aufteilung der Rollen und Zuständigkeiten innerhalb der Schulführung 92.
Führen mit langfristigen Zielen
(Visionen, Zukunftsperspektiven)
Langfristige Ziele (Leitlinien, Prinzipien, strategische
Zielformulierungen) dienen als Orientierungshilfen für die
strategische Schulplanung sowie für die Entscheidungen /
Handlungen der Schulleitung. Die Umsetzung der Ziele
wird in angemessenen Schritten angegangen (z.B. Jahres-
ziele).
10 Schulführung – Dimension und LeitsatzDefizitstufe Elementare Fortgeschrittene Excellence-Stufe
Entwicklungsstufe Entwicklungsstufe
2.1 Strategisch-pädagogische Ausrichtung
■■ Die strategische Ausrichtung bzw. die pädago- ■■ Die strategische Ausrichtung bzw. die päda- ■■ Über die strategische Ausrichtung bzw. die ■■ Die Auseinandersetzung mit Entwicklungen
gischen Leitideen der Schule sind in der Schul gogischen Leitideen werden in der Schulführung pädagogischen Leitideen der Schule wird innerhalb im lokalen Umfeld bzw. im Bildungswesen wird
führung kein Thema. sporadisch thematisiert. der Schulführung regelmässig gesprochen, um eine innerhalb der Schulführung bewusst geführt,
gemeinsam getragene langfristige Zielorientierung um daraus Konsequenzen für die eigenen päd-
zu erreichen. agogischen / strategischen Ziele abzuleiten. (Es
gibt dafür institutionalisierte Gefässe / Prozesse
und Instrumente.)
2.2 Langfristige Ziele
■■ Grundlagen für eine strategische Führung fehlen: ■■ Pauschale Zielformulierungen für die strategi- ■■ Es liegen Ziele (Leitlinien, Werte, Prinzipien, stra- ■■ Die Entscheidungen / Handlungen der Schul-
Es liegen kein Leitbild, keine pädagogischen Grund- sche Ausrichtung der Schule liegen vor, der Bezug tegische Zielformulierungen) vor, die als Planungs- führung werden in regelmässigen Abständen in
sätze zur Profilbildung, keine Mehrjahresplanung, zum Schulalltag ist allerdings noch wenig sichtbar. grundlagen dienen. Entscheidungen / Handlungen Bezug auf die gesetzten Zukunftsziele evaluiert,
keine Jahresziele u.ä. vor. ■■ Mehrjahres- bzw. Jahresziele sind formuliert der Schulführung orientieren sich mehrheitlich an reflektiert und optimiert.
■■ Die Schulleitung beschäftigt sich fast aus- und dienen bei wichtigen Planungsschritten als den langfristigen Zielen.
schliesslich mit dem Tagesgeschäft – ohne Aus- Orientierungshilfen. ■■ Die langfristigen Ziele werden in angemessenen
richtung auf längerfristige Ziele und pädagogische Schritten umgesetzt; sie werden in der Schul
Leitideen. entwicklung als relevante Planungs- und Orientie-
rungsgrössen sichtbar (z.B. als Jahresziele).
2.3 Transparenz der strategischen Orientierung
■■ Die Führung wird von den Betroffenen als ■■ Die Betroffenen attestieren der Schulführung, ■■ Die langfristigen / strategischen Ziele sind den ■■ Es liegt eine adressatengerechte Verschrift
konzeptlos und visionslos wahrgenommen – ohne dass hinter wichtigen Entscheidungen strategische Lehr- und Fachpersonen bekannt, die geplanten lichung der langfristigen Ziele / der strategi
spürbares schulpolitisches Engagement und ohne / pädagogische Absichten stehen. Transparenz Schritte dazu transparent. schen Orientierung vor, die zur Transparenz
erkennbare pädagogisch-didaktische Ausrichtung. darüber wird jedoch vermisst. ■■ Es sind konkrete, erfolgreiche Schritte in die ge- beiträgt.
wünschte Richtung für das Kollegium wahrnehm-
bar. Für die Mitarbeitenden ist ein Engagement der
Schulführung für die Schul- und Unterrichtsqualität
wahrnehmbar.
2.4 Identifikation des Kollegiums mit den Zielen und Visionen
■■ Langfristige Ziele der Schule sind im Kollegium ■■ Langfristige Ziele der Schule sind im Kollegium ■■ Langfristige Ziele werden unter Mitwirkung des ■■ Es gelingt der Schulführung, die eigene
nicht bekannt oder nur vom «Hörensagen». teilweise bekannt, die Lehr- und Fachpersonen Kollegiums festgelegt und gemeinsam getragen Vision auf das Kollegium zu übertragen. («Das
betrachten diese aber primär als Ziele der Schul- (hohe Identifikation). Kollegium zieht mit.») Die Zielsetzungen sind bei
führung (geringe Identifikation mit den Zielen «der ■■ Es gelingt der Schulführung, eine vom Kollegium den Schulbeteiligten weitgehend internalisiert
Schule»). getragene Vision zu schaffen. Die Zielsetzungen und werden selbstverständlich umgesetzt.
sind bei den Mitarbeitenden weitgehend interna
lisiert und werden selbstverständlich umgesetzt.
Schulführung – Qualitätsstufen, Aspekte und Indikatoren – 2. Führen mit langfristigen Zielen (Visionen, Zukunftsperspektiven) 113.
Initiieren und Steuern der Schul- und Unterrichts
entwicklung
An der Schule herrscht Innovationsbereitschaft mit
zielorientierten Schul- und Unterrichtsentwicklungs
aktivitäten, die mit Hilfe der Methodik und des Instrumen-
tariums des Projektmanagements und mit realistischem
Blick auf die vorhandenen Ressourcen angegangen und
umgesetzt werden.
12 Schulführung – Dimension und LeitsatzDefizitstufe Elementare Fortgeschrittene Excellence-Stufe
Entwicklungsstufe Entwicklungsstufe
3.1 Strategische Ausrichtung der Schulentwicklung
■■ Es fehlen sowohl strategische Ziele wie auch ■■ Schulentwicklungsvorhaben entstehen bedürf- ■■ Schulentwicklungsaktivitäten und Weiter- ■■ Die Schule ist in ein (kantonales / inter
Evaluationsergebnisse, die zur Begründung / nisorientiert (orientiert an der Motivationslage bildungen werden gezielt eingesetzt, um die kantonales) Netzwerk eingebunden, das einen
Initiierung von Schulentwicklungsaktivitäten hinzu- des Kollegiums) oder auf äusseren Druck. Eine strategischen Entwicklungsziele zu erreichen. schulübergreifenden Erfahrungsaustausch über
gezogen werden könnten. Bezugnahme auf strategische Ziele und auf eine (Schulentwicklungsaktivitäten und Weiterbildun- Fragen der Schulentwicklung ermöglicht.
längerfristige strategische Planung der Schule ist gen werden von den längerfristigen strategischen
eher zufällig. Zielen der Schule abgeleitet.)
3.2 Aktivitäten zur Weiterentwicklung der Schule
■■ Es gibt an der Schule keine nennenswerten ■■ Es gibt an der Schule vereinzelt Schulentwick- ■■ An der Schule herrscht eine hohe, breit abge- ■■ Es gibt ein hohes Engagement der Schule
Schulentwicklungsaktivitäten. lungsaktivitäten. Diese sind stark von den Personen stützte Innovationsbereitschaft, die sich in gezielten bzw. der Schulleitung, um durch Schulentwick-
■■ Schulentwicklung wird weitgehend mit indivi- geprägt, die sich darin engagieren und die die Schulentwicklungsaktivitäten niederschlägt. lungsmassnahmen der Schule ein charakteris-
dueller Weiterbildung gleichgesetzt und von der konkrete Projektarbeit gestalten. Eigenmotivation, tisches Profil zu verleihen – mit Bezug auf die
Schulleitung über die Weiterbildungsplanung als Goodwill und gegenseitiges Vertrauen bilden die strategischen Ziele der Schule.
erledigt betrachtet. zentrale Basis für Schulentwicklung. Institutio-
nalisierten Prozessen wird demgegenüber wenig
Beachtung geschenkt (keine formalisierte Projekt-
genehmigung, Ressourcenbewilligung, Projektsteu-
erung, Projektcontrolling u.a.).
3.3 Organisation und Steuerung von Entwicklungsprozessen
■■ Entwicklungsanliegen, die von aussen an die ■■ Dem Start des Entwicklungsprozesses wird viel ■■ Schulentwicklung wird mit Hilfe der Methodik ■■ Wichtige Entwicklungsanliegen werden nach
Schule herangetragen werden, werden abgewehrt Aufmerksamkeit geschenkt. Der Abschluss mit der und des Instrumentariums des Projektmanage- dem Zweischrittmodell angegangen (Pionier-
oder – falls unumgänglich – in die individuelle Frage nach der Implementierung und dem Aufwand ments angegangen. (Es gibt eine Auftragsklärung projekt – schulweite Implementation).
Umsetzungsverantwortlichkeit delegiert, d.h. ohne für die Sicherstellung einer nachhaltig wirksamen und eine differenzierte und transparente Planung.) ■■ Der Erfolg der Schulentwicklungsprojekte
gemeinsame Planung, ohne Kooperation, ohne Veränderung wird tendenziell vernachlässigt. Für die Planung und Umsetzung stehen ausreichen- (Zielerreichung) wird mit Hilfe von Evaluationen
zeitliche Strukturierung usw. angegangen. (Vieles wird angerissen, wenig zu einem wirklichen de Ressourcen (Personen, Zeit, Geld, Experten überprüft.
■■ Schulentwicklungsaktivitäten laufen unkoordi- Abschluss gebracht.) unterstützung u.a.) zur Verfügung.
■■ Die Erfahrungen von Schulentwicklungs-
niert nebeneinander. ■■ Es gibt z.B. eine Steuergruppe, welche für die projekten werden systematisch ausgewertet,
operative Planung und Durchführung von Schul dokumentiert und für die Optimierung der schul-
entwicklungsprojekten zuständig ist. internen Schulentwicklungspraxis genutzt.
Schulführung – Qualitätsstufen, Aspekte und Indikatoren – 3. Initiieren und Steuern der Schul- und Unterrichtsentwicklung 13Defizitstufe Elementare Fortgeschrittene Excellence-Stufe
Entwicklungsstufe Entwicklungsstufe
3.4 Umgang mit vorhandenen Entwicklungsressourcen
■■ Die vorhandenen zeitlichen, personellen und ■■ Es werden Bemühungen sichtbar, die laufenden ■■ Um die vorhandenen Ressourcen optimal ■■ Die Schulführung überprüft regelmässig, ob
finanziellen Ressourcen werden nicht in die Pla- Schulentwicklungsaktivitäten miteinander zu ko im Gesamtplan zu berücksichtigen, werden die die laufenden Schulentwicklungsaktivitäten in
nung von Schulentwicklungsprojekten einbezogen. ordinieren, um Überbelastungen zu vermeiden. Schulentwicklungsprojekte miteinander koordiniert. einem guten Verhältnis zu den vorhandenen
■■ Eine grobe Ressourcenkalkulation liegt als Teil Innovationen und vorhandene Ressourcen sind im zeitlichen, personellen und finanziellen Res-
der Planung vor. Urteil der Lehr- und Fachpersonen in einem guten sourcen stehen.
Gleichgewicht.
■■ Die vorhandenen zeitlichen, personellen und
finanziellen Ressourcen werden in die Planung ■■ Eine sorgfältige und differenzierte Ressourcen-
von Schulentwicklungsprojekten einbezogen – kalkulation ist vorhanden. (Der Ressourcenbedarf
meistens als Vorbehalte und Argumente bezüglich wurde im Rahmen der Planung ermittelt.) Der
der Realisierbarkeit. Aufwand für die Sicherstellung einer nachhal-
tig wirksamen Veränderung wird angemessen
einkalkuliert.
3.5 Innovationsbereitschaft im Kollegium
■■ Das Kollegium blockiert Schulentwicklungs- ■■ Das Kollegium ist gegenüber Innovations ■■ Im Kollegium herrscht eine positive Einstel- ■■ Der Schulleitung gelingt es auch unter
massnahmen oder lässt sie leer laufen. projekten ambivalent eingestellt. Bei der Mehrheit lung gegenüber Innovationen. (Man ist stolz auf schwierigen Umständen, bei den Lehr- und
■■ Es gibt keine Beispiele für erfolgreiche Innova dominieren Vorbehalte gegenüber dem Aufwand im Erreichtes.) Fachpersonen eine Bereitschaft für Schul
tionen in den letzten 5 Jahren. Vergleich zum erwarteten Nutzen. ■■ Mehrere Beispiele für erfolgreiche Innovationen entwicklung herzustellen.
■■ Es gibt einzelne Beispiele für laufende / ab liegen vor.
geschlossene Innovationen innerhalb der letzten
5 Jahre.
14 Schulführung – Qualitätsstufen, Aspekte und Indikatoren – 3. Initiieren und Steuern der Schul- und Unterrichtsentwicklung4.
Führen und Entwickeln des Personals
Die Personalführung hat einen hohen Stellenwert. Sie
zeigt sich im wertschätzenden Umgang mit den Mit
arbeitenden, in einer vorausschauenden Planung des
Personaleinsatzes, in sorgfältiger Gestaltung von Mit
arbeitendengesprächen, in einer auf individuelle und
schulische Ziele ausgerichteten Planung der Weiter
bildung sowie in der sorgfältig strukturierten Einführung
neuer Mitarbeitenden.
Schulführung – Dimension und Leitsatz 15Defizitstufe Elementare Fortgeschrittene Excellence-Stufe
Entwicklungsstufe Entwicklungsstufe
4.1 Stellenwert der Personalführung
■■ Die Personalführung geht im Tagesgeschäft ■■ Die Personalführung wird als eine wichtige ■■ Die Personalführung hat im Schulalltag einen ■■ Der ganze Personalführungsprozess (von
unter. Eine bewusst gepflegte, strukturierte und Aufgabe der Schulleitung anerkannt und bewusst hohen Stellenwert und wird bewusst gepflegt, der Personalrekrutierung, Personaleinfüh-
reflektierte Personalführung ist nicht wahrnehmbar. wahrgenommen. strukturiert und reflektiert. rung, Personalförderung bis zur Trennung) ist
■■ Die Lehr- und Fachpersonen äussern sich differenziert festgelegt und wird systematisch
zufrieden zur Personalführung der Schulleitung. angegangen.
Sie fühlen sich in ihren Leistungen anerkannt und
angemessen gefordert / unterstützt in Bezug auf
ihre persönliche Weiterentwicklung.
4.2 Personalförderung und Weiterbildung
■■ Personalentwicklungsmassnahmen werden ■■ Personalförderung wird bewusst wahrgenom- ■■ Personalförderung wird bewusst und systema ■■ Prioritäten und Massnahmen zur Personal-
unsystematisch gehandhabt. Personalförderung, men und gepflegt. Vereinzelte gezielte Mass tisch betrieben. Individuelle Entwicklungsbedürf führung und -entwicklung basieren sowohl
insbesondere die Verteilung von beschränkten nahmen sind feststellbar. nisse und institutioneller Entwicklungsbedarf auf der Erfassung und Weiterentwicklung des
Ressourcen / Bewilligungen, geschieht individu- ■■ Weiterbildungsanliegen der Mitarbeitenden wer- werden aufeinander abgestimmt. Potenzials der Mitarbeitenden als auch auf dem
alistisch und willkürlich. Es gibt keine team- und den mit Blick auf das Potenzial der betreffenden ■■ Die Verteilung der Weiterbildungsressourcen Bedarf der Schule (institutionelle Erfordernisse)
schulbezogene Personalförderungsplanung. Person (Interessen, Defizite etc.) aufgenommen. geschieht nach transparenten Kriterien und einem und sind z.B. in einem «Weiterbildungsplan»
transparenten Prozess. festgehalten.
4.3 Praxis des Mitarbeitendengesprächs
■■ Das Mitarbeitendengespräch findet nicht ■■ Die Vorgaben zur Durchführung des Mit ■■ Das Mitarbeitendengespräch wird als Ort ■■ Für das Mitarbeitendengespräch existiert ein
oder nur «pro forma» statt: d.h. zwischen Tür und arbeitendengesprächs werden vorschriftsgemäss genutzt und erfahren, wo die Qualität der eigenen schulintern weiterentwickeltes Konzept. Dieses
Angel, ohne Vorbereitung und ohne strukturierten ausgeführt («erledigt»). Arbeit fundiert besprochen und individuelle wird periodisch ausgewertet und weiterent
Gesprächsablauf. ■■ Das Mitarbeitendengespräch zwischen Schul- Qualitätsentwicklung verbindlich festgelegt wird. wickelt.
■■ Personalakten mit Hinweisen auf die Arbeits pflege und Schulleitung sowie Schulleitung und Es findet mit beidseitiger Vorbereitung, mit klarer
qualität und Entwicklungsmassnahmen / -verein Mitarbeitenden findet geplant, in vorgesehenem Struktur, mit hilfreichen Unterlagen statt.
barungen sind nicht vorhanden. regelmässigem Rhythmus statt. ■■ Konkrete Zielvereinbarungen mit Entwick-
lungs- und Weiterbildungsmassnahmen werden
festgehalten.
16 Schulführung – Qualitätsstufen, Aspekte und Indikatoren – 4. Führen und Entwickeln des PersonalsDefizitstufe Elementare Fortgeschrittene Excellence-Stufe
Entwicklungsstufe Entwicklungsstufe
4.4 Arbeitsqualität der Mitarbeitenden
■■ Die Schulleitung hat keine zuverlässigen Daten ■■ Die Schulleitung versucht eher intuitiv als ■■ Die Schulleitung verschafft sich ein differenzier- ■■ An der Schule herrscht eine Kultur, in der
zur Arbeitsqualität der Mitarbeitenden. Stärken systematisch Daten zur Arbeitsqualität der Mit tes, systematisches Bild über die Arbeitsqualität Stärken und Schwächen offen thematisiert
und Schwächen der Mitarbeitenden werden nicht arbeitenden zu erheben. Die Datengewinnung zur der Mitarbeitenden. Die Datengewinnung geschieht werden können – sowohl von Seiten der Schul-
differenziert wahrgenommen. Arbeitsqualität der Mitarbeitenden verläuft wenig entlang von explizit festgelegten Kriterien, Ver leitung gegenüber Mitarbeitenden wie auch
■■ Das Ansprechen von Stärken und Schwächen transparent. fahrensschritten und Instrumenten. umgekehrt.
einzelner Mitarbeitenden wird nach Möglichkeit ■■ Stärken und Schwächen einzelner Lehrkräfte ■■ Die Stärken und Schwächen der einzelnen ■■ Die im Mitarbeitendengespräch gewonnenen
vermieden oder geschieht pauschal (wird z.B. als werden offen angesprochen, wenn entsprechende Mitarbeitenden werden von der Schulleitung Erkenntnisse zur Schulqualität werden systema-
Instrument zur Beziehungsgestaltung verwendet). Hinweise von aussen oder aus dem Kollegium differenziert wahrgenommen und im geeigneten tisch ausgewertet und für die Schulentwicklung
vorliegen. Rahmen offen angesprochen – verbunden mit genutzt.
Förderungs- und Entwicklungsmassnahmen.
4.5 Planung des Personaleinsatzes
■■ Personaleinsatz und Personalplanung werden ■■ Personaleinsatz und Personalplanung werden ■■ Personaleinsatz wird vorausschauend geplant ■■ Prinzipien und Kriterien zur Planung des
unter dem Druck des Arbeitsalltags kurzfristig von Schuljahr zu Schuljahr termingerecht fest und im Kollegium / mit den betroffenen Personen Personaleinsatzes sind explizit festgelegt,
festgelegt. (Es kommt zu Engpässen in der Stellen- gelegt. jährlich abgesprochen. schriftlich formuliert und den Betroffenen
planung, welche mit einer rechtzeitigen Planung ■■ Die Kriterien für die Pensenzuteilung sind trans- bekannt bzw. für sie einsehbar.
vermieden werden könnten.) parent und nachvollziehbar.
4.6 Einführung neuer Mitarbeitenden
■■ Eine nennenswerte Einführung / Begleitung von ■■ Neue Mitarbeitende werden während der ersten ■■ Die neuen Mitarbeitenden werden sorgfältig in ■■ Es gibt ein differenziertes Konzept zur Einfüh-
neuen Mitarbeitenden findet nicht statt. Wochen in wichtige Abläufe und Gepflogenheiten die schulkulturellen und institutionellen Eigenhei- rung neuer Mitarbeitenden in den Schulbetrieb.
der Schule eingeführt. ten und Ansprüche der Schule eingeführt und in Das Konzept wird umgesetzt und in regelmässi-
■■ Bei Bedarf steht den neuen Mitarbeitenden für der Einführungsphase begleitet. Die notwendigen gen Abständen evaluiert und erfahrungsgestützt
die Klärung von Fragen eine Ansprechperson zur personellen Ressourcen und Instrumente dafür weiterentwickelt.
Verfügung. werden bereitgestellt und sind den Mitarbeitenden ■■ Die Einführungsphase wird mit den betroffe-
bekannt. nen Mitarbeitenden systematisch reflektiert.
Schulführung – Qualitätsstufen, Aspekte und Indikatoren – 4. Führen und Entwickeln des Personals 175.
Pädagogische Führung des Kernprozesses Unterricht
Die Schulleitung nimmt die pädagogische Führung
des Unterrichts wahr und stellt einen optimalen all-
täglichen Schulbetrieb bzw. Unterricht und dessen
Weiterentwicklung sicher.
18 Schulführung – Dimension und LeitsatzDefizitstufe Elementare Fortgeschrittene Excellence-Stufe
Entwicklungsstufe Entwicklungsstufe
5.1 Unterrichtsbezogene Qualitätsansprüche
■■ Die Schulleitung überlässt die Festlegung der ■■ Die Schulleitung hat Vorstellungen zu unter- ■■ Die Schulleitung stellt hohe, aber realistische ■■ Die Schulleitung evaluiert / überprüft die
Qualitätsanforderungen an den Unterricht praktisch richtsbezogenen Qualitätsanforderungen, kommu- Anforderungen an die Lehr- und Fachpersonen unterrichtsbezogenen Qualitätsansprüche
den Lehr- und Fachpersonen, kommuniziert ihre niziert diese aber wenig deutlich. und die Lernenden bezüglich des Unterrichts regelmässig und initiiert / ergreift Massnahmen
Vorstellungen dazu nicht und greift nicht in das (Förderung der Sach-, Sozial- und Selbstkompe- zur Optimierung.
Unterrichtsgeschehen ein. tenzen). Sie kommuniziert diese regelmässig und in
geeigneter Form.
5.2 Überwachung der Unterrichtsqualität durch die Schulleitung
■■ Probleme, Schwierigkeiten und Qualitätsdefizite ■■ Die Schulleitung kümmert sich nur bei auftreten- ■■ Die Schulleitung sorgt für ein geordnetes, ■■ Die Schulleitung bemüht sich um eine
des Unterrichtsalltags werden von der Schulleitung den Problemen und bei offensichtlichen Mängeln anregendes und auf gegenseitigem Vertrauen ständige Reflexion ihrer Massnahmen zur
kaum wahrgenommen. um den Unterricht der einzelnen Lehr- und Fach beruhendem Umfeld für Lehren und Lernen in der Optimierung und setzt neue Erkenntnisse mit
personen (gilt als Einmischen in fremde Angele- Schule und im Unterricht. kontinuierlichen Verbesserungsschritten unbü-
genheiten). ■■ Die Schulleitung überwacht die Umsetzung rokratisch um.
systematisch (z.B. mit Unterrichtsbeobachtungen,
Befragungen der Lehr- und Fachpersonen und
Schüler/innen u.a.) und ergreift Massnahmen zur
Optimierung.
5.3 Absprachen zur Unterrichtsarbeit
■■ Es fehlen schulweite bzw. stufenbezogene ■■ Es gibt vereinzelte Absprachen und Vereinbarun- ■■ Es gibt schulweite bzw. stufenbezogene Ab- ■■ Es wird regelmässig überprüft, zu welchen
Absprachen und Vereinbarungen über Aspekte gen zur Unterrichtsarbeit (Disziplin und Klassen sprachen und Vereinbarungen über die kritischen Themen schulweite bzw. stufenbezogene
der Unterrichtsarbeit (Disziplin und Klassenfüh- führung, Prüfungswesen, Umgang mit Störungen im Aspekte der Unterrichtsarbeit (Disziplin und Klas- Absprachen notwendig sind.
rung, Prüfungswesen, Umgang mit Störungen im Unterricht u.a.). Diese werden im Unterrichtsalltag senführung, Prüfungswesen, Umgang mit Störun- ■■ Die vorhandenen Info- und Kommunikations-
Unterricht u.a.). wenig beachtet. gen im Unterricht u.a.). Diese werden von den Lehr- gefässe und -instrumente sind dem vorhande-
■■ Die Absprachen zum Tagesgeschäft bleiben den ■■ Die Schulleitung sorgt dafür, dass die elemen- und Fachpersonen als hilfreiche Unterstützungen nen Bedarf an Absprachen angepasst. Dies
einzelnen Lehr- und Fachpersonen überlassen. taren Absprachen zwischen den Lehr- und Fach empfunden und im Unterrichtsalltag angewandt. wird regelmässig überprüft.
(Vieles läuft unkoordiniert nebeneinander. Schlech- personen vorgenommen werden. ■■ Die Schulleitung achtet darauf, dass Absprachen
te Nutzung der vorhandenen Ressourcen.) zwischen den Lehr- und Fachpersonen vorgenom-
men werden und unterstützt diesen Prozess durch
das Zur-Verfügung-Stellen von geeigneten Info-
und Kommunikationsinstrumenten.
5.4 Institutionelle Rahmenbedingungen für unterrichtsbezogenes Lernen
■■ Institutionelle Rahmenbedingungen zur Be- ■■ Kollegiale Besprechungen und Bearbeitungen ■■ Die Schulleitung sorgt für institutionelle ■■ Durch Aufspüren und Vermeiden von Doppel-
sprechung und Bearbeitung von Problemen des von Problemen des Unterrichtsalltags finden Rahmenbedingungen, die eine Besprechung und spurigkeiten und durch sinnvolle Aufteilung der
Unterrichtsalltags fehlen. vereinzelt statt (auf informeller Basis). Bearbeitung von Problemen des Unterrichtsalltags anfallenden Arbeiten werden die vorhandenen
ermöglichen. Personalressourcen gut genutzt.
5.5 Aktivitäten zur Weiterentwicklung des Unterrichts
■■ Es gibt keine nennenswerten Unterrichtsent- ■■ Unterrichtsentwicklung findet vereinzelt statt ■■ Es gibt vielfältige Unterrichtsentwicklungsaktivi- ■■ Unterrichtsentwicklung ist als dauerhafter
wicklungsaktivitäten. Institutionelle Massnahmen und wird von der Schulleitung ideell und bei Bedarf täten. Auf der Ebene der Schule gibt es geeignete Prozess institutionalisiert und verknüpft mit der
zur Initiierung und Unterstützung der Unterrichts- auch materiell unterstützt. Rahmenbedingungen, welche die Unterrichts strategischen Schulentwicklungsplanung.
entwicklung fehlen. entwicklung fördern und unterstützen.
Schulführung – Qualitätsstufen, Aspekte und Indikatoren – 5. Pädagogische Führung des Kernprozesses Unterricht 196.
Förderung und Unterstützung
der schulinternen Zusammenarbeit
Die Schulleitung sorgt für eine Zusammenarbeit, die funk-
tionsfähig ist und auf gegenseitiger Wertschätzung und
auf Vertrauen basiert. Für den Erfahrungs- und Meinungs
austausch, für die Koordination der Arbeitsprozesse,
für die kooperative Problemlösung gibt es Gefässe und
Instrumente, die aktiv und erfolgreich genutzt werden.
20 Schulführung – Dimension und LeitsatzDefizitstufe Elementare Fortgeschrittene Excellence-Stufe
Entwicklungsstufe Entwicklungsstufe
6.1 Unterstützung der Zusammenarbeit durch die Schulleitung
■■ Von der Schulleitung wird nichts unternommen, ■■ Es lassen sich vereinzelt Bemühungen der ■■ Die Schulleitung fördert / unterstützt gezielt den ■■ Die Schulleitung trägt mit eigenem Engage-
um eine kooperationsförderliche Gemeinschaft ent- Schulleitung feststellen, die Bildung einer koopera- Aufbau einer kooperationsförderlichen Gemein- ment, Vorbildverhalten, geeigneten schulinter-
stehen zu lassen (z.B. gemeinsame Werthaltungen, tionsförderlichen Gemeinschaft zu initiieren und zu schaft (z.B. teaminterne Weiterbildungen, Ausbil- nen Anlässen usw. dazu bei, dass sich an der
Gemeinschaftsgefühl). unterstützen. dung gemeinsamer Werthaltungen und Normen, Schule ein spürbares Zugehörigkeitsgefühl
Vereinbarung von Regeln, Initiierung von Anlässen entwickelt.
zur Förderung des Gemeinschaftsgefühls).
6.2 Institutioneller Rahmen der kollegialen Kooperation
■■ Es fehlen Zeitgefässe, Strukturen zur Förde- ■■ Es gibt vereinzelt Zeitgefässe und Strukturen ■■ Der Erfahrungs- und Meinungsaustausch zwi- ■■ Es gibt ein Konzept zur systematischen För-
rung des Meinungs- und Erfahrungsaustausches zur Förderung des Meinungs- und Erfahrungs schen den Kollegiumsmitgliedern wird gezielt und derung und Unterstützung der Zusammenarbeit.
innerhalb des Kollegiums (z.B. Projekte, moderierter austausches innerhalb des Kollegiums (z.B. Projek- systematisch gefördert. Es gibt dazu Zeitgefässe ■■ Weiterbildung im Team steht in engem
Erfahrungsaustausch, Supervision). te, moderierter Erfahrungsaustausch, Supervision). und Strukturen sowie vielfältige Anlässe (z.B. Pro- Zusammenhang mit dem Erreichen der
■■ Weiterbildung im Team wird nicht zur Unter ■■ Weiterbildung im Team wird bei Bedarf und jekte, Intervision, moderierter Erfahrungsaustausch, langfristigen Ziele der Schule und fördert den
stützung einer guten Zusammenarbeit im Kollegium Gelegenheit zur Unterstützung einer guten Zusam- Supervision, Arbeitsgruppen, spezielle Gefässe Aufbau eines Klimas der Wertschätzung und
genutzt. Eine gemeinsame pädagogisch-didak menarbeit genutzt. Themen werden eher kurzfristig innerhalb der Sitzungen usw.). des Vertrauens.
tische Grundhaltung ist nicht vorhanden. festgelegt und stehen nur teilweise in Bezug zu den ■■ Weiterbildung im Team wird gezielt zur Unter-
langfristigen Zielen der Schule. stützung einer guten Zusammenarbeit genutzt.
(Schaffen einer gemeinsamen pädagogisch-
didaktischen Grundhaltung; bewusst gestaltete
Kooperationserfahrungen, Aufbau eines Klimas der
Wertschätzung und des Vertrauens u.a.)
6.3 Koordination unter Lehr- und Fachpersonen
■■ Koordinations- und Kooperationsdefizite zwi- ■■ Absprachen und gegenseitige Information er- ■■ Absprachen und gegenseitige Information ■■ Die Qualität der Zusammenarbeit wird
schen den Lehr- und Fachpersonen führen in der füllen die grundlegenden Anforderungen an einen ermöglichen eine gute Koordination der Arbeits in regelmässigen Abständen evaluiert und
alltäglichen Arbeit zu Koordinationsproblemen, die funktionsfähigen, koordinierten Schulbetrieb. prozesse sowie kooperative Problemlösungen unter gemeinsam reflektiert; auf dieser Grundlage
nach innen und aussen in Erscheinung treten. Die den Lehr- und Fachpersonen. Der Qualitätsgewinn werden Optimierungsmassnahmen beschlossen
Qualität des Schulbetriebs ist dadurch beeinträch- durch gegenseitige Information, Absprachen und und umgesetzt.
tigt (z.B. wahrnehmbar für Erziehungsberechtigte Kooperation wird von innen und aussen positiv
oder Schüler/innen). wahrgenommen.
6.4 Zufriedenheit mit kollegialer Kooperation
■■ Im Kollegium ist die Unzufriedenheit mit der kol- ■■ Das Kollegium ist mit der kollegialen Kooperation ■■ Im Kollegium ist eine grosse Zufriedenheit mit ■■ Der Kommunikationsprozess im Kollegium
legialen Kooperation (gegenseitige Unterstützung, mehrheitlich zufrieden, sieht aber in verschiedener der kollegialen Kooperation feststellbar. Ein hoher wird bewusst gestaltet (z.B. Festhalten von
kooperative Problemlösungen u.a.) spürbar. Hinsicht noch einen Verbesserungsbedarf. Grad an Identifikation mit dem Kollegium bzw. mit Kommunikationsregeln) und mit Blick auf lei-
der Schule ist spürbar. Es gibt Beispiele für erfolg- tende Werte (z.B. gegenseitige Wertschätzung,
reiche kooperative Problemlösungen. Vertrauen) reflektiert.
Schulführung – Qualitätsstufen, Aspekte und Indikatoren – 6. Förderung und Unterstützung der schulinternen Zusammenarbeit 217.
Leitung und Moderation von Sitzungen, Konferenzen
und Veranstaltungen
Sitzungen, Konferenzen und Veranstaltungen werden so
geleitet und moderiert, dass die Prozesse (Informations-,
Austausch-, Meinungsbildungs- und Entscheidungs
prozesse) strukturiert und effizient verlaufen und ein
sinnvolles (zielführendes) Ausmass an Partizipation
ermöglichen.
22 Schulführung – Dimension und LeitsatzDefizitstufe Elementare Fortgeschrittene Excellence-Stufe
Entwicklungsstufe Entwicklungsstufe
7.1 Vor- und Nachbereitung
■■ Sitzungen, Konferenzen und Veranstaltungen ■■ Sitzungen, Konferenzen und Veranstaltungen ■■ Sitzungen, Konferenzen und Veranstaltungen ■■ Es gibt ein differenziertes Konzept für
sind ungenügend vor- und nachbereitet. sind vor- und nachbereitet. Die Traktanden werden sind sorgfältig vor- und nachbereitet. Traktanden unterschiedliche Informations- und Partizi-
im Voraus bekannt gegeben. und hilfreiche Unterlagen werden rechtzeitig pationsgefässe. (Sitzungen, Konferenzen und
verteilt. Veranstaltungen werden als Elemente eines
differenzierten schulinternen Informations- und
Kommunikationsprozesses betrachtet.)
7.2 Strukturiertheit und Zielorientierung
■■ Die Schulleitung führt Sitzungen und Veranstal- ■■ Die Schulleitung sorgt für einen geordneten ■■ Die Schulleitung führt Sitzungen und Veranstal- ■■ Ergebnisprotokoll und Problemspeicher
tungen unstrukturiert, verworren, wenig zielstrebig Sitzungsverlauf. tungen strukturiert und zielstrebig – unter Einbezug werden konsequent und einheitlich geführt und
und nicht zielorientiert. ■■ Die Leitung und Moderation der Sitzungen wird der notwendigen bzw. sinnvollen Partizipations- sichern die Kontinuität / Nachhaltigkeit / Ver-
■■ Die Leitung und Moderation der Sitzungen wird von den Teilnehmenden teilweise hilfreich erlebt. möglichkeiten. bindlichkeit der Diskussionen und Beschlüsse.
von den Teilnehmenden als wenig hilfreich erlebt: ■■ Die Leitung und Moderation der Sitzung wird
Informationssequenzen werden unnötig in die von den Teilnehmenden als förderlich erlebt: Sie
Länge gezogen, eine offene Meinungsäusserung ermöglicht einen zielorientierten Verlauf sowie eine
wird blockiert usw. offene Meinungsäusserung – ohne die zeitliche und
inhaltliche Struktur aus den Augen zu verlieren.
7.3 Einbezug der Teilnehmenden
■■ Die von der Schulleitung gewählten Arbeitsfor- ■■ Es gibt einen Wechsel von darbietenden und ■■ Die Schulleitung ermöglicht eine aktive und ■■ Die Schulleitung holt bei den Teilnehmenden
men sind den jeweiligen Konferenz- und Sitzungs- partizipativen Sequenzen. Das Gleichgewicht zwi- ausgewogene Beteiligung. Die Teilnehmenden regelmässig Rückmeldungen zur Leitung und
zielen schlecht angepasst. schen effizienter Information / Gesprächsführung können sich einbringen und zur Sachklärung / Moderation der Schulsitzungen und Veranstal-
und sinnvoller Partizipation gelingt nicht immer Entscheidungsfindung beitragen. Unterschiedliche tungen ein.
zufrieden stellend. Meinungen werden akzeptiert und als Chance für
eine vertiefte Sachklärung begrüsst.
7.4 Transparenz der Funktion der Traktanden
■■ Die Funktion der Sitzungstraktanden bleibt meis- ■■ Den Teilnehmenden ist nicht immer klar, ■■ Es ist für die Teilnehmenden klar ersichtlich, ■■ Die Länge und die Gestaltung der Traktanden
tens unklar oder wird erst «ad hoc» geklärt. welche Funktion ein Sitzungstraktandum bzw. eine in welcher Phase der Entscheidungsfindung / stehen in einem idealen Verhältnis zu ihrer
Sitzungssequenz im Entscheidungsprozess besitzt. Beschlussfassung sich ein Traktandum jeweils be- Funktion und zum Inhalt.
findet (Information, Meinungsbildung, Konsultation, ■■ Die Ergebnisse aus den Schulsitzungen sind
Beschlussfassung usw.). so abgelegt, dass alle Mitarbeitenden Zugriff
darauf haben.
7.5 Zufriedenheit der Teilnehmenden
■■ Die Teilnehmenden äussern sich unzufrieden ■■ Die Teilnehmenden äussern sich mehrheitlich ■■ Die Teilnehmenden sind mit dem Verlauf, dem ■■ Die Zufriedenheit der Teilnehmenden mit
über den Verlauf und die Effizienz von Sitzungen, zufrieden über den Verlauf und über die Effizienz Ausmass und Effizienz der Sitzungen, Konferenzen dem Rhythmus, dem Verlauf, der Effizienz von
Konferenzen und Veranstaltungen. der Sitzungen, Konferenzen und Veranstaltungen; und Veranstaltungen, dem Ausmass der Partizipa Sitzungen, Konferenzen und Veranstaltungen
sie sehen allerdings an verschiedenen Punkten tion und der Effizienz mehrheitlich zufrieden. wird in regelmässigen Abständen evaluiert
einen Optimierungsbedarf. und als Grundlage für geeignete Optimierungs
massnahmen genutzt.
Schulführung – Qualitätsstufen, Aspekte und Indikatoren – 7. Leitung und Moderation von Sitzungen, Konferenzen und Veranstaltungen 23Sie können auch lesen