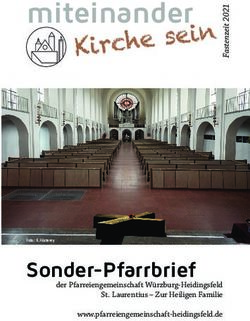Sinfoniekonzert 2021/2022 - Vogtland Philharmonie
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
2. Sinfoniekonzert 2021/2022
PROGRAMMHEFT
Pavel Berman / Violine · Dorian Keilhack / Dirigent
13. OKTOBER 2021
16.00 & 19.30 Uhr – Reichenbach, Neuberinhaus
15. OKTOBER 2021
16.00 & 19.30 Uhr – Greiz, VogtlandhalleBegeistern
ist einfach.
Wenn man einen starken
Partner hat, der die Förde-
rung von Kunst, Kultur,
Sozialem und Sport in der
Region aktiv unterstützt.
sparkasse-vogtland.dePROGRAMM
Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791)
Ouvertüre zur Oper La clemenza di Tito KV 621
Peter Iljitsch Tschaikowsky (1840–1893)
Violinkonzert D-Dur op. 35
I. Allegro moderato – moderato assai – allegro giusto
II. Andante
III. Finale. Allegro vivacissimo
Pause
Ludwig van Beethoven (1770–1827)
Sinfonie Nr. 7 A-Dur op. 92
I. Poco sostenuto – Vivace
II. Allegretto
III. Presto – assai meno presto
IV. Allegro con brio
Konzertdauer ca. 1 Stunde und 40 Minuten
HERAUSGEBER Vogtland Philharmonie Greiz/Reichenbach e. V. Tel.: 03765 13470
vertreten durch den Intendanten (ViSdPR) GMD Stefan Fraas Fax: 03765 21170
Geschäftsstelle in der Vogtlandhalle Greiz: Carolinenstraße 15, 07973 Greiz info@vogtland-philharmonie.de
Geschäftsstelle am Park der Generationen: Wiesenstraße 62, 08468 Reichenbach www.vogtland-philharmonie.de
REDAKTION Michael Pauser, Matthias Pohle, Andrea Rybka SATZ Michael Pauser /vogtlandphilharmonie
1EINFÜHRUNG INS PROGRAMM
Als am 6. September 1791 im Prager Nationaltheater Wolfgang
Amadeus Mozarts (1756–1791) Oper La clemenza di Tito
(dt. Die Milde des Titus) KV 621 uraufgeführt wurde, wusste der
Komponist nicht, dass er 90 Tage später tot sein würde. Im selben
Monat erlebte Die Zauberflöte KV 620 ihre Premiere. Auch die
bekannte Motette Ave verum corpus KV 618, das berühmte Klari-
nettenkonzert A-Dur KV 622 und natürlich das Fragment geblie-
bene Requiem d-Moll KV 626 stammen alle aus der gleichen Zeit,
die eine äußerst produktive war. Die Musikgeschichte hat gezeigt,
dass es sich bei all diesen Werken um zeitlose Meisterwerke han-
delt. La clemenza di Tito hatte allerdings keinen guten Start, genau
genommen war die Uraufführung ein Desaster für Mozart.
Anlass für die Uraufführung in Prag war die Krönung Kaiser Leo-
polds II. (1747–1792) zum König von Böhmen. Seine Frau María
Wolfgang Amadeus Mozart
Luisa de Borbón (1745–1792), die die Tochter des spanischen
Königs Karl III. (1716–1788) und der Enkelin von August dem Starken (1670–1733) Maria Amalia
von Sachsen (1724–1760) war, zeigte sich entsetzt über Mozarts Musik. Da sie in Neapel, einem der
größten europäischen Opernzentren, aufgewachsen war und wusste, was sich in einer Oper ‚gehört‘,
urteilte sie über das, was Mozart in Prag auf die Bühne brachte, es sei „eine deutsche Schweinerei“ (wört-
lich: „porcheria tedesca“).
Die Handlung der Oper ist eigentlich schnell erzählt: enttäuschte Liebe einer Frau – Rache und Ver-
schwörung gegen den Kaiser – Plan geht daneben – alles fliegt auf – ‚logisch‘ wären nun Todesurteile
– es kommt jedoch ganz anders. Die vielen beteiligten Personen machen die Situation allerdings etwas
unübersichtlich: Wir befinden uns im Römischen Kaiserreich während der Regentschaft von Kaiser
Titus Flavius Vespasianus (39–81 n. Chr.) und schreiben das Jahr 79 n. Chr. Vitellia, die Tochter des
ehemaligen Kaisers Vitellio (12/15–69 n. Chr.), ist erbost über Titus, der eine andere als sie zur Frau
nehmen will. Sie nutzt die Situation von Titus’ Freund Sextus aus, der seinerseits in Vitellia verliebt ist.
Diese verspricht sich ihm, wenn er Titus stürzen würde, um so Rache an diesem zu nehmen.
Gerade noch rechtzeitig erfährt Vitellia, dass Titus sich von seiner Auserwählten getrennt hat. Nun
kommt sich Sextus benutzt vor. Als Titus Vitellia bei der Wahl seiner neuen Frau wiederum nicht in
Betracht zieht, sondern Servilia, die Schwester seines Freundes Sextus, die eigentlich Sextus’ Freund
Annio heiraten will, wird es kompliziert. Denn gerade als Sextus Titus bitten will, Annios Werbung um
Servilia seinen kaiserlichen Segen zu geben, kommt ihm Titus zuvor und teilt ihm mit, dass er dessen
Schwester heiraten wolle. Da überredet Vitellia Sextus erneut zum Sturz. Diesmal kann sie ihn jedoch
nicht mehr aufhalten, als sie erfährt, dass Titus mittlerweile weiß, dass sich Annio und Servilia lieben
und er dieser Liebe nicht im Wege stehen möchte.
Der Sturz scheint geglückt zu sein, doch es wurde der Falsche verwundet; Titus überlebt und erfährt,
was vorgefallen ist. Da Sextus als offensichtlicher Verschwörer entlarvt werden kann, gibt es nur eine
mögliche Konsequenz: Hinrichtung. Doch Titus mag das Todesurteil nicht unterschreiben. Schließ-
2Vorbild für den Opernhelden: der historische Kaiser Titus, der u. a. das Kolosseum in Rom vollendete. Davor: der Titus-Bogen.
lich tut er es doch, aber zerreißt es wieder. Vitellia wird derweil von Gewissensbissen erdrückt, denn
immerhin soll der Mann sterben, der sie aus Liebe zu ihr nicht als eigentliche Drahtzieherin der Ver-
schwörung nennt. Im – wie sie glaubt – allerletzten Moment, als die Delinquenten bereits vorgeführt
werden, gesteht sie Titus die gesamte Wahrheit. Völlig entgegen rationaler Herrscher-Logik lässt Titus
Milde walten und begnadigt alle.
Folgende Aufführungen von La clemenza di Tito am Wiener Kärntnertor-Theater 1792 oder in Ham-
burg 1796 waren sehr erfolgreich und steigerten Mozarts Ruhm – wovon dieser allerdings nichts mehr
hatte. Johann Wolfgang von Goethe (1749–1832) hat sogar das neue Theater in Bad Lauchstädt mit
Mozarts Oper eröffnet. Dazu ließ er allerdings das ursprünglich italienische Libretto, das von Pietro
Metastasio (1698–1782) stammt und bereits vom Dresdener Hofdichter Caterino Mazzolà (1745–
1806), der nach der Verbannung von Lorenzo Da Ponte (1749–1838), der die Libretti zu Mozarts
drei vorangegangenen Opern geschrieben hatte, nach Wien ‚ausgeliehen‘ wurde, durchaus verbessert
worden war, von seinem späteren Schwager und Weimarer Schriftsteller Christian August Vulpius
(1762–1827) ins Deutsche übersetzen.
Es gibt viele gute Gründe
für nachhaltige Vorsorge.
Aber eigentlich reicht
einer, oder?
Welcher? Für jede
Verraten wir Ihnen. abgeschlossene
Versicherung mit
nachhaltigen Fonds
pflanzen wir im Zurich
Forest einen Baum
für Sie.
Filialdirektion
Czerwenka-Finanz
Markt 13
07973 Greiz
michael.czerwenka@zuerich.de
Anzeige_2021_10_008_Z-53-6-A_4c.indd 1 04.10.21 15:35
3Großes Glück und tiefe Krise lagen bei Peter Iljitsch
Tschaikowsky oft nah beieinander. Im Januar 1878
hatte er seine 4. Sinfonie und seine bis heute bekann-
teste Oper Evgenij Onegin vollendet. Gleichzeitig trenn-
te er sich von seiner Frau Antonina Ivanova Miljukova
(1848–1917). In weniger als einem Monat komponierte
Tschaikowsky sein Violinkonzert. Gemeinsam mit sei-
nem Moskauer Schüler, dem Geiger Iosif Kotek (1855–
1885), verbrachte er den März in Clarens am Genfer See.
So konnte die Komposition intensiv gespielt und somit
verbessert werden. Dennoch verwarf Tschaikowsky den
2. Satz komplett und schrieb einen neuen. Glücklicher-
weise landete der alte Mittelsatz nicht im Papierkorb,
sondern eröffnet als Méditation die drei Stücke für Vio-
Tschaikowsky (rechts) mit Iosif Kotek, 1877
line und Klavier op. 42.
Kotek sollte wohl ursprünglich auch Widmungsträger des Violinkonzertes sein. Doch dies hätte
die Gerüchte über eine Beziehung der beiden Männer noch weiter befeuert. Der Klavierauszug
ist dem Geiger Leopold Auer (1845–1930) gewidmet, die Partitur allerdings Adolf Brodskij
(1851–1929). Letzterer war zugleich der Solist bei der Uraufführung in Wien 1881. Von der
Presse verrissen, wurde sie vom Publikum gefeiert. Einst wollte Kotek das Konzert spielen und
hätte gern Tschaikowsky als Dirigenten gehabt. Doch es kam nie zu einer gemeinsamen Auffüh-
rung, gleichwohl beide das Werk mehrfach im Konzert präsentierten. Leopold Auer wiederum
war der Solist, als das Werk 1893 bei Tschaikowskys Beerdigung gespielt wurde.
Im Jahr 2009 stand das Violinkonzert Tschaikowskys im Mittelpunkt des Filmes Das Kon-
zert von Radu Mihăileanu. Er erzählt die fiktive Geschichte, wie der ehemalige Chefdirigent
des Moskauer Bolschoi-Orchesters Andrej Filipow, der mittlerweile zum Hausmeister degradiert
worden ist, sein altes Orchester zusammentrommelt, nachdem er beim Putzen ein Fax mit der
Einladung des Bolschoi nach Paris abgefangen hatte. Tschaikowskys Violinkonzert war es, das er
gerade dirigierte, als ihm die Sowjetunion Berufsverbot erteilte und ihn der KGB mitten im Kon-
zert von der Bühne holte. Nun, einige Jahre nach Ende des Kalten Krieges, möchte Filipow sein
damaliges Konzert zu Ende bringen. Doch mehr noch: Als Solistin wählt er die junge Geigerin
Anne-Marie Jacquet, die zwar den Dirigenten nicht kennt, aber aufgrund des großen Namens des
Orchesters einwilligt. Was Anne-Marie nicht weiß, ist, dass sie das Kind einer ehemaligen Or-
chestermusikerin ist, die mit ihrem Mann in sibirischer Verbannung starb. Bei aller Komik, die
der Film beinhaltet, wird diese tragische Geschichte aufgelöst, indem alle Protagonisten durch
die Kraft der Musik, die in Tschaikowskys Violinkonzert steckt, ihre schicksalhafte Vergangen-
heit überwinden.
Ohne die persönliche Tragik im Leben des Komponisten wäre wahrscheinlich dieses tiefgrün-
dige Violinkonzert niemals entstanden. Der Musikkritiker Eduard Hanslick (1825–1904), der
in Bezug auf Tschaikowskys Werk meinte, es gäbe nun „auch Musikstücke […], die man stinken
hört“, behielt nicht Recht. Denn bis heute zählt es zu den meistgespielten Violinkonzerten auf
der Welt, das zudem bei Musikern wie Publikum einen hohen Stellenwert genießt.
4Dreizehn Jahre nach der Uraufführung von Ludwig van Beethovens erster
Sinfonie hatte die siebente Premiere. Allerdings war er nach der fünften
und sechsten (beide 1808) fünf Jahre lang nicht als Sinfoniker vor sein
Publikum getreten. Beethoven brauchte Geld und so gab er mit Unterstüt-
zung des Erzherzogs ein Konzert im Redoutensaal der Wiener Universität.
Auffällig ist dabei der verhältnismäßig riesige Orchesterapparat, der Beet-
hoven sogar einen Eintrag in sein Tagebuch wert war: je 18 1. und 2. Vio-
linen, 14 Violen, zwölf Violoncelli und sieben Kontrabässe wurden aufge-
boten. Trotz teilweise niederschmetternder Kritik wurde das Konzert ein
großer Erfolg und sorgte für eine deutliche Verbesserung von Beethovens
Gemütszustand. Immerhin schritt der Verlust seines Gehörs nun merklich
voran und von der bis heute unbekannten „Unsterblichen Geliebten“ hatte
er sich auch kürzlich erst getrennt, was für ihn bedeutete, dass sich endgül-
tig alle Träume einer Familie in Luft auflösten.
Ludwig van Beethoven (1815)
Der 1. Satz Poco sostenuto – Vivace beginnt mit einer ausgedehnten lang-
samen Einleitung, gleichwohl das Wort ‚Einleitung‘ nicht die Dimension widerspiegelt, um die es
sich tatsächlich handelt. Beethoven lässt hier wie an kaum einer anderen Stelle in seinem sinfonischen
Schaffen den Hörer miterleben, wie seine Musik aus einer Quelle entspringt. Aus den einfachsten
musikalischen Bausteinen, nämlich Dreiklang und Tonleiter, entsteht nach und nach ein pulsierender
Rhythmus, der sich im Vivace endgültig zeigt und zum bestimmenden Element des Satzes wird. Erst
beim zweiten Hören kann man wissen, dass dies bereits in der Einleitung angelegt ist: Dort sind es
maßgeblich die Holzbläser, die neben melodischen Episoden klare rhythmische Einheiten vorstellen.
Wie Beethoven den Hörer auf das Entstehen des Rhythmus’ konzentriert, ist gleichsam einfach wie
genial. Er lässt das gesamte Orchester nur einen einzigen Ton spielen: ein e in sämtlichen Stimmen.
Dieser Ton ist sowohl im Dreiklang der Tonika als auch der Dominante enthalten, weswegen man als
Zuhörer nicht sicher sein kann, was gleich passieren wird. Da die Parameter Melodie und Harmonie
ausgeschaltet sind, steigt die Spannung mit jeder weiteren Wiederholung des Tons. Eher schlicht be-
ginnt hingegen der Hauptteil des Satzes. In Windeseile baut sich das Orchestertutti auf, indem wie im
Sog stetig weitere Instrumente hinzutreten sowie schließlich das Thema eine alles und jeden mitreißen-
de Kraft entwickelt.
Auf den ersten Blick scheint es heute etwas merkwürdig, doch es war der 2. Satz Allegretto, der das
Uraufführungspublikum so stark begeisterte, dass es sofort die Wiederholung verlangte. Bis heute gibt
es mehrere Deutungen des Satzes. Oft wird er als Trauermarsch bezeichnet, obwohl dafür weitere An-
haltspunkte fehlen. Der schreitende Charakter dieser Musik ist unbestritten. Allerdings gibt es auch
eine Deutung abseits der Trauerthematik. Auffällig ist einerseits, dass der musikalische Rhythmus des
Satzes an den Sprachrhythmus der Litanei erinnert: „Sancta Maria, ora pro nobis“ („Heilige Maria, bitte
für uns“). Diese Deutung wird umso plausibler, wenn man das Lauter- und Leiserwerden der Musik als
einen sich nähernden und wieder entfernenden Prozessionszug deutet.
Einigermaßen unerklärlich bleiben jedoch Beginn und Schluss des Satzes. Beide dürfte es nach der
Musiktheorie der damaligen Zeit nicht geben. Allerdings war es nicht das erste Mal, dass Beethoven
sich nicht darum kümmerte, was ‚erlaubt‘ ist und was nicht. Es handelt sich beide Male um einen
Quartsextakkord, d. h. der Akkord steht ‚verkehrt herum‘ auf der Quinte. Dies gibt es eigentlich nur
in zwei Fällen: entweder als Vorhalt zu einem ‚richtigen‘ Akkord, in dem sich der vermeintlich ‚fal-
sche‘ Ton im Bass als Grundton der Tonika herausstellt, oder als eine Art musikalischer Doppelpunkt.
Denn oft werden Solo-Kadenzen so vorbereitet, dass das Orchester mit einem Quartsextakkord en-
5°B 2
Viola 4œ œ. œ. œ. œ. œ œ. œ. œ. œ. œ œ. # œœ. œœ œœ œœ œ œœ œœ Œ
. . œ. .
?2 œ œ œ
Violoncello 4 . . œ. œ. œ œ. œ. œ. œ. œ œ. œ. œ. œ. œ œ. œ. œ Œ
?2 Œ
Kontrabass ¢ 4 œ œ. œ. #œ. œ. œ œ. œ. œ. œ. œ œ. œ. nœ. œ. œ œ. œ. œ
San- cta Ma - ri - a o - ra pro no - bis...
Beethovens Musik aus dem 2. Satz der 7. Sinfonie mit dem hypothetisch unterlegten Text aus der Litanei.
det, der tonartlich eben nicht klar bestimmt ist und somit Raum für freie Fortspinnung öffnet. Dass
dieser Doppelpunkt nun am Anfang und Ende steht, gibt dennoch Rätsel auf. Jedenfalls verlangt der
Schlussakkord nach Auflösung, die es aber nicht gibt.
Es folgt mit dem 3. Satz Presto – assai meno presto, wenn auch von Beethoven nicht explizit so
bezeichnet, ein zünftiges Scherzo. Das vorwärts drängende Thema, das sich nach zwei einleitenden
forte-Takten erst im piano entwickelt und sich schließlich ins fortissimo des gesamten Orchester-Tutti
steigert, läuft allerdings zunehmend ins Leere. Irgendwann endet jeder neue Versuch Fahrt aufzuneh-
men im starren unisono mit nur einem einzigen Ton – ähnlich wie im 1. Satz. Diesmal ist es a, das
sich sowohl die Grundtonart des Satzes (F-Dur) als auch das Trio (assai meno presto) teilen. Plötzlich
scheint alles umgekehrt: ruhigeres Tempo, kleinere Besetzung, die Melodie gewinnt die Oberhand über
den Rhythmus, statt Derbheit steht plötzlich die Spielanweisung dolce („sanft“, „süß“) in der Partitur.
Insgesamt ist der Satz fünfteilig: Scherzo – Trio – Scherzo – Trio – Scherzo. Man erschrickt allerdings
kurz, als am Ende des dritten Scherzo-Teils noch einmal das Trio anzufangen scheint: Die ersten beiden
Takte erklingen und werden in Moll wiederholt, bevor fünf Orchesterschläge im fortissimo diesem –
ganz anders als dem zweiten – Satz unmissverständlich einen Schlussstrich setzen. Robert Schumann
(1810–1856) meinte dazu: „Man sieht den Komponisten ordentlich die Feder wegwerfen.“
In der Fortführung der vorangegangenen Sätze ist der 4., das Finale Allegro con brio, zwar konsequent,
aber zumindest für Beethovens Zeitgenossen im wahrsten Sinne unfassbar gewesen. Carl Maria von
Weber (1786–1826) erklärte Beethoven „reif fürs Irrenhaus“ und Clara Schumanns (1819–1896) Vater
Friedrich Wieck (1785–1873) meinte, „daß diese Sinfonie nur im unglücklichen – im trunkenen Zustan-
de komponiert“ worden sein könne. Doch was erregte die Gemüter? So klar beantworten kann man
das gar nicht, denn Urteile, wie die obigen Beispiele, waren stets pauschalisierend und wenig konkret.
Vielleicht kam man sich einfach nur verschaukelt vor, da man Beethoven schon zu dieser Zeit als den
großen Denker stilisierte. Ihm Witz, ironische Brechung und vor allem die Adaption einfacher, volks-
tümlich-rustikaler Musik zu unterstellen, kam für viele nicht infrage. Doch genau das passiert hier!
Beethoven steigerte das, was in den drei vorhergehenden Sätzen bereits angelegt ist: Purer Rhythmus,
kraftvoll vorgetragen – eine „Apotheose des Tanzes“, wie es Richard Wagner (1813–1883) später formu-
lierte. In der Tat bricht sich ein wahrer Exzess Bahn. Die Themen und erst recht deren Verarbeitung
scheinen Nebensache zu sein.
Text: Michael Pauser
6SOLIST & DIRIGENT
Vitae
Pavel Berman wurde in Moskau geboren. Hier erhielt er Unterricht am
Tschaikowsky-Konservatorium und studierte später bei Dorothy DeLay
an der Juilliard School in New York sowie bei Isaac Stern. Internationale
Aufmerksamkeit erlangt er 1990 mit dem Ersten Preis und der Goldme-
daille des Internationalen Violinwettbewerbs von Indianapolis. Er trat als
Solist und Dirigent mit erfolgreichen Kammerensembles und bedeuten-
den Orchestern weltweit auf. Dazu gehören u. a. das Moscow Symphony
Orchestra, die Prager Philharmoniker, die Dresdener Staatskapelle sowie
viele weitere Klangkörper aus Europa, Asien und Amerika. Dabei begei-
sterte er das Publikum in renommierten Häusern wie der Carnegie Hall
in New York, dem Théâtre des Champs Elysées in Paris, dem Herkulessaal in München oder der
Mailänder Scala. 1998 gründete er das Kaunas Chamber Orchestra in Litauen, welches unter seiner
musikalischen Leitung zum Sinfonieorchester wuchs.
Berman tätigte zahlreiche Einspielungen für Koch International, Audiofon, Discover, Phoenix Classics
und Dynamic, unterrichtet in Lausanne und spielt die Stradivari-Violine „Conte de Fontana“ (Cremo-
na 1702), die ihm von der Mailänder Stiftung Pro Canale geliehen wurde und zuvor u. a. im Besitz von
Dawid Oistrach und Paolo Peterlongo war.
Dorian Keilhack erhielt seine Ausbildung an den Hochschulen
für Musik in Nürnberg, Freiburg, Würzburg und der renommierten
Juilliard School New York. Als mehrfach ausgezeichneter Dirgent
und Pianist trat er u. a. mit dem MDR Sinfonieorchester, im Gewand-
haus zu Leipzig oder BBC Welsh Symphony auf, debütierte beim
Collegium Novum Zürich und stand u. a. bei Orchestern in Regensburg,
Meiningen, Bonn, Mönchengladbach, Lübeck, Mannheim, Schwerin
sowie wiederholt bei der Vogtland Philharmonie am Pult. Er war an
Opernhäusern wie Nürnberg, Innsbruck, Erfurt und Bern als So-
lorepetitor, Studienleiter sowie 1. Kapellmeister engagiert, mehre-
re Jahre künstlerischer Leiter des Tiroler Ensembles für Neue Musik und dirigierte an verschiede-
nen Opernhäusern Uraufführungen zeitgenössischer Komponisten. Sein großes Interesse gilt der
Neuen Musik. Seit 2013 ist er künstlerischer Leiter des Kammerorchesters Camerata Franconia.
2014 übernahm er die Leitung der Opernschule des Landeskonservatoriums Innsbruck. Darüber hin-
aus ist er als Gast bei verschiedenen Festivals in Europa sowie als Dozent und Gastprofessor der Miami
Frost University tätig. Seit der Spielzeit 2019/2020 ist er Dirigent der Vogtland Philharmonie sowie
seit der Saison 2020/2021 Chefdirigent.
7nosferatu
FAMILIENKONZERT
Galakonzert mit
ANGELIKA M!LSTER
s i c al,
Mu ck
Ro p
o
&P
So, 17.10.21, 17.00 Uhr, Zwickau, Neue Welt
Tickets: Neue Welt 0375-2713260, Tourist-Info -2713240, Eventim
Sa, 23.10.21, 17.00 Uhr, Reichenbach, Neuberinhaus
Live-Vertonung der Tickets: Tourist-Info mit
Stummfilmlegende 03765-3259240,
VorführungEventim
über 35mm- Kinoprojektor
So, 21.11.21,
Sa, 15.00 & 18.00
07.05.22, 17.00Uhr,
Uhr,Reichenbach, Neuberinhaus
Greiz, Vogtlandhalle
Tickets:Vogtlandhalle
Tickets: Tourist-Information 03765-3259240,
03661-62880, Eventim
Tourist-Info -689815
nosferatu
FAMILIENKONZERT
Live-Vertonung der Stummfilmlegende mit Vorführung über 35mm- Kinoprojektor
So, 21.11.21, 15.00 & 18.00 Uhr, Reichenbach, Neuberinhaus
Tickets: Tourist-Information 03765-3259240, Eventim
3.FAMILIENKONZERT
SINFONIEKONZERT
Mi, 10.11.21, 16.00 & 19.30 Uhr, Reichenbach, Neuberinhaus
Fr, 12.11.21,
So, 21.11.21, 15.0016.00 & 19.30
& 18.00 Uhr,Uhr, Greiz, Vogtlandhalle
Reichenbach, Neuberinhaus
Tickets:
Tickets (25 €, Abo 17 €):Tourist-Information 03765-3259240,
Tourist-Info RC 03765-3259240, Eventim 03661-62880
VogtlandhalleFAMILIENKONZERT
So, 21.11.21, 15.00 & 18.00 Uhr, Reichenbach, Neuberinhaus
Tickets: Tourist-Info 03765-3259240, Eventim
naumann.classiX
Ein Kammermusikabend im industriellen Charme einer ehemaligen Greizer Schmiede mit dem
Variscia Trio der Vogtland Philharmonie
Fr, 26.11.21, 19.30 Uhr, Greiz, 10aRium (Naumannstraße 10)
Tickets: entspann.baR (montags 17-20 Uhr, 10aRium), Tourist-Info 03661-689815, 10aRium.de
IT‘S CHRISTMAS TIME
Fr, 17.12.21, 19.30 Uhr, Reichenbach, Neuberinhaus
Tickets: Tourist-Info 03765-3259240, EventimDi, 19.10., 15.30 Uhr, Greiz, Vogtlandhalle
Tickets: Vogtlandhalle 03661-62880, Tourist-Info -689815
Dirigent & Moderation: GMD Stefan Fraas
Mi, 20.10., 14.30 Uhr, Plauen, Festhalle
Tickets u.a.: Festhalle 03741-2912444, tickets-plauen.de
Dirigent & Moderation: GMD Stefan Fraas
So, 24.10., 17.00 Uhr, Rodewisch, Ratskellersaal
Tickets u.a.: Stadtverwaltung 03744 368125
Dirigent & Moderation: Dorian KeilhackSie können auch lesen