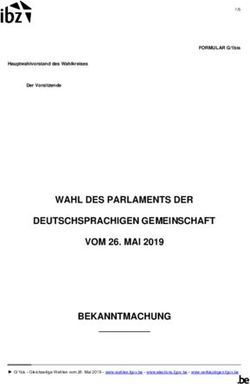Smartvote, Facebook und andere Wahlfaktoren
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Universität Bern Bachelorarbeit
Institut für Politikwissenschaft Betreuer: Dr. Daniel Schwarz
Smartvote, Facebook
und andere Wahlfaktoren
Eine statistische Untersuchung der
Berner Grossratswahlen 2010
28. Februar 2011
Samuel T. Kullmann Hohlengasse 10, 3661 Uetendorf
07-112-675 kullmann@students.unibe.chBachelorarbeit Samuel Timutschin Kullmann 28. Februar 2011
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung 3
2 Theorie 5
2.1 Stärke der Liste/Partei 6
2.2 Bisher-Status 7
2.3 Vorkumulierung 9
2.4 Listenplatz 10
2.5 Kandidatur Regierungsrat 13
2.6 Geschlecht 14
2.7 Alter 17
2.8 Smartvote 20
2.9 Facebook 22
3 Methode 26
3.1 Statistische Modelle und abhängige Variablen 26
3.2 Unabhängige Variablen 26
3.3 Kontrollierende Variablen 28
3.4 Heteroskedastizität 29
3.5 Clustereffekte 30
4 Resultate 31
4.1 Kurzanalyse der Daten 31
4.2 Ergebnisse der multivariaten Regressionsanalyse 32
4.3 Vergleich zwischen den Parteien 38
4.4 Vergleich zwischen den Wahlkreisen 40
4.5 Ergebnisse des Probit-Modells 42
5 Fazit 44
6 Literatur- und Quellenverzeichnis 46
7 Selbstständigkeitserklärung 49
8 Anhang I: Stimmen und Panaschierstimmen 50
9 Anhang II: Clustereffekte 52
10 Anhang III: Abkürzungsverzeichnis 54
-2-Bachelorarbeit Samuel Timutschin Kullmann 28. Februar 2011
1 Einleitung
Nur wenige andere Länder kennen ein proportionales Wahlsystem, welches den Wäh-
lerinnen und Wählern so viel Entscheidungsspielraum lässt wie das Schweizerische
(vgl. Norris, 2006). In der Schweiz bestimmt nicht die Partei den unveränderlichen
Listenplatz und somit zu einem grossen Teil die Wahrscheinlichkeit eines Wahlerfolgs.
Stattdessen ist die Aggregation aller individuellen Wahlzettel für die Wahl eines be-
stimmten Kandidaten von grösster Bedeutung.
Lässt sich also daraus schliessen, dass ein Wahlerfolg weitgehend von der persönli-
chen Motivation und dem Engagement der Kandidierenden abhängt? Ist ein Kandidat
seines Glückes eigener Schmied? Oder gibt es Faktoren, die ein gutes Stimmenergeb-
nis massgebend beeinflussen können? Wenn ja, welchen Einfluss hat eine Kandidatin
darauf? Wie gross ist dabei der strategische Spielraum der Parteien?
Diese Arbeit geht diesen Fragen nach und erörtert, inwiefern diverse persönliche
Eigenschaften und parteipolitische Faktoren einen Wahlerfolg im Idealfall bereits si-
cherstellen oder – im weniger günstigen Fall – bereits im Vorfeld so gut wie verun-
möglichen können. Die Ergebnisse dieser Arbeit weisen somit theoretische Relevanz
auf, da die bestehende Forschung zur parlamentarischen Unterrepräsentation von
Frauen oder jungen Menschen ergänzt wird. Noch grösser dürfte aber die praktische
Relevanz für ambitionierte Kandidierende sein, die sich im Vorfeld einer Wahl Gedan-
ken über ihre Wahlchancen machen und abwägen müssen, wie viel Zeit und Geld sie
in welche Aspekte ihres Wahlkampfes investieren möchten.
In einem ersten Teil wird der Einfluss von neun Faktoren auf den Stimmenanteil der
1938 Kandidatinnen und Kandidaten der Berner Grossratswahlen 2010 theoretisch
hergeleitet und begründet. Diese Faktoren umfassen unveränderliche Eigenschaften
der Kandidierenden (wie das Alter), parteistrategische Vorbedingungen (wie der Lis-
tenplatz) und schliesslich auch Aspekte des persönlichen Engagements (wie eine
Smartvote-Teilnahme). Während die meisten dieser Faktoren bereits Eingang in die
politikwissenschaftliche Literatur fanden (vgl. Theorieteil dieser Studie), greift diese
Arbeit mit der boomenden social community Plattform „Facebook” zusätzlich einen
-3-Bachelorarbeit Samuel Timutschin Kullmann 28. Februar 2011
Faktor auf, der in der Schweiz bisher viel und kontrovers diskutiert 1, aber dessen
wahlpolitische Auswirkungen kaum empirisch überprüft wurde.
Im Methodenteil wird die Erfassung der Daten und die Kodierung der modellrele-
vanten Variablen diskutiert. Mittels einer multivariaten Regressionsanalyse wird der
durchschnittliche Einfluss der untersuchten Faktoren statistisch auf ihre Signifikanz
und ihre Auswirkung überprüft. Ein Logitmodell ergänzt das erste Modell und berech-
net die statistische Wahrscheinlichkeit einer direkten Wahl unter Berücksichtigung der
zuvor definierten Faktoren.
Im folgenden Teil der Arbeit werden die Resultate erläutert, wobei aufgrund der
umfassenden Datenmenge (N=1938) auch auf separate Analysen von einzelnen Partei-
en und Wahlkreisen eingegangen werden kann. Ein Fazit rekapituliert die Erkenntnisse
dieser Arbeit und erörtert den weiteren Forschungsbedarf.
-4-Bachelorarbeit Samuel Timutschin Kullmann 28. Februar 2011
2 Theorie
2007 haben Mark Balsiger und Hubert Roth ein Handbuch für Kandidierende heraus-
gegeben, in welchem sie unter anderem eine detaillierte statistische Analyse der Nati-
onalratswahlen 2003 machten (vgl. Balsiger und Roth, 2007). Zwischen dieser Studie
und dieser Bachelorarbeit gibt es einige Parallelen, aber auch grössere Unterschiede.
Auf diese soll hier eingegangen werden:
Beide Studien versuchen die Frage zu beantworten, wie sich der Wahlerfolg von
Kandidierenden erklären lässt. Balsiger und Roth unterscheiden dabei zwischen einem
„absoluten Wahlerfolg” und einem „relativen Wahlerfolg”. Demnach hat ein Kandidat
einen absoluten Wahlerfolg verbucht, wenn er direkt den Einzug in den Nationalrat
erreichte. Zum relativen Wahlerfolg schreiben die Autoren: „Diese relative Grösse gibt
an, wie viel Prozent der Stimmen, die für den Einzug in den Nationalrat erforderlich
gewesen wären, ein Kandidat erreicht hat” (Balsiger und Roth, 2007, 73). So betrach-
tet kann ein Kandidat auch einen relativen Wahlerfolg erzielen, wenn er sein Ergebnis
gegenüber den letzten Wahlen verbessert oder nur knapp an einer Wahl scheitert. Für
die Analysen von Balsiger und Roth ist der relative Erfolg massgebend.
Diese Studie hingegen betrachtet sowohl den relativen Wahlerfolg (hier gemessen
in Stimmenzahl der Kandidierenden) wie auch den absoluten Wahlerfolg (direkte Wahl
in den Grossen Rat). Etwas eleganter wäre es, die Anzahl Panaschierstimmen als rela-
tives Erfolgsmass für die einzelnen Kandidierenden heranzuziehen, doch werden die
Panaschierstimmen für jede politische Gemeinde einzeln erfasst und der Aufwand für
ihre Aggregation (für die Nationalratswahlen erledigt dies das Bundesamt für Statistik)
würde den Rahmen dieser Arbeit bei Weitem sprengen. Da die Stadt Bern gleichzeitig
politische Gemeinde und Wahlkreis ist, sind für diesen Wahlkreis die Panaschierstim-
men der Kandidierenden verfügbar2. Dadurch konnte überprüft werden, ob zwischen
den Resultaten dieser Arbeit zum Gesamtstimmenanteil der Kandidierenden und zu
ihren Panaschierstimmenanteile in einem Wahlkreis überhaupt ein Unterschied be-
steht. Wie aus den Berechnungen in Anhang I ersichtlich ist, kann der Gesamtstim-
2 Die Panaschierstatistik der Stadt Bern ist allerdings nicht online verfügbar und muss daher bei der Stadtkanzlei
bezogen werden.
-5-Bachelorarbeit Samuel Timutschin Kullmann 28. Februar 2011
menanteil durchaus als taugliche Alternative zum Panaschierstimmenanteil betrachtet
werden.
Unterschiede zwischen der Studie von Balsiger und Roth und dieser Bachelorarbeit
finden sich auch in den verwendeten Daten. Balsiger und Roth griffen für ihre Analyse
auf Daten zurück, die zum grossen Teil durch Befragungen der Kandidierenden für die
Nationalratswahlen 2003 generiert worden sind. Diese Arbeit verzichtet auf die Befra-
gungen und erfasst lediglich öffentlich zugängliche Angaben3 zu den Kandidierenden
für die Berner Grossratswahlen 2010.
Während Balsiger und Roth detailliert auf viele verschiedene Erfolgs- und Werbe-
faktoren eingehen, untersucht diese Arbeit primär parteipolitische Faktoren, (relativ)
unveränderliche Eigenschaften der Kandidatinnen und Kandidaten sowie zwei Aspekte
des Internetwahlkampfs. Diese werden in den folgenden Unterkapiteln theoretisch
hergeleitet und begründet.
2.1 Stärke der Liste/Partei
Die Stärke der eigenen Liste dürfte einer der bedeutendsten Einflussfaktoren sowohl
auf den Stimmenanteil wie auch auf die Wahrscheinlichkeit einer Wahl eines gegebe-
nen Kandidaten sein. Alle unverändert gewählten Listen generieren einen Minimal-
stimmenanteil für alle Kandidierenden auf der jeweiligen Liste. Zu diesem Minimum
kommen in der Regel noch Stimmen der eigenen, veränderten Listen sowie Stimmen
von anderen Listen (Panaschierstimmen) hinzu, welche zusammen das Stimmentotal
eines Kandidaten ergeben. Je mehr Wählerstimmen eine Liste generiert, desto mehr
Sitze bekommt sie schlussendlich in der Verteilung der Mandate.
Mit dem Faktor „Kandidatur für eine etablierte Partei” haben Balsiger und Roth
(2007, 78) eine ähnliche Variable in ihre Studie aufgenommen. Laut ihrer allerdings
relativ breiten Definition „gilt eine Partei als etabliert, wenn sie mindestens seit den
Nationalratswahlen 1995 im betreffenden Kanton immer angetreten ist oder bereits ein
3Die verwendeten Quellen für die Datenaggregation sind:
•Staatskanzlei des Kantons Bern: Wahlen 2010.
http://www.sta.be.ch/wahlen10/requestDispatcher.aspx?method=read&page=grossrat&sprache=d (29. Juli 2010).
•Facebook. http://www.facebook.com (29. März 2010).
•Smartvote. http://www.smartvote.ch (13. August 2010).
-6-Bachelorarbeit Samuel Timutschin Kullmann 28. Februar 2011
Mandat im Nationalrat hat”. Mit einem Betakorrelationskoeffizienten von 0,257 ist sie
die wichtigste Variable in ihrer Studie (von gesamthaft 45 untersuchten Erfolgs- und
Werbefaktoren). In der vorliegenden Arbeit wird die Stärke der Liste mittels einer me-
trischen Variable gemessen. Deshalb dürfte die Stärke der Korrelation hier noch ge-
nauer und deutlicher ausfallen. Da der Einfluss der Listenstärke offensichtlich sehr
bedeutend ist, wird der Einfluss dieser Variable hier nicht weiter theoretisch dargelegt.
Aus diesen Überlegungen folgt die erste Hypothese:
H1: Je grösser die Wählerzahl einer Liste, desto höher der Stimmen-
anteil der einzelnen Kandidierenden auf dieser Liste.
2.2 Bisher-Status
Etwa genau so wichtig wie die Wählerstärke der Liste dürfte der Bisher-Status sein.
Balsiger und Roth halten dazu treffend fest:
„Viele Wähler entscheiden sich mehrheitlich für Volksvertreter, die schon
im Parlament sitzen und sich nicht erst noch einarbeiten müssen. Sie ge-
niessen einen Vertrauensbonus und Kredit. Das Wort „bisher” in der Wahl-
propaganda verfehlt seine Wirkung nicht.” (Balsiger und Roth, 2007, 70).
So überrascht es nicht, dass auch der Bisherigenbonus mit einem Betakoeffizienten
von 0,171 stark mit dem relativen Wahlerfolg korreliert. Der positive Effekt des Bishe-
rigenbonus wird in Abbildung 1 veranschaulicht.
-7-Bachelorarbeit Samuel Timutschin Kullmann 28. Februar 2011
Abbildung 1: Wiedergewählte und nicht wiedergewählte Grossratsmitglieder
Total Sitze Wiedergewählt Nicht wiedergewählt
200
200
160 160
160
136
123
120 109
80
40 33
27
12
0
2002 2006 2010
Quelle: Staatskanzlei des Kantons Bern, eigene Darstellung.
Aus dieser Grafik ist gut ersichtlich, wie gross der Vorteil für Kandidierende ist, die
den Sprung in den Grossen Rat bereits geschafft haben. Erst die grosse Wahlkreisre-
form nach den Wahlen 20024 scheint den Anteil der nicht-Wiedergewählten etwas er-
höht zu haben. Trotzdem wurden über die letzten drei Wahlen 84 Prozent der Bisheri-
gen in ihrem Amt bestätigt.
Dass dies nicht unüblich ist, zeigt ein Vergleich mit den Wahlen in das Repräsentan-
tenhaus der USA zwischen 1972 und 2002. Wie Abramowitz et al. darlegen, stieg die
Wiederwahlquote in dieser Zeitspanne von 75 Prozent auf 84 Prozent (vgl. Abramo-
witz et al., 2006, 85). Gemäss den Autoren besitzen die incumbents (die Bisherigen in
den USA) auch finanzielle Vorteile: “[A]n important and (…) growing advantage of
incumbency is the ability of incumbents to dominate their challengers financially”
(Abramowitz et al., 2006, 85).
4 Im Zuge dieser Wahlkreisreform wurde die Zahl der Wahlkreise von 26 auf acht reduziert und die Grösse des
Parlaments von 200 auf 160 Sitze reduziert. Kleinere Parteien, dis bis dahin massiv untervertreten waren, konnten
so ihre Untervertretung zu Lasten der übervertretenen Parteien ausgleichen. Unter anderem wurden aufgrund die-
ser Änderung mehr Grossratsmitglieder nicht wiedergewählt als in den anderen Jahren.
-8-Bachelorarbeit Samuel Timutschin Kullmann 28. Februar 2011
Eine ähnliche Studie, die zwischen 1992 und 1994 96 Wahlen in 49 US-Bun-
desstaaten untersuchte, bestätigt deutlich den Vorteil, den die incumbents geniessen:
Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Bisheriger gewählt wird (im Falle, dass alle anderen
Variablen wie Demographie, Wahljahr, Bundesstaat und Kammer ein Kopf-an-Kopf-
Rennen voraussagten) lag durchschnittlich bei 92 Prozent und fiel auch in den einzel-
nen Bundesstaaten nie tiefer als 65 Prozent (vgl. Carey et al., 2000, 681 f.).
Auch Balsiger und Roth (2007, 72) attestieren den Bisherigen nebst Vorteilen beim
Bekanntheitsgrad, bei der Medienpräsenz, der Kampagnendauer, dem eigenen Inter-
net-Auftritt oder der Meinungsführerschaft Vorteile beim Budget: „Durch ihre vielfäl-
tigen Kontakte können Bisherige ihre Wahlkampfkasse leichter füllen. Für die übrigen
Kandidaten ist das bedeutend schwieriger” (Balsiger und Roth, 2007, 72).
Aus diesen Überlegungen folgt die zweite Hypothese:
H2: Bisherige Grossratsmitglieder erzielen – ceteris paribus – einen
höheren Stimmenanteil als neuantretende Kandidierende.
2.3 Vorkumulierung
Manchmal entscheiden sich Parteien, ihre Spitzenkandidaten zweifach auf der Liste
aufzuführen (Vorkumulierung). So erhalten diese pro unverändert gewählte Liste au-
tomatisch doppelt so viele Stimmen wie ihre parteiinternen Konkurrenten und lassen
diese deshalb in der Regel weit hinter sich zurück. Diese Tatsache dürfte sich massge-
bend auf den Stimmenanteil der Kandidaten auswirken.
Entscheidet sich eine Partei, nicht alle Kandidierenden vorkumuliert aufzuführen,
kann sie massgeblich Einfluss auf deren Wahlchancen nehmen und so einen ähnlichen
Einfluss ausüben wie Parteien in Ländern mit starren Listen. Nach Christian Pahl
nehmen Parteien
„eine wichtige Rolle innerhalb der politischen Willensbildung ein und
können insbesondere durch die Aufstellung der Wahllisten auch zukünftig
großen Einfluss nehmen. Zudem bietet Kumulieren und Panaschieren den
-9-Bachelorarbeit Samuel Timutschin Kullmann 28. Februar 2011
Parteien, z.B. durch das Vorkumulieren, ebenso eine Reihe von Möglich-
keiten, dem Wähler eigene personelle Präferenzen deutlich zu machen”
(Prahl, 2009, 88).
Auch Georg Lutz (2009, 12) schreibt:
“This is a strong tool to influence who gets elected because many voters
use the pre-printed ballot without any changes or with only minimal
changes and for a non-cumulated candidate it is very difficult to receive
more votes than a pre-cumulated candidate.”
Kandidieren allerdings weniger Leute auf einer Liste als Listenplätze zur Verfügung
stehen, führt dies zu einem weiteren Grund, Kandidierende zwei mal auf die Liste zu
setzen: Eine Liste lässt sich so besser füllen5. Werden sämtliche Kandidierende vor-
kumuliert, hat dies zwar einen deutlichen Einfluss auf deren Stimmenanteil, doch wird
so kein bestimmter Kandidat mehr direkt bevorzugt.
Diese Erläuterungen begründen die dritte Hypothese dieser Studie:
H3: Vorkumulierte Kandidierende erzielen – ceteris paribus – einen
höheren Stimmenanteil als einfach aufgeführte Kandidierende.
2.4 Listenplatz
Ein weiterer parteistrategischer Faktor ist der häufig diskutierte Listenplatz. Dieser ist
aber bei weitem nicht so bedeutend wie die oben erwähnten Faktoren, und sein Ein-
fluss ist im Vergleich zu Wahlsystemen mit starren Listen relativ gering. Ein Vergleich
mit dem niederländischen Wahlsystem soll dies hier verdeutlichen:
2.4.1 Bedeutung des Listenplatzes in den Niederlanden
Gert-Jan Leenknegt und Gerhard van der Schyff erklären das Niederländische
Wahlsystem wie folgt:
5 Es ist strategisch nicht geschickt, mit einer halbvollen Liste anzutreten, da die leeren Zeilen so eher mit Kandidie-
renden anderer Listen gefüllt werden, was der eigenen Liste schadet.
- 10 -Bachelorarbeit Samuel Timutschin Kullmann 28. Februar 2011
“Parties acquire one of the one hundred fifty available seats for every 1/
150th, or 0.667%, of the total number of votes. There exists no additional
threshold, and although the country is divided into 19 electoral districts,
mainly for administrative purposes, the country is treated as a single con-
stituency. The electorate casts single non-transferable votes on individual
candidates, but all seats are initially allocated to lists (parties), whereby the
order of the candidates on the list determines which of them are elected.
Candidates who are too low on a list may still acquire a seat over
higher placed candidates if they receive more than 25% of the number
of votes needed for a single seat [hervorgehoben durch den Verfasser] –
that is 0.1667% of the total number of votes” (Leenknegt und Schyff,
2007, 1134 f.).
Der Listenplatz hat somit in den Niederlanden eine sehr grosse Bedeutung. Will ein
Kandidat seine Wahlchancen wahren, muss er sich zuerst parteiintern durchsetzen und
einen aussichtsreichen Listenplatz zugeteilt bekommen. Doch sind Kandidierende auf
schlechten Listenplätzen nicht ganz chancenlos: Wenn ihr persönlicher Stimmenanteil
mehr als 0,17 Prozent der landesweit abgegebenen Stimmen beträgt, sind sie direkt
gewählt, sofern ihre Partei mindestens ein Mandat erreicht. So kam diese Bestimmung
auch bei den Tweedekamerverkiezingen 2010, den Wahlen in das Niederländische Un-
terhaus, zum Tragen:
"Onder de 30 kandidaten die de voorkeurdrempel hebben overschreden
en gekozen zijn, zijn twee personen die uitsluitend op grond van de lijst-
volgorde geen zitting zouden kunnen nemen. Dat zijn mevr. Uitslag van
het CDA (oorspronkelijke lijstpositie: 31), en mevr. Dijkstra van D66 (oor-
spronkelijke lijstpositie: 13)” (Kiesraad, 2010).
Demnach haben 30 Kandidierende am 9. Juni 2010 die entsprechende Hürde (voor-
keurdrempel) geschafft, allerdings wären nur zwei davon aufgrund ihres schlechten
Listenplatzes nicht gewählt gewesen.
- 11 -Bachelorarbeit Samuel Timutschin Kullmann 28. Februar 2011
2.4.2 Bedeutung des Listenplatzes in der Schweiz
Im Gegensatz dazu ist es beim Schweizer Proporzsystem mit offenen Listen sehr üb-
lich, dass Kandidierende trotz eines schlechten Listenplatzes durchaus einen sehr gu-
ten Endrang belegen können. Balsiger und Roth gehen in ihrer Studie auch auf die Be-
deutung des Listenplatzes in der Schweiz ein:
„Ihm [dem Listenplatz, d. Verf.] wird eine grosse Bedeutung für den
Wahlerfolg zugeschrieben. Doch ergibt sich diese Bedeutung auch aus den
Fakten? Zwei Einwände müssen hier geltend gemacht werden: Zum einen
haben in der Schweiz die Spitzenkandidaten auf den Listen keinen wahl-
arithmetischen Vorteil [hervorgehoben durch den Verfasser]. Auch sie
sind nur gewählt, wenn sie tatsächlich mehr persönliche Stimmen erhalten
als die anderen Kandidaten auf ihrer Liste. Zum anderen schwindet der
optische Vorteil, je kürzer die Listen sind” (Balsiger und Roth, 2007, 86).
Die Studien, die es zur Bedeutung des Listenplatzes bei Schweizer Wahlen gibt
(vgl. Statistisches Amt des Kantons Zürich, 2003; Lutz, 2010), scheinen trotz aller
Einwände den Einfluss des Listenplatzes zu bestätigen. Für Georg Lutz ist der Listen-
platz eine Möglichkeit, wie Wählerinnen und Wähler ihr Informationsdefizit verrin-
gern können:
“Voters often have very limited information about individual candidates
and parties or politics in general (Delli Carpini and Keeter 1996) and they
(…) rely on different shortcuts and cues[.] (…) Ballot position effects are
all attached to the limited capability and willingness as well as the selecti-
vity of voters to gather, store and process information about all the relevant
alternatives in a comprehensive way” (Lutz, 2010, 3 ff.).
Zudem postuliert Lutz zwei Effekte des Listenplatzes: Der Kandidatenevaluations-
effekt besagt, dass die typischen Wählerinnen und Wähler am Anfang der Listen an-
fangen, die Kandidierenden zu evaluieren und unter Umständen irgendwo in der Mitte
der Liste aufgeben. Der zweite Effekt bezieht sich auf das Ausfüllen der Stimmzettel,
wobei unentschlossene Wähler eher jemanden auf den vorderen Listenplätzen wählen
- 12 -Bachelorarbeit Samuel Timutschin Kullmann 28. Februar 2011
als einen Kandidaten auf dem letzten Listenplatz (vgl. Lutz, 2010, 5 f.). Während Lutz
in all seinen Modellen einen signifikanten Zusammenhang zwischen dem Listenplatz
und der Anzahl Präferenzstimmen nachweisen kann, ist dieser Effekt kleiner (jedoch
nach wie vor signifikant), wenn die Listen alphabetisch geordnet sind (vgl. Lutz, 2010,
21).
Bereits 1975 hat Delbert Taebel experimentell nachgewiesen, dass Wählerinnen und
Wähler sich besser an die Namen von Kandidierenden erinnern können, die einen bes-
seren Listenplatz hatten. Zudem sei der erste Listenplatz in Wahlen mit eher unbe-
kannten Kandidierenden besonders wichtig (vgl. Taebel, 1975).
Aus diesen Überlegungen wird der Zusammenhang zwischen Stimmenanteil und
Listenplatz wie folgt postuliert:
H4: Je besser (näher bei 1) der Listenplatz eines Kandidaten, desto
höher auch der Stimmenanteil des Kandidaten.
2.5 Kandidatur Regierungsrat
Während der Berner Grossrat aus 160 Mitgliedern besteht, hat die Kantonsregierung
nur sieben Regierungsräte, was die Wahlhürde natürlich massiv erhöht. Die Zahl der
Kandidierenden für den Regierungsrat ist somit sehr klein6, da die Parteien tendenziell
nur ihre (zumindest scheinbar) fähigsten, erfahrensten und bekanntesten Leute in einen
Regierungsratswahlkampf schicken. Hinzu kommt, dass hier (noch) nach dem Ma-
jorzverfahren gewählt wird und eine volle Kandidatenliste oder so genannte Unter-
stützungslisten kaum Sinn machen7. Da die Zahl der Kandidierenden für ein so bedeu-
tendes politisches Amt relativ gering ist, erhalten die meisten Kandidierenden wohl
auch besondere Aufmerksamkeit, sei dies in der parteieigenen Werbung oder in Medi-
enberichten. Diese erhöhte Aufmerksamkeit dürfte sich also massgebend auf den
6 2010 traten 1938 Kandidierende zu den Grossratswahlen an, jedoch nur 16 zu den Regierungsratswahlen.
7 Das Aufstellen zu vieler Kandidaten kann sogar kontraproduktiv sein, wie die Regierungsratswahlen 2006 bewie-
sen haben. Das bürgerliche Lager stellte damals sechs Kandidierende mit reellen Wahlchancen, doch wurde dieser
Machtanspruch nicht von allen Wählenden goutiert, weshalb der bürgerliche Block seine Mehrheit im Regierungs-
rat verlor.
- 13 -Bachelorarbeit Samuel Timutschin Kullmann 28. Februar 2011
Stimmenanteil bei den gleichzeitig stattfindenden Grossratswahlen auswirken, sofern
jemand sowohl für den Grossen Rat wie auch für den Regierungsrat kandidiert.
Diese Überlegungen machen sich auch kleinere Parteien ohne reelle Wahlchancen
für den Regierungsrat zu Nutze, in dem sie zum Beispiel eine Kandidatin aufstellen,
die dank ihres zusätzlichen Bekanntheitsgrades dann die Wahl in den Grossen Rat
schaffen könnte. Ein ähnliches Phänomen ist auch bei Ständeratswahlen zu beobach-
ten, wenn kleinere und mittelgrosse Parteien einen bisherigen Nationalrat für den
Ständerat portraitieren, um seine Wiederwahl in den Nationalrat zu fördern (vgl. Krie-
si, 1998, 47). Aus diesen Überlegungen leitet sich die fünfte Hypothese ab:
H5: Bewirbt sich ein Grossratskandidat zusätzlich für den Regie-
rungsrat, erzielt er – ceteris paribus – einen höheren Stimmenanteil als
die anderen Kandidierenden.
2.6 Geschlecht
Trotz der Einführung des Frauenstimmrechts 1971 ist die weibliche Bevölkerung in
praktisch allen politischen Gremien der Schweiz unterrepräsentiert 8. So auch im Ber-
ner Grossrat, wie Abbildung 2 zeigt.
Seit 1974 ist ein deutlicher und kontinuierlicher Anstieg der Frauenquote zu be-
obachten, welche jedoch seit 1998 stagniert und 2010 sogar wieder abfiel. Mitte 2006
hatte der Kanton Bern hinter Aargau und den beiden Basel noch die vierthöchste Frau-
enquote bei Kantonsparlamenten (vgl. Fahrni, 2006, 25). Prozentual traten meistens
mehr Kandidatinnen an als Grossrätinnen gewählt wurden. 2006 war dieses Gefälle
erstmals zu vernachlässigen. Allerdings wuchs 2010 die Diskrepanz wieder auf sechs
Prozent, wobei der bisherige Trend ein erstes Mal umgekehrt wurde. Trotzdem ist klar:
Je mehr Frauen für ein Grossratsmandat kandidieren, desto mehr werden auch ge-
wählt. Statistisch gesehen korrelieren die beiden Variablen zu 97 Prozent; das R2 in
einer bivariaten Regressionsanalyse liegt bei 0.96
8 Für einen internationalen Vergleich über 50 Jahre siehe Studlar und McAllister, 2002.
- 14 -Bachelorarbeit Samuel Timutschin Kullmann 28. Februar 2011
Abbildung 2: Anzahl Kandidatinnen und gewählte Grossrätinnen in Prozent
Kandidatinnen (%) Gewählte Grossrätinnen (%)
40
35 35 35
34
32 32
30 30
29
30
26 26 26
21
20 18 18
16
15
13
10
7
5
0
1974 1978 1982 1986 1990 1994 1998 2002 2006 2010
Quelle: Staatskanzlei des Kantons Bern, 2006, eigene Darstellung.
In der vorhandenen Literatur wurde der gender gap bei Wahlen in der Schweiz al-
lerdings nur wenig analysiert:
“Despite being a standard component in electoral studies, the gender
variable is, in most cases, only used as a control variable and its effects
and interaction are too often under-analysed” (Engeli et al., 2006, 217).
Gründe für die Untervertretung der Frauen sind vielfältig und deshalb ist es schwie-
rig, diese eindeutig zu erörtern:
“The complexity of the gender gap is supported by decades of gender-
based analysis of political attitudes which has supported various explana-
tions for female/male differences. No single explanation has been gener-
ally accepted, possibly because they all contribute a piece of the puzzle (cf.
- 15 -Bachelorarbeit Samuel Timutschin Kullmann 28. Februar 2011
Clark and Clark 1999) and possibly because conditional effects9 have not
been fully explored” (Howell und Day, 2000, 859).
“Without being able to fully explain the gender gap, we have neverthe-
less accomplished more than simply reporting that the gender gap is due to
a lack of politicisation of women. Our results suggests that gender gap
studies must investigate conditional effects” (Engeli et al., 2006, 235).
Der Vollständigkeit halber werden hier einige Theorien, welche die Unterrepräsen-
tation der Frauen zu erklären suchen, kurz gestreift. Eine ausführliche Diskussion der
verschiedenen Theorien würde aber den Umfang dieser Arbeit bei Weitem sprengen.
Erklärungsversuche beinhalten (nicht abschliessend) die folgenden Ansätze:
• Die Unterrepräsentation der Frauen korreliert mit der schwächeren politischen Re-
krutierung und der geringeren Anzahl an Kandidatinnen (vgl. Grafik auf S. 14; Fo-
verskov, 1960; Kinzig, 2007, 101 ff.; Schreiber und Adams, 2008).
• Die Wahlbeteiligung der Frauen korreliert signifikant mit dem Frauenanteil unter den
gewählten Parlamentsmitgliedern (vgl. Studlar und McAllister, 2002, 13).
• Die hohe Wiederwahlquote bei den Bisherigen widerspiegelt einen starken Pfadab-
hängigkeitseffekt 10.
• Kandidatinnen werden durch die Wählenden direkt diskriminiert.
9 Howell und Day definieren conditional effects wie folgt:
“Interaction, or conditional, effects produce a gender gap when a particular variable has more impact on women
than on men, or vice versa. For example, having a larger number of children at home may have a greater impact on
women’s attitudes than on men’s attitudes because women are more likely to have greater child care responsibili-
ties” (Howell und Day, 2000, 866).
10 „Pfadabhängigkeit ist ein analytisches Konzept in den Sozialwissenschaften, das Prozesse modellieren soll,
deren zeitlicher Verlauf strukturell einem Pfad ähneln. Wie bei einem Pfad gibt es dort Anfänge und Kreuzungen,
an denen mehrere Alternativen oder Wege zur Auswahl stehen. Anschließend, nach Auswahl einer solchen Alterna-
tive, folgt eine stabile Phase, in der die Entwicklung durch positive Feedback-Effekte auf dem eingeschlagenen
Weg gehalten wird. Während an den Kreuzungspunkten kleine Störungen einen großen Effekt haben können, be-
wirken sie in der darauf folgenden stabilen Phase kaum mehr eine Richtungsabweichung. Ein späteres Umschwen-
ken auf eine der am Kreuzungspunkt noch mühelos erreichbaren Alternativen wird in der stabilen Phase nach der
Entscheidung zunehmend aufwendiger, da Rückkopplungseffekte Hindernisse aufbauen. So wird an einem Pfad
unter Umständen selbst dann festgehalten, wenn sich später herausstellt, dass eine andere Alternative überlegen
gewesen wäre” (Wikipedia, 2010). Für eine ausführliche Definition der Pfadabhängigkeit siehe Rolf Ackermann
(2001).
- 16 -Bachelorarbeit Samuel Timutschin Kullmann 28. Februar 2011
Während die ersten drei Thesen hier vollständigkeitshalber erwähnt wurden, muss
sich das statistische Modell dieser Arbeit auf die Kontrolle der vierten These be-
schränken.
So lautet die sechste Hypothese:
H6: Gesamthaft gesehen erzielen Kandidaten – ceteris paribus
– durchschnittlich einen höheren Stimmenanteil als Kandidatinnen.
2.7 Alter
Genau wie das Geschlecht wird zwar das Alter in zahlreichen ähnlichen Studien wie
dieser als kontrollierende Variable berücksichtigt, aber nicht genauer analysiert. Zwi-
schen der demographischen Struktur der Kandierenden und dem Alter der gewählten
Grossratsmitglieder gibt es markante Unterschiede. Wie Abbildung 3 zeigt, sind die
18-29-Jährigen im Verhältnis zu der Anzahl Kandidaturen massiv untervertreten, wäh-
rend die 48-71-Jährigen im Parlament stark übervertreten sind:
Abbildung 3: Kandidierende und Gewählte in Prozent
Kandidierende in % (2010) Gewählte in % (2010)
24
24
21
18
18 17
16 16 16
12
12
10
9
8 8
7 7 7
6
3
1 1 0 0
0
18-23 24-29 30-35 36-41 42-47 48-53 54-59 60-65 66-71 >71
Quelle: Staatskanzlei des Kantons Bern, eigene Darstellung.
- 17 -Bachelorarbeit Samuel Timutschin Kullmann 28. Februar 2011
Die Tatsache, dass junge Kandidierende oft wenig Erfolg haben, spiegelt sich auch
in der folgenden Grafik wider, welche den durchschnittlichen Stimmenanteil der Kan-
didierenden nach Jahrgang abbildet:
Abbildung 4: Durchschnittlicher Stimmenanteil nach Jahrgang
Durchschnittlicher Stimmenanteil (Keine Daten)
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
1992 1988 1984 1980 1976 1972 1968 1964 1960 1956 1952 1948 1944 1940 1936 1932
Quelle: Staatskanzlei des Kantons Bern, eigene Darstellung.
Ein sehr ähnliches Bild in Bezug auf die Untervertretung der jungen Generation
ergab eine Analyse der Berner Grossratswahlen 2006 (vgl. Kullmann, 2010). Doch die
markante Untervertretung der Jungen ist nicht nur im Kanton Bern zu beobachten. So
schreibt auch das Statistische Amt des Kantons Zürich (2003, 10): „Vor allem die jün-
geren Kandidierenden hatten schlechte Chancen auf einen Sitz im Rat: Die Jahrgänge
1970 bis 1979 machen nur fünf Prozent der Gewählten aus, während sie bei den Kan-
didierenden mit rund einem Fünftel vertreten waren.”
- 18 -Bachelorarbeit Samuel Timutschin Kullmann 28. Februar 2011
Abbildung 5: Kantonsratswahlen ZH 2003: Kandidierende nach Alterskohorten
Quelle: Statistisches Amt des Kantons Zürich.
Die Vermutung liegt also nahe, dass jüngere Kandidatinnen und Kandidaten signi-
fikant weniger Stimmen erzielen als ihre älteren Konkurrenten. Balsiger und Roth er-
gänzen:
„Zu den am stärksten untervertretenen Gruppen gehören die jüngeren
Generationen. Das hat zum grossen Teil natürliche Ursachen. So ist das
aktive und das passive Wahlrecht an ein Mindestalter gebunden. In der
Schweiz wurde das allgemeine Stimm- und Wahlrecht Anfang der 1990er-
Jahre von 20 auf 18 Jahre gesenkt. (…) Nachdem ein politisch ambitio-
nierter Schweizer Bürger volljährig geworden ist, muss er seine Karriere
erst einmal aufbauen. Das beginnt in der Regel in den Gemeinden und
braucht einen langen Atem” (Balsiger und Roth, 2007, 108).
- 19 -Bachelorarbeit Samuel Timutschin Kullmann 28. Februar 2011
Doch fällt beim Betrachten der obigen Grafiken auf, dass nicht nur junge Kandidie-
rende einen geringeren Stimmenanteil erzielen, auch ältere Kandidierende scheinen
hier benachteiligt zu sein. Dieser quadratische Zusammenhang liess sich auch bei ähn-
lichen Eigenschaften in anderen Studien feststellen. So haben z.B. Strate et al. einen
Abfall der civic competence oder der „staatsbürgerlichen Kompetenz” ab dem 65. Al-
tersjahr (bzw. ab dem 60. Altersjahr bei Personen ohne College-Abschluss) beobachtet
(vgl. Strate et al., 1989, 451).
Aus den hier dargelegten Daten ergibt sich die siebte Hypothese wie folgt:
H7: Der durchschnittliche Stimmenanteil eines Kandidierenden steigt
bis zu einem gewissen Idealalter und fällt danach wieder, wenn dieses
Alter erreicht wurde.
2.8 Smartvote
„Smartvote ist eine wissenschaftlich konzipierte Online-Wahlhilfe für
kommunale, kantonale und nationale Wahlen in der Schweiz. (…) Anhand
von Sach- und Einstellungsfragen werden die politischen Profile der Kan-
didierenden erfasst und in einer Datenbank gespeichert. Wählerinnen und
Wähler können anschliessend dieselben Fragen beantworten, worauf
smartvote diejenigen Kandidierenden zur Wahl empfiehlt, welche die
grösste politische Übereinstimmung aufweisen.”11
Heute ist Smartvote die mit Abstand meistbenutzte Wahlhilfe in der Schweiz. 2007
füllten 85 Prozent der Kandidierenden für den Nationalrat ein Smartvote-Profil aus;
fast eine Million Wahlempfehlungen wurden ausgestellt (vgl. Ladner et al., 2008, 8)12.
Für die Grossratswahlen 2010 liessen sich 76 Prozent der Kandidierenden registrieren,
wobei über 40’000 Wahlempfehlungen ausgestellt wurden. Dies entspricht einem An-
teil von etwa sechs Prozent an den Berner Wahlberechtigten, oder 18 Prozent derjeni-
11 Smartvote. http://www.smartvote.ch/side_menu/about_us/idea.php?who=v (30. Juli 2010).
12 Allerdings entspricht dies nicht genau einer Million Wählenden, da einige Smartvotenutzer sich mehrere Wahl-
empfehlungen ausstellen liessen. Die Zahl der tatsächlichen Smartvotenutzer liegt bei etwa 375’000, was mit Um-
fragedaten der SELECTS-Wahlstudie übereinstimmt (Fivaz, 2010). Dies entspricht einem Anteil von 15,8 Prozent
der Wählenden und 7,6 Prozent der Wahlberechtigten.
- 20 -Bachelorarbeit Samuel Timutschin Kullmann 28. Februar 2011
gen, die schliesslich wählen gingen13. Obwohl Smartvote bei den Berner Grossrats-
wahlen verglichen mit nationalen Wahlen weniger stark in Anspruch genommen wur-
de, kann der Gebrauch dieser Wahlhilfe durchaus als ein entscheidender Wahlfaktor
betrachtet werden. So scheint der starke Gebrauch dieser Wahlhilfe durchaus einen
Einfluss auf das Wahlverhalten der Wählerinnen und Wähler zu haben. Andreas Lad-
ner und Jan Fivaz haben bereits 2006 die folgende Feststellung gemacht:
„Rund drei Viertel der Befragten geben an, dass sie von «smartvote» in
ihrer Wahlentscheidung beeinflusst worden sind. Jeweils knapp ein Drittel
sagt, dass sie deshalb auch Kandidierende von für sie sonst unüblichen
Parteien gewählt oder dadurch grundsätzlich vermehrt panaschiert haben.
Etwa jede sechste Person wurde zudem durch «smartvote» angeregt, ihre
eigenen politischen Positionen zu überdenken und sich weiter zu informie-
ren” (Ladner und Fivaz, 2006).
Ergänzend schreiben Balsiger und Roth (2007):
„Unsere Analysen zeigten, dass die Teilnahme an der Smartvote-Wahl-
hilfe zum Wahlerfolg eines Kandidaten beitragen konnte. Um Panaschier-
stimmen von den Listen anderer Parteien zu erhalten, war Smartvote sogar
das wichtigste Werbemittel. Insgesamt erhielten Smartvote-Teilnehmer im
Schnitt fünf Prozent mehr Panaschierstimmen [hervorgehoben durch
den Verfasser] als Nichtteilnehmer.”
Entsprechend leitet sich die achte Hypothese ab:
H8: Kandidierende mit einem ausgefüllten Smartvote-Profil erzielen
durchschnittlich einen höheren Stimmenanteil als Nichtteilnehmer.
13 Die Zahl der Smartvotenutzer dürfte aber auch hier etwas tiefer liegen als die ausgestellten Wahlempfehlungen,
allerdings sind für die Berner Grossratswahlen keine Korrekturschätzungen vorhanden.
- 21 -Bachelorarbeit Samuel Timutschin Kullmann 28. Februar 2011
2.9 Facebook
2004 gegründet ist Facebook heute das grösste soziale Netzwerk der Welt. Christine
Williams und Girish Gulati definieren ein soziales Netzwerk wie folgt:
“A social network is a set of people, organizations, or other social enti-
ties connected by a set of socially meaningful relationships. When a com-
puter network connects people, it is a social network (Wellman, 1997)
(Williams und Gulati, 2007, 3).
Seit Juli 2010 haben mehr als 500 Millionen Menschen ein eigenes Profil auf Face-
book14. Davon stammen mehr als 2,2 Millionen aus der Schweiz, was einer Penetrati-
on von 29 Prozent entspricht 15. Entsprechend vielseitig wird Facebook seit wenigen
Jahren auch in der Schweiz politisch genutzt. Allerdings gibt es bis heute noch kaum
Studien, die sich mit der Bedeutung von Facebook für die Schweizer Politik beschäf-
tigt haben. Als einen ersten Ansatz kann die Forschungspraktikumsarbeit von Hub-
acher et al. (2009) bezeichnet werden, deren Ergebnisse jedoch aufgrund einer nicht-
repräsentativen Stichprobe nicht generalisierbar sind. Die Bedeutung des Internets für
Wahlen und Kandidierende wird hingegen besonders deutlich, wenn sie im US-Ame-
rikanischen Kontext betrachtet wird:
Im Vorfeld des US-Präsidentschaftswahlkampfes im Jahre 2008 gelang es Barack
Obama über das Internet eine halbe Milliarde US-Dollar an Spendengeldern zu sam-
meln (vgl. Vargas, 2008). Er war auf mehr als 15 verschiedenen online communities
vertreten, wobei hier seine Facebook-Fanseite mit mehr als drei Millionen Mitgliedern
besonders ins Gewicht fiel16. Sobald sich ein Facebook-Mitglied zum Unterstützungs-
kreis von Barack Obama zählte, wurde die betreffende Person gezielt mit Pro-Obama-
Werbung konfrontiert, wenn sie irgendeine Facebook-Seite besuchte. Dadurch wird
ersichtlich, wie das Internet dabei hilft, viel gezielter und effektiver Werbung zu plat-
zieren, als dies mit herkömmlichen Mitteln wie TV-Spots, Flyer-Streuversand oder
14CNN: Facebook hits 500 million users:
http://money.cnn.com/2010/07/21/technology/facebook_500_million/index.htm (2. Februar 2011).
15http://www.thomashutter.com/wp-content/uploads/2010/07/facebook_DACH_Demo_30062010_schweiz.jpg (2.
Februar 2011).
16 Zum Zeitpunkt des Schreibens dieser Arbeit (28.2.2011) wuchs Obama’s Unterstützungskreis auf Facebook be-
reits auf 18,5 Millionen Mitglieder.
- 22 -Bachelorarbeit Samuel Timutschin Kullmann 28. Februar 2011
Zeitungsanzeigen der Fall ist. Pete Quily (2008) untersuchte im Vorfeld der Wahlen,
wie stark die beiden Präsidentschaftskandidaten Barack Obama und John McCain bei
29 verschiedenen Internet-Medien und Online-Suchmaschinen abschnitten. Gemäss
seinen Analysen hatte Obama bei 27 dieser Medien einen zum Teil äusserst klaren
Vorsprung vor McCain17 .
Williams und Girish haben 2007 zum ersten Mal den Effekt von Facebook auf
Wahlen in das Repräsentantenhaus und den Senat untersucht, welche im November
2006 stattfanden. Bei der Beurteilung ihrer Ergebnisse ist zu beachten, dass Facebook
für die Wahlen zwar das meistbenutzte neue Online-Medium war (noch vor MySpace
und Youtube), jedoch noch nicht vor dem grossen Durchbruch stand, der erst seit etwa
2008 einsetzte. Dies mag u.a. daran liegen, dass Facebook bis September 2007 für
Leute ausserhalb des Bildungsbereichs (.edu-Domains) noch nicht zugänglich war
(vgl. Williams und Girish, 2007, 4).
Trotzdem wurde Facebook bereits von 32 Prozent der Kandidierenden für den Se-
nat und von 13 Prozent der Kandidierenden für das Repräsentantenhaus benutzt. Ge-
samthaft waren 1,5 Millionen Facebook-Mitglieder mit einem Kandidaten oder einer
Gruppe verbunden. Senatorin Hillary Clinton (D-NY) hatte damals mit 12’038 Face-
book-Usern die grösste Zahl Unterstützer.
Williams und Girish fanden ihre zweite Hypothese – dass Facebook-Seiten einen
positiven Einfluss auf den Stimmenanteil der Kandidierenden hätten – zumindest teil-
weise bestätigt:
“[A] candidate’s’ Facebook activity had a significant effect on the in-
cumbent’s final outcome. The coefficients for the log-transformed vari-
ables indicate that a 1% [sic!] percent increase in number of Facebook
supporters for incumbents increased their final vote percentage by 0.11,
while the same increase in number of Facebook supporters for challengers
reduced incumbents’ vote percentage by 0.15. (…) [O]pen-seat candidates
who updated their Facebook profile had a 3,8% higher vote share than
17 http://adultaddstrengths.com/2008/11/05/obama-vs-mccain-social-media/ (2. August 2010).
- 23 -Bachelorarbeit Samuel Timutschin Kullmann 28. Februar 2011
candidates who did not update their profiles. (…) Facebook seems to be
one more tool that candidates can use to connect with voters and make a
favorable impression” (Williams und Girish, 2007, 14 ff.).
Trotz dieser Resultate, die auf einen positiven Zusammenhang zwischen Facebook-
Aktivität und Stimmenanteil hinweisen, zeigen die Autoren in ihrem Fazit einige ver-
bleibende Einschränkungen auf: So wäre die Wahlbeteiligung bei den 18-29-Jährigen
(die Facebook besonders intensiv nutzen) tiefer als bei den anderen Altersschichten.
Zudem können Facebook-User verschiedene Kandidierende gleichzeitig unterstützen,
oder ausserhalb des entsprechenden Wahlkreises wohnen. 14 Prozent der Facebook-
Nutzer waren zudem noch jünger als 18 und deshalb noch nicht wahlberechtigt (vgl.
Williams und Girish, 2007, 18).
Während die Autoren den Einfluss von Facebook auf den Stimmenanteil noch nicht
zweifelsfrei darlegen konnten, halten sie doch deutlich fest: “What strikes us as more
likely is that the number of Facebook supporters is capturing the underlying enthusi-
asm and intensity of support for a candidate” (Williams und Girish, 2007, 18).
Obwohl sich Facebook seit den US-Wahlen 2006 markant weiterentwickelt hat und
die Nutzerzahl um ein Vielfaches gestiegen ist, besteht eine interessante Parallele zwi-
schen den US-Repräsentantenhauswahlen 2006 und den Berner Grossratswahlen 2010,
die in Tabelle 1 dargestellt wird.
Tabelle 1: Facebook-Werbung im Vergleich zwischen USA und Kanton Bern
US-Repräsentanten- Berner Grossratswah-
hauswahlen 2006 len 2010
Anzahl Kandidierende mit 12,8% 10,5%
Facebook-Profil in Prozent
Durchschnittliche 125 114
Gruppengrösse
Anzahl Mitglieder der 913 696
grössten Gruppe Tammy Baldwin (D-WI) Patrik Locher (jevp/MLS)
Quelle: Williams und Girish, 2007; Facebook.
- 24 -Bachelorarbeit Samuel Timutschin Kullmann 28. Februar 2011
Da Facebook während den Nationalratswahlen 2007 in der Schweiz noch kaum Be-
achtung fand18, gehören die Berner Grossratswahlen 2010 zu den grösseren Wahlen in
der Schweiz, in denen Facebook möglicherweise zum ersten Mal eine signifikante
Rolle spielte. So waren nach dem Wahltag (29. März) immerhin 204 Kandidatinnen
und Kandidaten mit einer eigenen Facebookgruppe zu finden. Die kleinsten Gruppen
bestanden aus drei Mitgliedern, während Patrik Locher (Junge EVP, Mittelland-Süd)
mit 696 Mitgliedern die grösste Unterstützungsgruppe hatte19 .
Aufgrund der hier dargelegten Ergebnisse der US-amerikanischen Studie und der
vergleichbaren Facebook-Beteiligung an den Berner Grossratswahlen ergibt sich die
neunte Hypothese wie folgt:
H9: Je grösser die Facebook-Unterstützungsgruppe eines Kandidie-
renden, desto höher dessen Stimmenanteil.
18 Die Anzahl Facebook-User in der Schweiz lag Anfang 2008 noch bei weniger als 250’000:
http://bernetblog.ch/2010/01/21/facebook-user-schweiz-zahlen-fur-2009/ (2. Februar 2011).
19Hätte der 19-jährige Jungpolitiker anstatt auf einer jungen Liste auf der Stammliste seiner Partei kandidiert, hätte
er wahrscheinlich aufgrund seines hohen Panaschierstimmenanteils sogar einige Monate nach dem Wahltag als
erster Ersatz in den Grossen Rat „nachrutschen” können.
- 25 -Bachelorarbeit Samuel Timutschin Kullmann 28. Februar 2011
3 Methode
3.1 Statistische Modelle und abhängige Variablen
Diese Studie bediente sich einer zweifachen Analyse, um die Stärke der Einflussfakto-
ren auf den Wahlerfolg der Kandidierenden zu untersuchen: Einerseits wurde der Ge-
samtstimmenanteil der Kandidierenden (eine metrische Variable) als Erfolgsmass he-
rangezogen, andererseits wurde eine Dummy-Variable statistisch analysiert, welche
nur die Ausprägung „gewählt” und „nicht gewählt” hat. Die erstgenannte abhängige
Variable wurde in einer multivariaten Regressionsanalyse untersucht, die letztgenannte
abhängige Variable in einem multivariaten Logit-Modell.
Die Daten der abhängigen Variablen wurden von der Internetseite der Berner
Staatskanzlei bezogen20. Die Daten der Panaschierstimmen für Anhang I wurden von
der Berner Stadtkanzlei auf Anfrage digital bezogen21.
3.2 Unabhängige Variablen
Die folgende Aufzählung dient als Übersicht über die modellrelevanten unabhängigen
Variablen, ihre Ausprägungen und ihre Kodierung:
Stärke der Liste/Partei22
Um einen besseren Vergleich zwischen den Wahlkreisen zu ermöglichen, wurde nicht
das Total der Parteistimmen als Mass für die Stärke einer Liste gewählt, da dieses To-
tal massgeblich durch die Anzahl Mandate im betreffenden Wahlkreis beeinflusst wird.
Stattdessen wurde die so genannte Zahl der Wählerstimmen (Parteistimmen dividiert
durch Anzahl Mandate des Wahlkreises) berechnet.
Bisher-Status 23
Der Bisher-Status ist eine Dummy-Variable, die nur die Ausprägung „bisher” (kodiert
mit 1) oder „nicht bisher” (0) annimmt.
20 Quelle: Staatskanzlei des Kantons Bern, 2010. URL: http://www.sta.be.ch/wahlen10
21 Quelle: Stadtkanzlei der Stadt Bern: Manuel Megert, 2010.
22 Quelle: Staatskanzlei des Kantons Bern, 2010. URL: http://www.sta.be.ch/wahlen10
23 Ibid.
- 26 -Bachelorarbeit Samuel Timutschin Kullmann 28. Februar 2011
Vorkumulierung24
Auch Vorkumulierung ist eine Dummy-Variable, welche die Ausprägung „vorkumu-
liert” (kodiert mit 1) oder „nicht vorkumuliert” (0) annimmt.
Listenplatz 25
Auf eine Standardisierung des Listenplatzes wurde aus zwei Gründen verzichtet. Ers-
tens kann die kontrollierende Variable „Wahlkreisgrösse” allfällige Verzerrungen kor-
rigieren, zweitens wurde von Lutz (2010) postuliert, dass der Effekt des Listenplatzes
bei kürzeren Listen kleiner ist. Bei vorkumulierten Kandidierenden wurde der bessere
der beiden Listenplätze erfasst und der andere ignoriert. Die Ausprägungen der Variab-
le Listenplatz liegen also zwischen 1 und 26.
Regierungsratskandidatur26
Kandidierte jemand zusätzlich für den Regierungsrat, wurde diese Dummy-Variable
mit 1 kodiert, andernfalls mit 0.
Geschlecht 27
Kandidaten wurde die Ausprägung 1 zugeteilt, Kandidatinnen sind mit 0 kodiert.
Alter28
Für die Berechnung des Alters wurden die Jahrgänge der Kandidierenden erfasst und
von 2010 abgezogen. Aufgrund dieser vereinfachten Berechnungsmethode können
kleine Abweichungen von maximal einem Jahr zum tatsächlichen Alter der Kandidie-
renden zum Zeitpunkt der Wahlen auftreten. Natürlich hätte man auch das Modell mit
Jahrgängen rechnen können (mit denselben Ergebnissen), doch lässt sich das Alter in-
tuitiver interpretieren und wurde deshalb hier als Variable bevorzugt.
24 Quelle: Staatskanzlei des Kantons Bern, 2010. URL: http://www.sta.be.ch/wahlen10
25 Ibid.
26 Ibid.
27 Ibid.
28 Ibid.
- 27 -Bachelorarbeit Samuel Timutschin Kullmann 28. Februar 2011
Alter im Quadrat 29
Wie im Theorieteil dargelegt, wird beim Alter ein quadratischer Zusammenhang ver-
mutet. Wird zusätzlich zum Alter das Alter im Quadrat berechnet, kann ein solcher Zu-
sammenhang statistisch festgestellt werden.
Smartvote-Teilnahme30
Kandidierende, die bis zum 28. März 2010 ein Smartvote-Profil aufgeschaltet hatten,
wurden als 1 erfasst, Kandidierende ohne Smartvote-Profil als 0.
Facebook31
Die Anzahl Unterstützungsmitglieder in einer Facebookgruppe wurden am 29. März
2010, also am Tag nach den Grossratswahlen, mittels der Facebook-Suchfunktion er-
fasst. Mittels der Suchbegriffe „Grosser Rat” und „Grand Conseil” konnten die meis-
ten Gruppen gefunden werden, allerdings lässt sich nicht ausschliessen, dass einzelne
Gruppen ohne diese Bezeichnungen nicht erfasst wurden. Berücksichtigt wurden alle
Unterstützungsgruppen und Fanseiten, welche sich auf die Berner Grossratswahlen
2010 bezogen. Die Anzahl Mitglieder von Facebookgruppen, die mehrere Kandidie-
rende zusammen unterstützten, wurden allen zugerechnet. Gruppen oder Fanseiten von
Parteien wurden hingegen nicht weiter berücksichtigt.
3.3 Kontrollierende Variablen
Wahlkreisgrösse32
Die Wahlkreisgrösse wird hier als Kontrollvariable berücksichtigt, um allfällige Ver-
zerrungen zu korrigieren, die aufgrund der unterschiedlichen Wahlkreisgrösse auftre-
ten können. Den kleinsten Wahlkreisen Berner Jura und Oberaargau sind je zwölf Sitze
zugeteilt, der grösste Wahlkreis, Biel-Seeland, wird von 26 Grossratsmitgliedern ver-
treten.
29 Quelle: Staatskanzlei des Kantons Bern, 2010. URL: http://www.sta.be.ch/wahlen10 (2. Februar 2011).
30 Quelle: Smartvote, 2010. URL: http://www.smartvote.ch (29. März 2010)
31 Quelle: Facebook, 2010. URL: http://www.facebook.com (29. März 2010)
32 Quelle: Staatskanzlei des Kantons Bern, 2010. URL: http://www.sta.be.ch/wahlen10 (2. Februar 2011).
- 28 -Bachelorarbeit Samuel Timutschin Kullmann 28. Februar 2011
Listen-interner Wettbewerb33
Je mehr Kandidierende auf einer Liste kandidieren, desto mehr listen-internen Wett-
bewerb gibt es. Wenn auf einer Liste X mit zwölf Plätzen nur sechs Leute kandidieren,
machen diese wahrscheinlich – ceteris paribus – mehr Stimmen, als wenn die Liste mit
zwölf Kandidierenden gefüllt wäre. Der Wert dieser Variable liegt zwischen 0 und 1,
wobei 1 für maximale Konkurrenz steht.
Wahlkreis-interner Wettbewerb
Der Wahlkreis-interne Wettbewerb ist nicht in allen Wahlkreisen gleich stark, vergli-
chen mit der Anzahl der zu vergebenden Mandate. So stellten sich im Wahlkreis Ober-
aargau 143 Kandidierende für 12 Sitze zur Wahl, während im Wahlkreis Berner Jura
nur 103 für 12 Sitze kandidierten. Der Wert dieser Variable liegt wiederum zwischen 0
und 1 (maximale Konkurrenz).
3.4 Heteroskedastizität
Wie die folgende Abbildung beispielhaft zeigt, liegt bei einigen der verwendeten Da-
ten Heteroskedastizität vor. D.h. je näher die unabhängige Variable auf der X-Achse
(Stärke der Liste) an 0 liegt, desto kleiner ist die durchschnittliche Abweichung der
abhängigen Variable auf der Y-Achse (Stimmenzahl) zum geschätzten Mittelwert. Je
grösser der Wert auf der X-Achse, desto breiter sind die Werte auf der Y-Achse ge-
streut. Liegt wie in diesem Fall Heteroskedastizität vor, leidet die Qualität des statisti-
schen Modells darunter.
33 Ibid.
- 29 -Bachelorarbeit Samuel Timutschin Kullmann 28. Februar 2011
Abbildung 6: Ein Beispiel für Heteroskedastizität
Stimmenzahl
12000
10000
8000
6000 R2 = 0.7453
4000
2000
Wählerzahl der Liste
0
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000
Quelle: Staatskanzlei des Kantons Bern, 2010, eigene Darstellung.
3.5 Clustereffekte
Um allfällige Clustereffekte zu korrigieren, wurde das Modell auf die drei Cluster
Wahlkreis, Liste und Partei überprüft (vgl. Anhang II).
- 30 -Bachelorarbeit Samuel Timutschin Kullmann 28. Februar 2011
4 Resultate
4.1 Kurzanalyse der Daten
1938 Kandidatinnen und Kandidaten traten zu den Berner Grossratswahlen 2010 an.
Sie erzielten zusammen über 3,6 Millionen Stimmen und im Durchschnitt 1873 Stim-
men, wobei 50 Prozent der Kandidierenden mehr als 1237 Stimmen erhielten und die
andere Hälfte darunter lag. Das beste Ergebnis konnte Beatrice Simon-Jungi (BDP/
Biel-Seeland) mit 12’519 Stimmen verbuchen; sie wurde gleichzeitig in den Regie-
rungsrat gewählt.34 Am wenigsten Stimmen erhielt Corinne Anderegg (jevp/Oberaar-
gau) mit 65 Stimmen. Entsprechend gross ist die Standardabweichung zum Mittelwert
mit 1780 Stimmen. Acht Prozent der Kandidierenden wurden gewählt.
Der Frauenanteil unter den Kandidierenden liegt mit 32 Prozent etwas höher als der
Anteil der gewählten Grossrätinnen (26 Prozent). Auf eidgenössischer Ebene lag der
Frauenanteil 2007 bei 30 Prozent (Nationalrat), 22 Prozent (Ständerat) und 29 Prozent
(Bundesrat)35. Somit liegt der Kanton Bern hier ziemlich genau im relativ tiefen
Schweizer Mittel.
Zwölf Prozent der Kandidierenden wurden vorkumuliert auf ihren Listen aufge-
führt, sieben Prozent konnten als Bisherige antreten, 77 Prozent haben den Fragebogen
von Smartvote ausgefüllt und 0,4 Prozent der Kandidierenden traten zugleich zu den
Regierungsratswahlen an. Das Durchschnittsalter der Kandidierenden lag bei 43 Jah-
ren. Nadine Löffel (jevp/Mittelland-Nord) wurde einen Monat vor dem Wahltag voll-
jährig und war somit die jüngste Kandidatin. Mit Jahrgang 1932 war Eliette Rollier
(EDU/Berner Jura) die älteste Kandidatin. Für 204 Kandidierende war auf Facebook
eine Unterstüt-zungsgruppe zu finden, ihre durchschnittliche Grösse betrug 114 Mit-
glieder. Die kleinste Gruppe bestand aus drei Mitgliedern, während Patrik Locher
(jevp/Mittelland-Süd) mit 696 Mitgliedern die meisten Facebook-User hinter sich
scharen konnte.
34 Wobei sie 13’693 Stimmen aus dem Wahlkreis Biel-Seeland erhielt.
35Mit der Wahl von Doris Leuthard (CVP/AG) und Simonetta Sommaruga (SP/BE) stieg der Frauenanteil im Bun-
desrat zwischen 2008 und 2010 auf ausserordentliche 57 Prozent.
- 31 -Sie können auch lesen