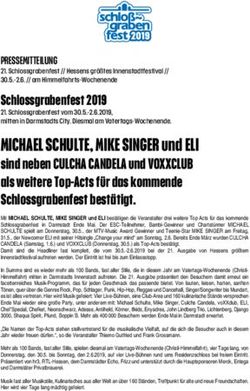Statements Staffellauf Schmerz - Zürcher ...
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
— — Zürcher Hochschule der Künste Zürcher Fachhochschule Statements Staffellauf Schmerz — Showroom Z+ N° 5: Der Schmerz des Anderen — 7./8. April 2016 — — Mit Statements von: Nina Bandi, Hayat Erdoğan, Dieter Mersch, Patrick Müller, Jörg Scheller, Hartmut Wickert Moderation: Corina Caduff — Zürich, 2016
Statements Staffellauf Schmerz Der Showroom Z+ N°5 diskutierte anhand ausgewählter Projekte der ZHdK, wie die Künste den «Schmerz des Anderen» visuell, akustisch, literarisch und performativ in Szene setzen. Was darf man über den Schmerz eines Anderen künstlerisch aussagen, wie kann man ihn inszenieren, mit welcher künstlerischen und politischen Absicht bringt man ihn zur Darstel- lung? Am «Staffellauf Schmerz» am 8. April 2016 nahmen Angehörige unterschiedlicher Diszipli- nen der ZHdK zu den Grenzen der künstlerischen Darstellbarkeit von Schmerz Stellung. Die Publikation versammelt die Auftritte als Statements der Beteiligten.
Statements Staffellauf Schmerz Politik Bilder von Geflüchteten begleiten uns seit Monaten. Was sehen wir auf diesen Bildern? In erster Linie sind es Menschen in Not, Menschen, die erschöpft aus nicht seetüchtigen Boo- ten steigen, Menschen, die hinter Stacheldraht und Gitterzäunen im Dreck und in der Kälte ausharren, und Eltern, die ihre Kinder vor Tränengas, Schlagstöcken und Gummigeschos- sen in Schutz zu nehmen versuchen. Es erreichen uns zum Beispiel Bilder aus Idomeni, das an der Grenze zwischen Griechenland und Mazedonien liegt und wo seit der Schliessung der sogenannten Balkan-Route im März dieses Jahres Tausende Flüchtlinge festsitzen. Was zeigen uns diese Bilder? Was lösen sie in uns aus? Sie appellieren nicht zuletzt an un- ser Mitgefühl mit diesen ‹Anderen›, deren Schmerz und Leid wir vermutlich kaum nachvoll- ziehen können. Was daran ist problematisch und wieso scheinen die Bilder vor allem länger- fristig nicht im empathischen Sinne zu funktionieren? Sie zeigen diese Menschen in erster Linie als Opfer, als ausgelieferte Menschen, die auf unsere Hilfe angewiesen sind und denen jegliche eigene Handlungsfähigkeit abgesprochen wird. Dadurch werden sie aber umso mehr zu dem ‹Anderen› gemacht, zu etwas nämlich, von dem wir uns – als erstes, konstitu- tives Moment – abgrenzen, abgrenzen wollen und abgrenzen müssen. Aus diesen Bildern tritt nicht hervor, dass es die politisch-militärischen Grenzziehungen, also die europäischen Grenzregime sind, die diese Menschen an den Grenzen und dann in einem weiteren Schritt auch in den Medien zu diesem ‹Anderen› machen. Sie sind gezwungen, in die kaum see- tauglichen Boote zu steigen, in Camps auszuharren, obwohl sie sich mit einem Bruchteil des Geldes Flug-, Zug- und Schifftickets besorgen könnten nach Mittel- und Nordeuropa. Als Konsequenz folgt eine unmittelbare Abwehrreaktion: wir können nicht ‹allen› helfen, wir können nicht ‹alle› aufnehmen, wir stossen an unsere Grenzen, auch an die Grenzen unse- res Mitleids mit diesen ‹Anderen›. Bilder im Film, im Theater, in der Kunst hingegen können zeigen, dass die Konstitution der ‹Anderen› Teil der Narration ist. Durch die Verflechtung unterschiedlicher Perspektiven und Sprechpositionen wird zudem deutlich, dass die Handlungsfähigkeit von diesen abhängt. Es geht nicht um die blosse mediale Repräsentation des Leids, sondern um eine ästhetische Öffnung und Verkomplizierung der Verhältnisse zwischen dem sogenannten ‹Wir› und dem sogenannten ‹Anderen›, wodurch klar wird, dass die Trennung so nicht haltbar ist. Es geht darum, die Wege und Bewegungen von Menschen auf der Flucht nachzuzeichnen, ohne die blosse Abbildung des sogenannt ‹Anderen› hinzunehmen. Ein Beispiel dazu ist der Film Passing Drama von Angela Melitopoulos aus dem Jahr 2000, in dem sie unterschiedliche Geschichten von Flucht und Migration von und nach Griechenland über mehrere Jahrzehnte und Generationen hinweg in einer Collage aus narrativem und visuellem Material nachzeich- net. Nina Bandi Philosophin, politische Theoretikerin, Doktorandin im Rahmen des SNF-Projektes What can Art do? an der Hochschule Luzern, Forscherin am Departement Design der ZHdK (DDE).
Statements Staffellauf Schmerz Szene/Szenografie, Bühne/Film Wenn ich an Darstellungen von Schlachten, Kriegsgeschehen, Folter und Misshandlungen, Elend und Not denke, sehe ich zunächst Bilder. Nebst Medienbildern und Fotografien sind dies vor allem filmische Bilder, die sich eingebrannt haben in mein Gedächtnis; Bilder, die stellvertretende Funktionen einnehmen für eine grausame Wirklichkeit, die hier repräsentiert, in Szene gesetzt wird. […] Schmerz ist schwer bis gar nicht kommunizierbar, er zerstört die Sprache und versetzt uns in einen vorbegrifflichen Zustand der Laute und Schreie. Diese Klänge wiederum können Schmerzbilder im Kopf entstehen lassen. […] Warum aber denke ich zuerst an Medien- und Film-Bilder, Fotografien und nicht an z.B. die Zerstückelung des Pentheus durch seine Mutter Agaue in Euripides’ Bakchen, an die Bisse der Penthesilea in Kleists gleichnamigen Drama, an die Enthauptung des Holofernes in Hebbels Judith oder an explizite Vergewaltigungs- und Kannibalismus-Szenen in Sarah Kane’s Zerbombt? Schmerz, Verstümmelung, Tod, Mord, Leiden, Grausamkeiten jeglicher Art prägen doch seit jeher Tragödien. Der künstlerischen Darstellbarkeit und Darstellung von Schmerz im Theater sind Grenzen gesetzt, die der Film scheinbar mühelos überschreiten kann. Seit der griechischen Antike hat das Theater gewisse, sich im Laufe der Zeit durch neue Techniken und Technologien erweiterte, künstlerische Filtermechanismen entwickelt, also theatrale Mittel, die Schmerz- darstellungen möglich machen. Die Teichoskopie, also die Mauerschau, und der Botenbe- richt beispielsweise, als Mittel der Dramentechnik, finden wir zuhauf in antiken und klassi- schen Dramen. Diese Mittel erlauben es über Ereignisse zu sprechen, die man auf der Büh- ne kaum darstellen kann. Schlachten, Hinrichtungen, Auslöschungen ganzer Stadtteile durch Explosionen, Folter usw. lassen sich nun einmal im Theater technisch schlecht reali- sieren. Diese Mittel der Dramentechnik hatte man aber auch entwickelt, weil die Inszenie- rung […] von Gewalt verboten war; auch weil man der Ansicht war, dass schmerzhafte Grausamkeiten, grausamer Schmerz nicht unmittelbar, sondern nur mittelbar darstellbar sei. […] Schmerz lenkt den Blick auf den Körper. Während der Film Schmerz zugleich als Gewalt und als das Leiden daran darstellen kann – z.B. kann ein Close-up mir das schmerzverzerrte Gesicht eines gerade gefolterten Menschen zeigen und in einem Gegenschuss wird bei- spielsweise der durch Peitschenhiebe blutig aufgeplatzte Rücken mit herunterhängenden Hautfetzen gezeigt –, ist das Theater auf Stilisierungen angewiesen: auf der Ebene der Sprache, in Form bestimmter Schmerzmetaphorik, in Form tragischer Schreie, die nach Anzahl, Timing, Länge, Metrik etc. geordnet sind, in Form stilisierter Interjektionen usw. Was der Film kann, nämlich Schmerz-Zufügungen und Schmerz-Äusserungen naturalistisch dar- stellen, ist im Theater zwar bedingt möglich, aber besser zu unterlassen. Beim Versuch na- turalistisch darzustellen, muss man immer davon ausgehen, dass die Zuschauer die Kom- plizenschaft verweigern, weil es eben nicht ‹echt› aussieht, der Schauspieler nicht glaub- würdig erscheint. Dennoch sind diese Grenzen auch die Potentiale des Theaters in Bezug auf die Darstellungsmöglichkeiten vom Schmerz des Anderen. Durch die Stilisierung kann es gelingen, mit der Darstellung von Schmerz über Schmerz-Äusserungen im Alltäglichen hinauszugehen. Dem Theater stehen zwar nicht die illusionsschaffenden Mittel des Films zur Verfügung, aber doch enorme ästhetische Möglichkeiten: Sprache, Präsenz, Körper. Live. Hayat Erdoğan Dramaturgin und Dozentin im MA Theater an der Zürcher Hochschule der Künste (DDK), Kuratorin u.a. im Cabaret Voltaire, Doktorandin an der Kunstuniversität Linz.
Statements Staffellauf Schmerz Philosophie Für das philosophische Denken, das ja vor allem ein Ensemble von Reflexionsverfahren dar- stellt, ist ‹Schmerz› u.a. eines der Paradigmen, an denen sich die Frage von Darstellbarkeit und Undarstellbarkeit entzündet. Denn der Schmerz ist immer eine auf den jeweiligen Kör- per bezogene Singularität, immer etwas, was sich dem Begriff, der Zuschreibung, der Ver- allgemeinerung entzieht. Doch wenn es um das Problem von Darstellung geht, dann erhebt sich sofort die Frage – eine der typischen philosophischen Frageweisen – was eigentlich der Ausdruck ‹Darstellung› genau meint. Denn der Begriff selbst schillert einerseits zwischen der ‹Re-Präsentation› im eigentlichen Sinne, d.h. der Stellvertretung oder Ersetzung von etwas durch etwas anderes, wobei das Präfix ‹Re-› die Wiederholung, das Gedächtnis anzeigt, zweitens der ‹Gegenwärtigmachung› im Sinne eines konkreten Vor-Augen-Stellens, und zwar so, dass es anschaubar oder wahrnehmbar wird, sowie drittens Verkörperung, also der Art und Weise, dem Dargestellten buchstäblich einen Körper, einen Leib zu verleihen, worin es sich manifestiert und leiblich nachvollziehbar wird. Untersucht man Schmerz auf seine Darstellbarkeit, fächert sich also die Untersuchung auf in: erstens seine Repräsentation durch etwas anderes, d.h. ein Zeichen; zweitens seine Wahrnehmbarmachung und damit seine Nachvollziehbarkeit (eine Frage, die die Sinnlichkeit und Affektion und damit auch das Mitgefühl adressiert), sowie drittens seine buchstäbliche Einleibung und Ausleibung, d.h. seine körperliche Vorführung und Ausstellung und damit das, was als leiblicher Ausdruck verstanden werden kann. Das sind drei unterschiedliche Praktiken oder Strategien des ‹Darstellens› im weitesten Sinne, doch muss man – aus philosophischer Perspektive – gestehen, dass sie alle drei scheitern. Aus ihm – dem Schmerz – ein Zeichen zu machen, hat vielleicht am eindringlichsten das christliche Kreuz vorgeführt, das ihn gleichzeitig neutralisiert: Der Schmerz als Symbol trägt schon seine Abstraktion, seinen Verlust mit sich. Aus ihm einen sinnlichen Affekt machen, der unser Mitleid evoziert, appelliert an die Fähig- keit unserer Empathie, die, denkt man an das Leid, das wir auf schonungslose Weise ande- ren oder auch nur der Kreatur zufügen, nicht verallgemeinert werden kann: Das Vermögen zum Mitleid ist durch das Klischee überformt. Schliesslich setzt der Ausdruck des Schmer- zes durch seine Verkörperung voraus, dass wir selbst einen Leib haben und den Schmerz des anderen durch Resonanz körperlich erfahren und mitempfinden können – doch bedeu- tet dies auch, das Verhältnis umdrehen zu können und dem anderen umso mehr und präzi- ser tausendfältige Marter zufügen zu können. Kurz, die Frage der Darstellbarkeit des Schmerzes korrespondiert immer mit der erfinderischen Vervielfältigung des Leidens, so- dass das Beharren auf seine Undarstellbarkeit vielleicht sogar die angemessenere Geste bildet. Gleichwohl habe ich immer empfunden, dass es genügt und sogar viel adäquater wäre, Überlebende von Kriegen und Massakern auf die Bühne zu stellen und sie von der unvorstellbaren Gewalt, die sie erlebt oder gesehen haben, berichten zu lassen, denn was Menschen an Folter für andere Menschen bereithalten, übersteigt jede Fasslichkeit und Analyse. Und eben dies bedeutet dann nicht mehr Darstellung, sondern Bezeugung und Zeugenschaft. Dieter Mersch Philosoph und Mathematiker, Leiter des Instituts für Theorie (ith) an der Zürcher Hochschule der Künste und Professor für Ästhetik und Theorie (DKV).
Statements Staffellauf Schmerz Musik Wie Musik den ‹Schmerz des Anderen› zum Ausdruck bringen kann? Nun, wozu Musik sicherlich in der Lage ist: anderen Schmerz zuzufügen, dies schon alleine durch das Aufdre- hen des Lautstärkereglers. Jedenfalls hat kaum eine andere Kunstform einen solchen unmit- telbaren physischen Zugriff auf den Körper einer Hörenden. Und sie vermag seinen Hörer unvermittelt in ein emotionales Durcheinander zu bringen – wenn auch nur auf Zeit und viel- leicht in lustvoller Weise. Bei der Frage allerdings, was oder wer konkret denn ‹die Anderen› in der Musik sein könnte, deren Schmerz zum Thema wird, mag man schnell in Verlegenheit geraten. In der traditio- nellen Musik insbesondere des 19. Jahrhunderts scheint es so zu sein, dass Musik ‹Schmerz› eher als ein Allgemeines, fast Abstraktes darstellt: Liebesschmerz, Abschieds- schmerz, Todesschmerz. Und das tut sie mit sehr abstrakten, jedenfalls unglaublich artifizi- ellen Mitteln. Auffällig erscheint dabei, dass die höchsten Expressionen von Schmerz oft mit musikgeschichtlichen Wendepunkten einhergehen – zwei Beispiele: Ein Madrigal wie Clau- dio Monteverdis Cruda Amarilli, das letztlich von enttäuschter Liebe und Todessehnsucht handelt, also von höchstem seelischen Schmerz, führte zu einem handfesten musikästheti- schen Streit (und nebenher auch zur Erfindung einer komplett neuen Gattung: der Oper). Ein Leitmotiv aus Richard Wagners Musikdrama Tristan und Isolde, das für Trauer und Liebes- schmerz steht, ist zu einem der berühmtesten und meist-analysierten Akkorde der Musikge- schichte überhaupt geworden, ein Symbol für die Auflösung der Tonalität, die sich im 20. Jahrhundert dann realisiert hat. In beiden Fällen ist aber nicht die Frage relevant geworden, welcher Schmerz denn da ausgedrückt wird – sondern wie dieser zum Ausdruck gebracht ist: Der Streit bezieht sich selbstreferenziell darauf, wie jeweils die Dissonanz verwendet wird: nämlich massiv gegen die damals herrschenden Regeln. Die starke Tendenz der abstrakten Kunst und Musik zur Selbstreferenzialität zog sich im 20. Jahrhundert weiter und führte – durchaus in engem Zusammenhang mit der Auflösung der Tonalität – zu einem sehr grundsätzlichen Wandel in doppelter Hinsicht. Zum einen hat sich die direkte Koppelung zwischen klanglichem Phänomen und dessen traditionell zugeschrie- bener Bedeutung nach und nach aufgelöst: In Alban Bergs Oper Wozzeck beispielsweise ist es ein C-Dur-Akkord – also die Konsonanz schlechthin –, der im Umfeld einer atonalen Musiksprache Ausdruck höchster seelischer Verletzung repräsentiert. Und dass ein Kratzen des Bogens auf einer Cellosaite als hässlich oder schmerzhaft empfunden werden soll, dem wird eben – zum Beispiel in Helmut Lachenmanns Solo-Cellostück Pression – geradewegs widersprochen: Als Schönheit gilt vielmehr, so ein berühmtes Diktum des erwähnten Kom- ponisten, die Verweigerung von Gewohnheit. Mit Gewohnheit sind aber genau die Glei- chungen Dissonanz = Schmerz, Konsonanz = Glück, Geräusch = hässlich, Ton = schön gemeint. Ästhetischer Wert entstehe gerade da, wo diese Kopplungen aufgelöst, aktiv ver- weigert werden. Zum anderen stellt viele Musik des 20. und 21. Jahrhunderts radikal in Abrede, dass sie emotionale Sachverhalte darlegen will: Die Überwältigungsästhetik eines Richard Wagner wird nach den Verwerfungen des 20. Jahrhunderts nicht mehr als legitime Haltung angese- hen. Musik zieht sich verstärkt auf ihre Selbstreferenzialität zurück, Weltbezug wird mit anderen Mitteln hergestellt. Musik will nicht mehr als eine Ausdruckskunst in dem Sinne verstanden werden, dass sie Emotionen ausdrücken wollte. Beide Entwicklungen führen dazu, dass der Kunstform Musik der Schmerz abhandengekommen ist – wie manchen Leuten ein Stock oder Hut. Patrick Müller Musik- und Literaturwissenschaftler, Leiter MA Transdisziplinarität (DKV) an der Zürcher Hochschule der Künste, Projektleiter Connecting Spaces Hong Kong–Zürich.
Statements Staffellauf Schmerz Schmerzgrenzen des Körpers Der Philosoph Leszek Kołakowski hat in den Siebzigerjahren die interessante These formu- liert, dass wir in einer Kultur der Analgetiker leben, also in einer Kultur der Schmerzvermei- dungsstrategie. Eine solche Kultur kann sich, laut Kołakowski, nicht mehr eine christliche Kultur nennen, weil sich die christliche Moral und Ethik fundamental aus der Leidens- und Schmerzerfahrung speist. Weiterhin ist eine solche Kultur für Kołakowski unerträglich, weil sie thymotische Grundbedürfnisse des Menschen ignoriere. Nämlich das Bedürfnis nach Stolz, das Bedürfnis danach, etwas Grosses, etwas Gewaltiges unter Schmerzen und unter Hinnahme von Verlusten zu schaffen. Hier kommt für mich das Bodybuilding ins Spiel. Ich sehe im Bodybuilding eine Reaktion auf die Kultur der Analgetiker und zwar in dem Sinne, dass der Bodybuilder sich bewusst Schmerzen zufügt, sich bewusst selbst zerstört. Der Bodybuilder arbeitet nach dem Hypertrophie-Prinzip. Er zerstört kontrolliert und strategisch Muskelfasern, damit sie sich über das Ausgangsniveau hinaus aufbauen. Das ist tatsächlich ein kryptoreligiöses, auf alle Fälle kryptochristliches Moment. Es wird gelitten, es werden Schmerzen in Kauf genommen oder bewusst herbeigeführt, um den Ausgangszustand zu transzendieren, um über sich hinauszuwachsen. Andererseits kippt das Bodybuilding dann, und das macht es für mich so interessant, doch wieder ins Analgetische. Nämlich über den Umweg der Ästhetik. Der Bodybuilder schafft eben dieses gewaltige, dieses stolzbewegte Ich-Kunstwerk und ist nunmehr bemüht, dieses zu konservieren und zu schützen. Er operiert in einem quasi-musealen Raum, wo er sozusa- gen Künstler, Restaurator und Kurator seiner selbst ist. […] Er ist eher eine posthistorische Figur mit einem starken Hang zum Ästhetizismus. Was die Darstellung von Schmerzen im Bodybuilding anbelangt, so sind diese Schmerzens- männer, wie im Flex-Magazin beispielsweise, sehr beliebt. Auch da erkenne ich ein krypto- religiöses Moment: Die Bildformeln folgen stark dem Prinzip der imitatio passionis. Die Bil- der repräsentieren nicht nur, sondern die/der Betrachter_in soll sich in diese Bilder hinein- versenken, damit sie/er so wird, wie es die dort Dargestellten bereits sind. Es gibt einen trans-ikonischen Impuls aus dem Bild heraus. […] Die Grenzen dieser Darstellung liegen natürlich im Extrem. Je extremer die Darstellung des Schmerzes, des Leidens, das vonnö- ten ist, um diese Körper zu erzeugen, desto stärker tritt ein Effekt hervor, den man ‹comic masculinity› nennt. Das Sich-Einfühlen bzw. Sich-Versenken ist hier weniger gut möglich, weil ein inhärent ironischer Effekt durch die Übersteigerung eintritt. Jörg Scheller Kunstwissenschaftler, Journalist und Musiker, Dozent für Kunstgeschichte und Co-Leiter der Vertiefung Fotografie (DKM) an der ZHdK.
Statements Staffellauf Schmerz Theater/Performance Wie entsteht überhaupt die Idee, den Anderen und seine Leiden zu verkörpern oder darzu- stellen und wie nimmt diese Idee Formen an? Seit den Debatten der Aufklärung um die Natur des Menschen ist das Gefühl und insbesondere das Mitleidsgefühl eine zentrale Be- zugsgrösse. Rousseau leitet aus dem Mitleid alle sozialen Tugenden ab. Mitleid besteht gemäss Rousseau darin, sich an die Stelle dessen zu versetzen, der leidet. Wir leiden nicht in uns, sondern in ihm, wenn wir Mitleid empfinden. Das Vermögen, uns mit anderen zu identifizieren, entspränge unserer Einbildungskraft. Das Mitleidsgefühl ist also nicht so ur- sprünglich, wie Rousseau es sich wünscht, sondern bedarf der Vermittlungsarbeit und der Einbildungskraft. Allerdings geht die Argumentation Rousseaus weiter: Mitleid empfinde ich mit dem Anderen nur in Abhängigkeit von dem, wovon ich meine, dass es auch mir gesche- hen kann. Es verwandelt sich so in Egoismus. […] Andersherum: den Anderen leiden zu se- hen, befreit uns von den Schmerzen, die er leidet, so Rousseau. […] Das Verständnis von psychologischem oder Einfühlungstheater gipfelt methodisch/ideo- logisch im Method Acting, einer Technik, mit der Schauspieler_innen so tief in ihre Figur eintauchen, dass sie sie nicht mehr spielen, sondern wortwörtlich verkörpern, sie werden, unter Aufgabe der eigenen Person. Gewährsleute und Begründer dieser Auffassung waren die amerikanischen Schauspieler Lee Strasberg und Stella Adler. Beide haben sich auf die methodischen Ansätze des Anfangs des vorigen Jahrhunderts tätigen russischen Schau- spielers und Regisseurs Konstantin Stanislavski bezogen, der die psychologische Weise des Schauspielens begründet hat. […] Dazu wurden unterschiedliche Übungen und Techni- ken entwickelt, die alle um die Kategorie des emotionalen Gedächtnisses gelagert sind. Die- ses auszubilden, zu mobilisieren und abrufbar zu machen, ist Basisvermögen des sich ein- fühlenden Spiels. Die zweite Generation des Method Actings hat diese Aufgaben und Ziele durch die Intensi- vierung der Vorbereitungen bis ins Extreme perfektioniert. Robert de Niro, Al Pacino und Dustin Hofmann sind Protagonisten dieser Art zu spielen (übrigens alle hauptsächlich im Film agierend). Zu den Praktiken dieser Schauspielergeneration gehören Schlafentzug oder auch starke körperliche Transformationen. […] Dass Schauspieler an den Formen einer sol- cherart motivierten Selbstaufgabe zerbrechen können, belegen die Beispiele von Philip Seymour Hofmann und Heath Ledger. Die Körper, die sich dem Anderen hinzugeben in der Lage sind, tun dies in extremis bis zur Selbstgefährdung. Diese Art der Schauspielkunst kann zu einer Art Schamanismus werden. Womit wir bei Antonin Artaud angelangt wären, der sich nicht der Rolle, sondern dem Theater selbst hingibt, in diesem aufgeht, sich auflöst und zu eben dem Schamanen wird, der die Mission verfolgt, mit seinem Beispiel das Leben zu heilen. Hartmut Wickert Direktor Darstellende Künste und Film (DDK) an der ZHdK, Regisseur, Co-Initiator der departements-übergreifenden Projektinitiative Laokoon 2016.
Statements Staffellauf Schmerz Impressum Zürcher Hochschule der Künste Toni-Areal, Pfingstweidstrasse 96 CH-8005 Zürich Z+ Departement Kulturanalysen und Vermittlung Leitung: Corina Caduff www.zhdk.ch/zplus Redaktion: Stephanie Ehrsam, Mirjam Steiner
Sie können auch lesen