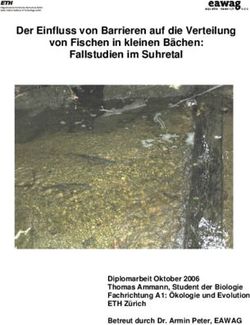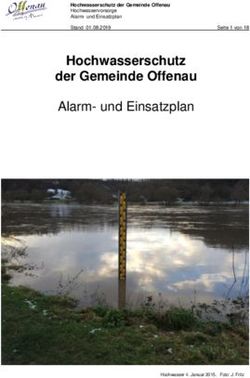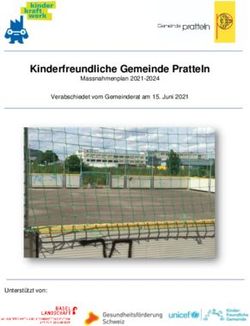Strategische Revitalisierungsplanung Planungsbericht 2012-2031
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
KANTON LANDWIRTSCHAFTS- UND UM- AMT FÜR UMWELT Stansstaderstrasse 59, 6371 Stans, 041 618 75 04,
NIDWALDEN WELTDIREKTION, BAUDIREKTION, www.nw.ch
JUSTIZ- UND
SICHERHEITSDIREKTION
Strategische Revitalisierungsplanung
Planungsbericht 2012-2031
Zuhanden des Bundesamtes für Umwelt (BAFU)
STANS, 27.11.2014Strategische Revitalisierungsplanung Titel: Strategische Revitalisierungsplanung. Planungsbericht 2012-2031 Typ: Bericht Version: 03 Thema: Klasse: FreigabeDatum: Autor: Eva Schhager Status: DruckDatum: 27.11.2014 Ablage/Name planungsbericht_revitplanungsplanung_nw_bafu_2014_11_27.doc Registratur: Bericht vom 27.11.2014 2/57
Strategische Revitalisierungsplanung
Inhalt
1 Ausgangslage ...................................................................................................................6
1.1 Vorgaben und Ziele der Strategischen Planung ....................................................... 6
1.2 Finanzierung der Revitalisierungsmassnahmen ....................................................... 7
1.3 Höhere Abgeltungen an Hochwasserschutzprojekte ................................................ 8
1.4 Zuständigkeiten und Vorgehensweise im Kanton Nidwalden ................................... 8
1.5 Fliessgewässereinzugsgebiete und grobe Gewässercharakteristik .......................... 9
2 Grundlagendaten für die Revitalisierungsplanung......................................................9
2.1 Kantonales Gewässernetz ....................................................................................... 9
2.2 Ökomorphologischer Gewässerzustand ................................................................... 9
2.3 Gewässerräume ..................................................................................................... 10
2.4 Anlagen im Gewässerraum .................................................................................... 10
2.5 Parameter zur Bestimmung des ökologischen Potenzials bzw. der landschaftlichen
Bedeutung.............................................................................................................. 13
3 Vorgehensweise bei der Planung / GIS-Analysen .................................................... 15
3.1 Aufwertungspotenzial ............................................................................................. 16
3.2 Ökologisches Potenzial und landschaftliche Bedeutung ......................................... 17
3.3 Nutzen für Natur und Landschaft............................................................................ 18
4 Plausibilisierungen anhand Expertenwissen ............................................................ 18
5 Massnahmenpriorisierung und Definition von Massnahmentypen ....................... 20
5.1 Revitalisierungsschwerpunkte und –grundsätze allgemein ..................................... 22
5.2 Engelberger Aa ...................................................................................................... 22
5.3 Seitengewässer Engelberger Aa ............................................................................ 22
5.4 Talgewässer Stanser Boden (Gemeinden Stans, Stansstad, z.T. Oberdorf) .......... 23
5.5 Gewässer in der Gemeinde Emmetten................................................................... 23
5.6 Gewässer in den Gemeinden Buochs/Ennetbürgen ............................................... 23
5.7 Gewässer in der Gemeinde Ennetmoos ................................................................. 24
Bericht vom 27.11.2014 3/57Strategische Revitalisierungsplanung 5.8 Gewässer in der Gemeinde Hergiswil..................................................................... 24 6 Koordination mit weiteren relevanten Planungen .....................................................24 7 Massnahmenblätter .......................................................................................................25 7.1 Lutherseebach ....................................................................................................... 25 7.2 Nechimattbach ....................................................................................................... 26 7.3 Giessen Dörfli......................................................................................................... 27 7.4 Secklisbach ............................................................................................................ 28 7.5 Humligenbach ........................................................................................................ 29 7.6 Lochrütibach........................................................................................................... 30 7.7 Buoholzbach .......................................................................................................... 31 7.8 Dorfbach Dallenwil ................................................................................................. 32 7.9 Chrottenbach.......................................................................................................... 33 7.10 Mühlebach Oberdorf – oberer Teil .......................................................................... 34 7.11 Mühlebach Oberdorf – „alter Mühlebach“ ............................................................... 35 7.12 Baumgartenbach .................................................................................................... 36 7.13 Engelberger Aa – Bereich Grafenort/Mettlen, Auenperimeter ................................. 37 7.14 Engelberger Aa – uh Kurve Ännerberg ................................................................... 38 7.15 Engelberger Aa – Bereich Dallenwil bis Grafenort .................................................. 38 7.16 Engelberger Aa – Mündungsbereich ...................................................................... 39 7.17 Dorfbach Stans ...................................................................................................... 40 7.18 Dorfbach Oberdorf.................................................................................................. 41 7.19 Mühlebach Stans und Bürgenberggraben .............................................................. 42 7.20 Rotigraben ............................................................................................................. 43 7.21 Dorfbach Ennetbürgen und Vorderbodenbach ....................................................... 44 7.22 Dorfbach Buochs .................................................................................................... 45 7.23 Mühlebach Buochs ................................................................................................. 46 7.24 Schüpfgraben/Giessen ........................................................................................... 47 7.25 Dorfbach Emmetten ............................................................................................... 48 Bericht vom 27.11.2014 4/57
Strategische Revitalisierungsplanung 7.26 Melbach und Bruderhausbach Ennetmoos ............................................................. 49 7.27 Luterbach/Sagenbachkanal .................................................................................... 50 7.28 A2-Kanal/Dorfbach Stans, Galgenriedgraben, Rosstränkekanal ............................ 51 7.29 Mühlebach Stansstad ............................................................................................. 52 7.30 Steinibach Hergiswil ............................................................................................... 53 7.31 Dorfbach - Rösslipark ............................................................................................. 54 7.32 Feldbach ................................................................................................................ 55 7.33 Mühlebach Hergiswil .............................................................................................. 56 8 Literatur .......................................................................................................................... 57 9 Anhang ........................................................................................................................... 57 Bericht vom 27.11.2014 5/57
Strategische Revitalisierungsplanung
1 Ausgangslage
Seit der Revision der eidgenössischen Gewässerschutzgesetzgebung im Jahr
2011 sind die Kantone verpflichtet, für die Revitalisierung von Gewässern zu sor-
gen und diese zu planen. Ziel ist, bei einem Viertel der Fliessgewässer(länge) mit
schlechtem morphologischem Zustand langfristig durch Revitalisierungen die na-
türlichen Funktionen wieder herzustellen. Das Resultat sind naturnahe Fliessge-
wässer mit gewässertypischer Eigendynamik bezüglich Morphologie, Abfluss-
und Geschieberegime, die von naturnahen, standorttypischen Lebensgemein-
schaften besiedelt werden und prägende Elemente der Landschaft bilden.
1
Art. 38a Abs. 1 GSchG Revitalisierung von Gewässern
Die Kantone sorgen für die Revitalisierung von Gewässern. Sie berücksichtigen dabei
den Nutzen für die Natur und die Landschaft sowie die wirtschaftlichen Auswirkungen, die
sich aus der Revitalisierung ergeben.
1.1 Vorgaben und Ziele der Strategischen Planung
Die strategische Revitalisierungsplanung ist über den ganzen Kanton in einem
geeigneten Detaillierungsgrad zu erstellen. Sie hat sich an den hydrologischen
Einzugsgebieten zu orientieren und ist nicht auf einzelne Gewässer/abschnitte zu
beschränken. Grundsätzlich müssen alle grossen und bedeutenden Gewässer
sowie deren wichtige Zuflüsse in die Planungen integriert werden. Aber auch
kleinere Gewässer, Seitenbäche, eingedolte Gewässer, Quellbäche und Quellen
sind zu berücksichtigen, da sie im Gewässersystem wichtige Funktionen wahr-
nehmen. Die Planung muss nachvollziehbar sein und soll einem schlüssigen
Konzept zu Grunde liegen.
Mit der strategischen Planung werden die prioritären Fliessgewässer bezeichnet,
bei denen eine möglichst grosse Wirkung zur Wiederherstellung der natürlichen
Funktionen im Verhältnis zum Aufwand erreicht werden kann.
Die Planung ist bis zum 31. Dezember 2013 zur Stellungnahme dem Bundesamt
für Umwelt (BAFU) einzureichen und bis spätestens zum 31. Dezember 2014
vom Kanton zu verabschieden. Sie ist für einen Umsetzungszeitraum von 20 Jah-
ren festgelegt und alle 12 Jahre zu erneuern. Der Rhythmus der Aktualisierung
orientiert sich an den 4-Jahres-Perioden der NFA2.
Die Planung umfasst die in den nächsten 20 Jahren prioritär zu revitalisierenden
Gewässer/abschnitte, die entsprechenden Massnahmentypen sowie die Fristen
zur Umsetzung der Massnahmen. Die Revitalisierungsplanung ist mit den weite-
ren in der Gewässerschutzgesetzgebung geforderten strategischen Planungen
zur Sanierung der Wasserkraft (Fischdurchgängigkeit, Schwall-Sunk, Geschie-
behaushalt) sowie anderen relevanten Planungen (z.B. Hochwasserschutz) ab-
zustimmen. Falls erforderlich ist die Planung ausserdem mit den Nachbarkanto-
nen zu koordinieren. Zusätzlich wird die strategische Revitalisierungsplanung von
der zuständigen Fachstelle für Natur- und Landschaftsschutz in ein Landschafts-
entwicklungskonzept (LEK) auf Stufe Richtplan eingebunden, welches sich mit
Aufwertungsmassnahmen in der Landschaft befasst.
1
Bundesgesetz über den Schutz der Gewässer (Gewässerschutzgesetz, GSchG), SR 814.20
2
Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen mit einem Sys-
temwechsel in der Subventionspolitik im Umweltbereich. Bund und Kantone legen in Programmvereinbarungen
gemeinsam fest, welche Umweltziele sie erreichen wollen und welche Subventionen der Bund dafür zur Verfü-
gung stellt.
Bericht vom 27.11.2014 6/57Strategische Revitalisierungsplanung
Art. 38a Abs. 2 GSchG Revitalisierung von Gewässern
Die Kantone planen die Revitalisierungen und legen den Zeitplan dafür fest. Sie sorgen
dafür, dass diese Planung bei der Richt- und Nutzungsplanung berücksichtigt wird. Für
einen Verlust an Fruchtfolgeflächen ist nach den Vorgaben der Sachplanung des Bundes
nach Artikel 13 RPG Ersatz zu leisten.
3
Art. 41d GSchV Planung von Revitalisierungen
1
Die Kantone erarbeiten die Grundlagen, die für die Planung der Revitalisierungen der
Gewässer notwendig sind. Die Grundlagen enthalten insbesondere Angaben über:
a. den ökomorphologischen Zustand der Gewässer;
b. die Anlagen im Gewässerraum;
c. das ökologische Potenzial und die landschaftliche Bedeutung der Gewässer.
2
Sie legen in einer Planung für einen Zeitraum von 20 Jahren die zu revitalisierenden
Gewässerabschnitte, die Art der Revitalisierungsmassnahmen und die Fristen fest, innert
welcher die Massnahmen umgesetzt werden, und stimmen die Planung soweit erforder-
lich mit den Nachbarkantonen ab. Revitalisierungen sind vorrangig vorzusehen, wenn de-
ren Nutzen:
a. für die Natur und die Landschaft gross ist;
b. im Verhältnis zum voraussichtlichen Aufwand gross ist;
c. durch das Zusammenwirken mit anderen Massnahmen zum Schutz der na-
türlichen Lebensräume der zum Schutz vor Hochwasser vergrössert wird.
3
Sie verabschieden die Planung nach Absatz 2 für Fliessgewässer bis zum 31. Dezem-
ber 2014 und für stehende Gewässer bis zum 31. Dezember 2018. Sie unterbreiten die
Planungen dem BAFU jeweils ein Jahr vor deren Verabschiedung zur Stellungnahme.
4
Sie erneuern die Planung nach Absatz 2 alle 12 Jahre für einen Zeitraum von 20 Jahren
und unterbreiten diese dem BAFU jeweils ein Jahr vor deren Verabschiedung zur Stel-
lungnahme.
Art. 46 GSchV Koordination
1
Die Kantone stimmen die Massnahmen nach dieser Verordnung soweit erforderlich auf-
einander und mit Massnahmen aus anderen Bereichen ab. Sie sorgen ausserdem für ei-
ne Koordination der Massnahmen mit den Nachbarkantonen.
1bis
Sie berücksichtigen bei der Erstellung der Richt- und Nutzungsplanung die Planungen
nach dieser Verordnung.
1.2 Finanzierung der Revitalisierungsmassnahmen
Ab dem 1. Januar 2016 werden Abgeltungen an Revitalisierungen nur gewährt,
wenn der Kanton eine den Anforderungen von Art. 41d GSchV entsprechende
Planung erstellt hat. Die Ergebnisse der strategischen Planung wirken sich auf
die Höhe der Abgeltungen des Bundes an Revitalisierungsmassnahmen aus. So
werden Massnahmen mit einem grossen Nutzen für Natur und Landschaft im
Verhältnis zum voraussichtlichen Aufwand stärker finanziell unterstützt als Mass-
nahmen mit geringem Nutzen. Massnahmen die nicht in der strategischen Pla-
nung enthalten sind, werden vom Bund nur mit dem Ansatz geringer Nutzen (also
mit einem geringeren Subventionssatz) unterstützt.
Art. 63 GSchG Allgemeine Voraussetzungen für die Gewährung der Abgeltungen
Die Abgeltungen werden nur geleistet, wenn die vorgesehene Lösung auf einer zweck-
mässigen Planung beruht, einen sachgemässen Gewässerschutz gewährleistet, dem
Stand der Technik entspricht und wirtschaftlich ist.
Art. 54b GSchV Durchführung von Massnahmen zur Revitalisierung
3
Gewässerschutzverordnung (GSchV), SR 814.201
Bericht vom 27.11.2014 7/57Strategische Revitalisierungsplanung
1
Die Höhe der globalen Abgeltungen an die Massnahmen zur Revitalisierung von Ge-
wässern (Art. 62b Abs. 1 GSchG) richtet sich nach:
a. der Länge des Gewässerabschnitts, der revitalisiert oder durch die Beseitigung von
Hindernissen zusätzlich durchgängig wird;
b. der Breite der Gerinnesohle des Gewässers3;
c. der Breite des Gewässerraums des Gewässers, das revitalisiert wird;
d. dem Nutzen der Revitalisierung für die Natur und die Landschaft im Verhältnis
zum voraussichtlichen Aufwand;
e. dem Nutzen der Revitalisierung für die Erholung;
f. der Qualität der Massnahmen.
2
Die Höhe der globalen Abgeltungen wird zwischen dem BAFU und dem betroffenen
Kanton ausgehandelt.
3
Abgeltungen können einzeln gewährt werden, wenn die Massnahmen:
a. mehr als fünf Millionen Franken kosten;
b. einen kantonsübergreifenden Bezug aufweisen oder Landesgrenzgewässer be-
treffen;
c. Schutzgebiete oder Objekte nationaler Inventare berühren;
d. wegen der möglichen Alternativen oder aus anderen Gründen in besonderem
Mass eine komplexe oder spezielle fachliche Beurteilung erfordern; oder
e. unvorhersehbar waren.
4
Der Beitrag an die anrechenbaren Kosten der Massnahmen nach Absatz 3 beträgt zwi-
schen 35 und 80 Prozent und richtet sich nach den in Absatz 1 genannten Kriterien.
5
Abgeltungen an Revitalisierungen werden nur gewährt, wenn der betroffene Kanton ei-
ne den Anforderungen von Artikel 41d entsprechende Planung von Revitalisierungen er-
stellt hat.
6
Keine Abgeltungen nach Artikel 62b Absatz 1 GSchG werden gewährt für Massnahmen,
die nach Artikel 4 des Bundesgesetzes vom 21. Juni 19916 über den Wasserbau erfor-
derlich sind.
1.3 Höhere Abgeltungen an Hochwasserschutzprojekte
Die im vorliegenden Planungsbericht 2012-2031 vorgesehenen Wasser-
baumassnahmen befinden sich nahezu ausschliesslich an Gewässern bzw. Ge-
wässerabschnitten, die neben ökologischen Defiziten auch ein Hochwasser-
schutzdefizit aufweisen. Mit Aufwertungen, welche über die Anforderungen an ei-
nen naturnahen Wasserbau im Rahmen des Hochwasserschutzes hinausgehen,
lassen sich bedeutende zusätzliche Subventionen generieren. Dies ist vor allem
für Projekte mit einem schlechten Kosten/Nutzenverhältnis aus Sicht Hochwas-
serschutz interessant.
1.4 Zuständigkeiten und Vorgehensweise im Kanton Nidwalden
Die Zuständigkeiten für die strategische Revitalisierungsplanung liegen im Kan-
ton Nidwalden bei der Landwirtschafts- und Umweltdirektion (Gewässerschutz),
der Baudirektion (Wasserbau, Natur- und Landschaftsschutz) sowie der Justiz-
und Sicherheitsdirektion (Fischerei). Die Federführung obliegt der Landwirt-
schafts- und Umweltdirektion. Die Planung wird durch das Amt für Umwelt erar-
beitet und von einer Arbeitsgruppe, welche sich aus Mitarbeitenden des Tiefbau-
amtes, der Fachstelle für Natur- und Landschaftsschutz sowie der Fachstelle für
Jagd und Fischerei zusammensetzt, begleitet. Die Genehmigung und Verab-
schiedung der Planung erfolgt durch den Regierungsrat.
Die technische Umsetzung der Analysen im Geografischen Informationssystem
(GIS) wurde durch die GISAG vorgenommen.
Bericht vom 27.11.2014 8/57Strategische Revitalisierungsplanung
Die Planung erfolgte in enger Koordination und Zusammenarbeit mit dem Kanton
Obwalden (Amt für Landwirtschaft und Umwelt).
1.5 Fliessgewässereinzugsgebiete und grobe Gewässercharakteristik
Das Hauptgewässer im Kanton Nidwalden ist die Engelberger Aa. Sie durch-
fliesst auf Nidwaldner Boden das Engelbergertal zwischen Grafenort und Buochs,
wo sie in den Vierwaldstättersee mündet. Die grösseren Seitengewässer der En-
gelberger Aa sind der Secklisbach, der Steinibach Dallenwil und der Buoholz-
bach. Weitere grössere Gewässer, die direkt in den Vierwaldstättersee münden
sind Melbach (Gemeinde Ennetmoos), Steinibach (Hergiswil), Lielibach (Becken-
ried) und Choltalbach (Beckenried/Emmetten).
Aufgrund der vorherrschenden Topografie setzt sich das Gewässernetz im Kan-
ton Nidwalden grösstenteils aus steileren Wildbächen zusammen. Nur einzelne
Mündungsabschnitte in den Vierwaldstättersee sowie die mehrheitlich vom
Grundwasser gespiesenen Talbäche weisen ein geringeres Gefälle auf.
2 Grundlagendaten für die Revitalisierungsplanung
Das Vorgehen im Planungsprozess orientiert sich an der Vollzugshilfe des BAFU
(2012). In einem ersten Schritt mussten die notwendigen Datengrundlagen zu-
sammengestellt bzw. bei Bedarf erhoben werden. Nachfolgend sind die verwen-
deten Daten sowie deren Relevanz und Verfügbarkeit im Kanton Nidwalden an-
geführt.
2.1 Kantonales Gewässernetz
Das kantonale Gewässernetz befindet sich gegenwärtig in einer Überarbeitung.
Die Daten der ökomorphologischen Zustandserhebung sowie alle auf dem Ge-
wässernetz aufbauenden Abbildungen und Analysen beziehen sich auf den
Stand des Gewässernetzes vom Mai 2012.
2.2 Ökomorphologischer Gewässerzustand
Der ökomorphologische Gewässerzustand gemäss Modul Stufen Konzept Stufe
F (BUWAL, 1998) bildet eine zentrale Grundlage für die Revitalisierungsplanung.
Mit diesen Daten liegen Informationen bezüglich der mittleren Sohlenbreite und
der Breitenvariabilität, zu Verbauungen von Sohle, Böschungsfuss und Uferbe-
reich sowie zu Durchgängigkeitsstörungen in Form von Abstürzen oder Bauwer-
ken vor. Auch kann von den Daten der Handlungsbedarf hinsichtlich morphologi-
scher Aufwertung abgeleitet werden.
Die flächendeckende Ersterhebung der Ökomorphologie im Kanton Nidwalden
erfolgte 2003/2004. Aufgrund des Datenalters bzw. z.T. massiver Veränderungen
wegen des ausgeprägten Hochwassers 2005 und Folgemassnahmen wurde vom
Kanton eine Neukartierung 2012 in Auftrag gegeben. Der Projektperimeter um-
fasst grundsätzlich alle (zugänglichen) Gewässer bzw. Gewässerabschnitte in-
nerhalb der Höhenkurve 1‘200 m. Zum Teil wurden auch einzelne höher gelege-
ne Gewässer kartiert, z.B. in touristisch intensiv genutzten Gebieten.
Das kantonale Gewässernetz umfasst rund 1‘120 km Fliessgewässerlänge. Da-
von wurden ca. 360 km (ca. 32 %) bezüglich ökomorphologischem Gewässerzu-
stand bewertet. Einzelne bei der Kartierung berücksichtigte Gewässerabschnitte
konnten nicht klassiert werden, z.B. bei fehlender Wasserführung oder falscher
Lage des Gewässers. Bei den nicht kartierten Gewässer/abschnitten handelt es
sich vorwiegend um höher gelegene Gewässer bzw. auch sehr steile Runsen, die
z.T. keine ständige Wasserführung aufweisen oder um nicht zugängliche Berei-
che. Zudem liegen im Kanton diverse Hangentwässerungen, wie z.B. in Becken-
ried oberhalb der Nationalstrasse sowie in der Gemeinde Hergiswil vor. Diese
künstlich angelegten Entwässerungssysteme sind nicht in der Planung enthalten.
Bericht vom 27.11.2014 9/57Strategische Revitalisierungsplanung
47 km natürlich/naturnah
wenig beeinträchtigt
stark beeinträchtigt
künstlich/naturfern
eingedolt
49 km
168 km
39 km
57 km
Abb. 1: Verteilung der Zustandsklassen Ökomorphologie Stufe F gemäss Kartierungsresultate 2012
47 % bzw. 168 km der kartierten Gewässerlänge weisen einen natür-
lich/naturnahen ökomorphologischen Zustand auf. Diese Gewässerabschnitte be-
finden sich nahezu ausschliesslich im Wald oder in höheren Lagen. Weitere
57 km (16 %) sind wenig beeinträchtigt. Handlungsbedarf bezüglich einer Ver-
besserung der morphologischen Bedingungen weisen v.a. die Klassen stark be-
einträchtigt, künstlich/naturfern bzw. eingedolt auf. Insgesamt fallen 135 km
(38 %) in diese Kategorien. Zum Grossteil befinden sich diese Gewässerab-
schnitte in den hinsichtlich Besiedelung, Infrastruktur bzw. Landwirtschaft stark
genutzten Talböden.
Im Zuge der Kartierungen wurden auch die Durchgängigkeitsstörungen sowie
Bauwerke an den Gewässern aufgenommen. Während in den Gewässern der
Talebenen nur relativ wenige Hindernisse vorliegen, ist der Längsverlauf der stei-
len Bergbäche durch Wildbachverbauungen, Geschiebesammler oder Wasser-
fassungsbauwerke stark künstlich untergliedert. Aufgrund der Topografie weisen
die betroffenen Gewässer allerdings oftmals auch natürlicherweise Abstürze auf.
2.3 Gewässerräume
Ein genügend grosser Gewässerraum ist neben der Wasserführung und der
Wasserqualität ein zentraler Faktor für die Gewährleistung der natürlichen Ge-
wässerfunktionen. Die Verfügbarkeit von genügend Raum ist demnach auch eine
wesentliche Voraussetzung für die Umsetzung von Revitalisierungsmassnahmen.
Die kantonale Revitalisierungsplanung erfolgt unabhängig von der Festlegung
des Gewässerraumes nach Art. 36a GSchG4. Als notwendige Eingangsgrösse im
Planungsprozess wird der Gewässerraum gemäss Übergangsbestimmung zur
Änderung der GSchV vom 4. Mai 2011 verwendet. Die aktuelle Sohlenbreite für
die Berechnung des Gewässerraumes wurde gemäss Daten der ökomorphologi-
schen Zustandskartierung verwendet. Lagen bereits umgesetzte Gewässerräume
in den jeweiligen Nutzungsplanungen der Gemeinden vor, wurden diese für die
Analysen verwendet.
Die Gewässerräume entlang der Fliessgewässer innerhalb der Bauzonen sind in
acht Gemeinden in den Nutzungsplanungen festgelegt. Zusätzlich liegen rechts-
gültige Gewässerraumausscheidungen an verschiedenen Gewässern vor, an de-
nen Hochwasserschutzmassnahmen vorgenommen wurden.
2.4 Anlagen im Gewässerraum
Anlagen im Gewässerraum beeinflussen Revitalisierungsvorhaben, indem sie die
Umsetzung von Massnahmen unter Umständen gänzlich verunmöglichen oder
zumindest massiv erschweren. Die Erhebung der Anlagen im Gewässerraum
sowie die Einschätzung des Aufwandes für deren Entfernung ist eine Grundlage
4
Bundesgesetz über den Schutz der Gewässer (Gewässerschutzgesetz, GSchG), SR 814.20
Bericht vom 27.11.2014 10/57Strategische Revitalisierungsplanung
für die Bestimmung des Aufwertungspotenzials. Die in der Planung berücksichtig-
ten Anlagentypen sind in Tab. 1 angeführt und orientieren sich grundsätzlich an
der Wegleitung des BAFU. Als Datenbasis dienen die Amtliche Vermessung
(AV), der Leitungskataster, der Kataster der belasteten Standorte sowie das In-
ventar der Wasserentnahmen. Falls dies als Ergänzung erforderlich war, wurden
die Daten speziell für die Planung zusammengestellt.
Kraftwerkszentralen und kulturtechnische Anlagen (z.B. Reservoire, Brunnenstu-
ben, etc.) sind nicht separat angeführt, da sie mit den Gebäuden gemäss AV be-
reits erfasst sind. Hochwasserdämme und Wildbachverbauungen sowie Aus-
gleichsbecken und Staustufen wurden im Rahmen zweier Expertenrunden zur
Plausibilisierung der GIS-Analysen berücksichtigt.
Bericht vom 27.11.2014 11/57Strategische Revitalisierungsplanung
Tab. 1: Anlagentypen im Gewässerraum und eine grobe Abschätzung des voraussichtlichen Aufwandes zur Entfernung
Voraussichtlicher Aufwand zur Verlegung aus dem Gewässerraum
Anlagen gross mittel gering Einstufung BAFU
2 2
Gebäude >30 mStrategische Revitalisierungsplanung
2.5 Parameter zur Bestimmung des ökologischen Potenzials bzw. der land-
schaftlichen Bedeutung
Revitalisierungen oder Aufwertungen sind nicht an allen Gewässern gleich sinn-
voll, auch wenn sie mit verhältnismässigem Aufwand realisierbar wären. Um mit
den verfügbaren Mitteln einen möglichst grossen Nutzen für die Natur und Land-
schaft zu erzielen, sind bei der Priorisierung von Massnahmen das ökologische
Potenzial und die landschaftliche Bedeutung des Gewässers zu berücksichtigen.
Bei einem naturnahen Gewässer entspricht das ökologische Potenzial dessen
ökologischer Bedeutung im heutigen Zustand. Bei beeinträchtigen Gewässern
entspricht das ökologische Potenzial dessen Bedeutung in einem gedachten Be-
zugs- oder Referenzzustand, in dem die vom Menschen verursachten Beein-
trächtigungen soweit beseitigt sind, als dies mit verhältnismässigen Kosten mög-
lich ist. Für die Bestimmung des ökologischen Potenzials bzw. der landschaftli-
chen Bedeutung wurden die in Tab. 2 angeführten Datengrundlagen herangezo-
gen. Als Basis dienten einerseits die verschiedenen Bundesinventare bzw. kan-
tonalen Inventare, zum Teil erfolgte die Datenzusammenstellung zu einzelnen
Themen speziell in Hinblick auf die Revitalisierungsplanung.
Die Beschriebe im Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler von
nationaler Bedeutung (BLN) zu den im Kanton Nidwalden liegenden Inventarob-
jekten Nr. 1505 Pilatus und 1506 Vierwaldstättersee mit Kernwald, Bürgenstock
und Rigi erwähnen keine Fliessgewässer oder mit ihnen in Zusammenhang ste-
hende Lebensräume. Auch die aus diesem Inventar abgeleitete Schutzzieldefini-
tion des Kantons Nidwalden (BLN-Konzept Nidwalden) hat daher die Fliessge-
wässer nicht im Fokus. Einzig der Teilraum V11 Klewenalp/Stockhütte/Choltal
misst dem Choltal eine besondere Bedeutung bei. Bei den Analysen wurden die
BLN-Gebiete daher nicht integriert. Die Naturschutzgebiete im Kanton sind neben
anderem durch Inventare zu Hoch- und Flachmooren, Amphibien sowie zu einer
kantonalen Aue abgedeckt. Zu den schutzwürdigen gewässernahen Lebensräu-
men und zu den darin vorkommenden Arten liegen keine kantonsweiten konsi-
stenten Kartierungen vor. Die vorhandenen Informationen flossen als Experten-
wissen in die Planungen ein.
Die Aspekte Vernetzung und Durchgängigkeit sowie die besondere Bedeutung
von Mündungen wurden in den Expertenrunden berücksichtigt.
Aufgrund der Stellungnahme des BAFU zum Planungsbericht vom 12.03.2014
wurde ebenfalls die Relevanz der beim Bund vorliegenden Daten zu hoher Ar-
tenvielfalt und national prioritären Arten in Fliessgewässerabschnitten für die vor-
liegende Planung überprüft.
Bericht vom 27.11.2014 13/57Strategische Revitalisierungsplanung
Tab. 2: Datengrundlagen für die Bestimmung des ökologischen Potenzials bzw. der landschaftlichen Bedeutung
Daten Grundlage, Quelle
Bundesinventare:
Flachmoore, Hochmoore, Moorlandschaften GIS Layer Bund mit kantonalen Anpassungen
Amphibienlaichgebiete und nicht definitiv berei- GIS Layer Bund mit kantonalen Anpassungen
nigte Objekte
Fliessgewässerabschnitte mit hoher Artenvielfalt GIS Layer Bund (nicht in der GIS Analyse gemäss Kap. 3 enthalten)
oder national prioritären Arten
Weitere Schutzgebiete und Lebensräume:
Besondere Fischlebensräume - Gewässer bzw. GIS Layer Seeforellengewässer basierend auf bekannten Vorkommen, Expertenwissen
Laichgewässer von Seeforelle, Bachneunauge
Smaragd-Gebiete GIS Layer Bund
Kantonsinventare:
Flachmoore, Hochmoore, Amphibien, Auenge- GIS Layer Kanton
biete
Weitere Kriterien:
Abfluss - Restwasser GIS Layer Kanton basierend auf Inventar der Wasserfassungen
Abfluss – Schwall-Sunk GIS Layer Kanton
Gefälle GIS Layer Kanton (basierend auf Hangneigungen)
Fischgewässer GIS Layer Kanton basierend auf bekannten Fischvorkommen, Expertenwissen, Gewässergefälle
Bericht vom 27.11.2014 14/57Strategische Revitalisierungsplanung
3 Vorgehensweise bei der Planung / GIS-Analysen
Die Datengrundlagen liegen in der Regel als Daten mit einem geografischen Be-
zug (Geodaten) vor. Diese werden in einer ersten Phase miteinander verknüpft
(⇒GIS-Analyse). In einer zweiten Phase müssen die Ergebnisse der GIS-
Analyse mit Hilfe von Expertenwissen plausibilisiert werden (⇒Plausibilisierung).
Datengrundlagen
Ökomorphologischer Anlagen Ökologisches Potenzial und
Zustand der Gewässer im Gewässerraum landschaftliche Bedeutung
Ökomorphologie F, Gebäude, Schutzgebiete,
Durchgängigkeits- Verkehrswege, gefährdete Arten,
störungen, ... ... historische Karten, ...
Vorgehen 1
GIS-Analyse
Aufwertungspotenzial
2
Ergebnis GIS-Analyse
3
Plausibilisierung
Nutzen für Natur und
Landschaft im Verhältnis zum
voraussichtlichen Aufwand
Synergien und Konflikte
Hochwasserschutz,
4 Erholungsnutzung,
Landbedarf,
...
Zeitliche Priorität
Abb. 2: Vorgehen bei der Revitalisierungsplanung
Der Ablauf der Planung gliedert sich gemäss Wegleitung des BAFU (2012) in vier
Schritte:
Schritt 1: Bestimmung des Aufwertungspotenzials: Verknüpfung des ökomor-
phologischen Zustandes des Gewässers mit den Anlagen im Gewässerraum.
Das daraus resultierende Aufwertungspotenzial bezeichnet die mit verhältnis-
mässigem Aufwand mögliche Aufwertung des Gewässers.
Schritt 2: Verknüpfung des Aufwertungspotenzials mit dem ökologischen Poten-
zial und der landschaftlichen Bedeutung des Gewässers. Das daraus resultieren-
de Ergebnis bildet die Grundlage für die Bestimmung des Nutzens für Natur und
Landschaft im Verhältnis zum voraussichtlichen Aufwand.
Bericht vom 27.11.2014 15/57Strategische Revitalisierungsplanung
Schritt 3: Bestimmung des Nutzens für die Natur und Landschaft im Verhältnis
zum voraussichtlichen Aufwand durch Plausibilisierung unter besonderer Berück-
sichtigung des ökologischen Potenzials und der landschaftlichen Bedeutung der
Gewässer.
Schritt 4: Bestimmung der zeitlichen Priorität der Revitalisierungsmassnahmen,
unter Berücksichtigung von Synergien, insbesondere mit dem Hochwasser-
schutz, der Erholungsnutzung und mit anderen Massnahmen und Planungen mit
Auswirkungen auf die Gewässer sowie von möglichen Konflikten.
In einem 5. Schritt sind für die geplanten Revitalisierungen die Massnahmenty-
pen festzulegen. Mögliche Typen sind:
− Aufweitungen
− Ausdolungen
− Aufwertung von Sohlen- und Gewässerbettstrukturen
− Aufwertung von Uferstrukturen
− Verbesserung der Vernetzung mit dem Umland
− Auenrevitalisierung
− Gerinneverlegungen
− Wiederherstellung der Längsvernetzung
− Initiation von Mäandern.
3.1 Aufwertungspotenzial
Das Aufwertungspotenzial bezeichnet das Ausmass der möglichen Aufwertung
an einem Gewässer unter Berücksichtigung der Verhältnismässigkeit, indem vor-
handene Anlagen im Gewässerraum einbezogen werden. Es ist gross, wenn
dessen ökomorphologischer Zustand schlecht ist und die Möglichkeit zur Aufwer-
tung des Gewässers nicht wesentlich eingeschränkt ist durch Anlagen im Ge-
wässerraum (Tab. 3).
Das Aufwertungspotenzial wurde im Rahmen der GIS-Analysen für die einzelnen
Abschnitte der Ökomorphologie Stufe F bestimmt. Durchgängigkeitsstörungen
wurden nicht in die GIS-Analysen einbezogen, sondern im Rahmen der Plausibi-
lisierung berücksichtigt.
Natürliche Gewässer haben kein Aufwertungspotenzial, jedoch muss der Erhal-
tung natürlicher Gewässerabschnitte oberste Priorität beigemessen werden.
Tab. 3: Bestimmung des Aufwertungspotenzials durch Verschnitt des ökomorphologischen Zustands mit
den Anlagen im Gewässerraum
Aufwertungspotenzial Ökomorphologischer Zustand (gemäss Ökomorphologie Stufe F)
natürlich/ wenig stark naturfremd/
naturnah beeinträchtigt beeinträchtigt künstlich,
eingedolt
Anlagen im keine gering mittel gross gross
Gewässerraum
(bzw. Aufwand gering gering mittel gross gross
zu deren Ent-
fernung) mittel kein gering mittel gross
5
gross kein gering gering gering
5
in Abweichung der Wegleitung wird das Aufwertungspotenzial bei wenig beeinträchtigten Gewässerabschnitten und grossem
Aufwand für die Entfernung von Anlagen aus dem Gewässerraum anstatt kein (Aufwertungspotenzial) als gering eingestuft.
Bericht vom 27.11.2014 16/57Strategische Revitalisierungsplanung
Um einen Verschnitt der verschiedenen Anlagen mit dem Gewässerraum ausfüh-
ren zu können, wurden alle Anlagentypen als Flächenelemente verwendet. Für
linienförmige Daten wie z.B. diverse Leitungen wurde dazu ein angemessener
Puffer um die Elemente gelegt.
Zur Bestimmung des Aufwandes für die Entfernung der Anlagen aus dem Ge-
wässerraum war es notwendig, eine Aggregierung und Klassierung vorzuneh-
men. Dazu wurden jeweils die Gesamtflächenanteile der Anlagen mit grossem,
mittlerem bzw. geringen Aufwand im Gewässerraum ermittelt. Bei sich überla-
gernden Anlagen, wurden die betroffenen Flächenanteile mehrfach berücksichtigt
und können somit Gesamtflächenanteile von mehr als 100 % ergeben. Gewäs-
serabschnitte mit einem hohen Prozentanteil an Anlagen im Gewässerraum, wel-
che einen grossen Aufwand auslösen, erhielten folglich die Klassierung Aufwand
gross. Entsprechende Herleitungen für die Klassen mittel und gering sind nach-
folgend angeführt.
grosser Aufwand:
− Σ Flächenanteil Anlagen mit grossem Aufwand zur Entfernung >25 %
− Σ Flächenanteile Anlagen gross 50 %
mittlerer Aufwand:
− Σ Flächenanteile Anlagen gross 0 und ≤ als nach Art. 31 GSchG +
kein Schwall-Sunk bzw. Schwall-Sunk saniert bis 2030 +
Fischgewässer
geringes Potenzial:
− kein Restwasser bzw. keine Sanierung Schwall-Sunk bis 2030
Bericht vom 27.11.2014 17/57Strategische Revitalisierungsplanung
− steile Gewässer >35°
− Restwasserabfluss >0 und ≤ als nach Art. 31 GSchG +
kein Schwall-Sunk bzw. Schwall-Sunk saniert bis 2030 +
kein Fischgewässer +
kein Bundes- oder Kantonsinventar
mittleres Potenzial:
− alle anderen Ausprägungen
3.3 Nutzen für Natur und Landschaft
Aus der Verknüpfung des Aufwertungspotenzials mit dem ökologischen Potenzial
und der landschaftlichen Bedeutung des Gewässers in einer GIS-Analyse resul-
tiert eine Karte, welche die Grundlage für die Bestimmung des Nutzens für Natur
und Landschaft im Verhältnis zum voraussichtlichen Aufwand bildet. Dieses Er-
gebnis der GIS-Analyse wird in einem nächsten Schritt mittels Expertenwissen
plausibilisiert und bereinigt (siehe Kap. 4).
Tab. 4: Nutzen für Natur und Landschaft im Verhältnis zum voraussichtlichen Aufwand (Verschnitt Aufwer-
tungspotenzial mit ökologischem Potenzial/landschaftlicher Bedeutung)
Nutzen für Natur und Landschaft Aufwertungspotenzial
gering mittel gross
Ökologisches gering gering gering mittel
Potenzial und land-
schaftliche Bedeu- mittel gering mittel gross
tung
gross mittel gross gross
4 Plausibilisierungen anhand Expertenwissen
Basierend auf den Resultaten der in Kapitel 3 angeführten Planungsschritte 1 bis
4 wurden im Rahmen von zwei Expertenrunden die Resultate diskutiert und ver-
schiedene Korrekturen vorgenommen. Diese umfassten im Wesentlichen folgen-
de Punkte:
− Berücksichtigung von Sperrentreppen und anderen für den Hochwasserschutz
notwendigen Bauten
− Überprüfung bzw. Neubeurteilung von sehr kurzen isolierten Abschnitten
− Überprüfung bzw. Neubeurteilung von Abschnitten in Inventaren, die aus Sicht
Natur- und Landschaftsschutz keine Relevanz für die Bedeutung des inventa-
risierten Schutzgutes haben
− Berücksichtigung von Revitalisierungen im Siedlungsgebiet
− Berücksichtigung von Synergien und Gelegenheiten
− Neuanlage von Gewässerabschnitten (v.a. in Hinblick auf Entschärfung der
Hochwasserproblematik sowie der Siedlungsentwässerung)
Tab. 5: Ergebnisse der GIS-Analyse, der Plausibilisierung sowie die Vorgaben des BAFU bezüglich der maximal mit
grossem bzw. mittlerem Nutzen auszuweisenden Fliessgewässerlänge
Nutzen für Natur und GIS-Analyse 1. Plausibilisierung 2. Plausibilisierung Vorgabe Bund
Landschaft [km]
gering 161 272 270
mittel 74 27 36 68
gross 129 60 54 34
Bericht vom 27.11.2014 18/57Strategische Revitalisierungsplanung
Die starke Reduktion der Gewässerabschnitte mit grossem bzw. mittlerem Nut-
zen im Rahmen der ersten Plausibilisierung ist grösstenteils auf vorhandene
Hochwasserschutzbauten (v.a. Sperrentreppen) zurückzuführen. Diese sind nicht
in die GIS-Analyse eingeflossen und konnten demnach erst bei der Plausibilisie-
rung berücksichtigt werden.
In einer zweiten Expertenrunde wurden die Planungsergebnisse zusammenhän-
gend nochmals überprüft sowie eine zeitliche Priorisierung der Massnahmen vor-
genommen.
Die Daten zur Artenvielfalt und zu national prioritären Arten in Fliessgewässerab-
schnitten haben keine Auswirkungen auf den Nutzen für die Natur und Land-
schaft. Die im Kanton Nidwalden vorliegenden Hotspots, unter Berücksichtigung
der aquatischen und terrestrischen Arten, befinden sich nahezu ausschliesslich in
naturnahen oder wenig beeinträchtigten Gewässerabschnitten mit entsprechend
geringem Aufwertungspotenzial. Beim Grossteil der betroffenen beeinträchtigten
Strecken wurde bereits basierend auf der GIS-Analyse ein grosser Nutzen für die
Natur und Landschaft attestiert. Vereinzelt befinden sich Hotspots bei eingedol-
ten oder naturfremden Abschnitten, eine Änderung des Nutzes war hier nicht an-
gezeigt.
Das Resultat der Plausibilisierung ist eine bereinigte Karte mit dem Nutzen von
Revitalisierungen für Natur und Landschaft im Verhältnis zum voraussichtlichen
Aufwand in den drei Kategorien gering, mittel und gross.
Gemäss der Vollzugshilfe Renaturierung der Gewässer ist ein grosser Nutzen für
die Natur und Landschaft bei höchstens ¼ der gemäss der ökomorphologisch er-
fassten Gewässer der Klassen eingedolt, künstlich/naturfremd bzw. stark beein-
trächtigt auszuweisen. Ein mittlerer Nutzen ist für höchstens die Hälfte der
Fliessgewässerabschnitte mit schlechtem Zustand festzulegen. Die Vorgabe für
die Ausweisung eines grossen Nutzens wird im Kanton Nidwalden um 20 km
überschritten, die Fliessgewässerlänge mit mittlerem Nutzen umfasst nur ca. die
Hälfte der Vorgabe. An dieser Einstufung wird mit folgender Begründung fest-
gehalten:
− Aufgrund der Flughöhe der Planung sind die ausgewiesenen Gewässerab-
schnitte mit grossem Nutzen grösstenteils sehr grob gewählt und werden da-
her bei der konkreten Umsetzung von Projekten ohnehin eine geringere Länge
umfassen.
− Bei der Engelberger Aa sind insgesamt 15 km Gewässerlänge mit grossem
Nutzen ausgeschieden. Gewässeraufwertungen im Zuge der Umsetzung von
Hochwasserschutzmassnahmen werden jedoch nicht in diesem Ausmass er-
folgen können, sondern nur auf ausgewählten Abschnitten. Deren genaue La-
ge bzw. Umfang sind gegenwärtig noch nicht festgelegt. Die bezüglich Revita-
lisierung massgebenden Streckenlängen fallen dadurch effektiv viel kürzer
aus als in der groben strategischen Planung ausgewiesen.
− Die Erfahrung zeigt, dass die Umsetzung von wasserbaulichen Projekten nicht
einfach ist und aufgrund demokratischer Prozesse nicht alle geplanten Projek-
te umgesetzt werden können.
− Das BAFU kann mithilfe der NFA-Programmvereinbarung und der Genehmi-
gung von Einzelprojekten den Umfang der Mittelzuteilung steuern bzw. be-
grenzen.
Bericht vom 27.11.2014 19/57Strategische Revitalisierungsplanung
5 Massnahmenpriorisierung und Definition von Massnahmentypen
Die strategische Revitalisierungsplanung ist als rollende Planung zu verstehen,
die alle 12 Jahre zu aktualisieren und auf insgesamt 80 Jahre auszurichten ist.
Um die zeitliche Priorisierung der Revitalisierungen zu bestimmen, ist die kanto-
nale Revitalisierungsplanung mit anderen Planungen und Nutzungen sowie mit
möglichen Konflikten abzustimmen. Die Priorisierung der Revitalisierungsmass-
nahmen orientiert sich an den Vorgaben des BAFU sowie den erzielbaren Syner-
gien, v.a. mit dem Hochwasserschutz.
Die Prioritätensetzung bezieht sich somit auf folgende Programmvereinbarungs-
perioden:
⇒ Umsetzung 2012-2015
⇒ Umsetzung 2016-2019
⇒ Umsetzung 2020-2023
⇒ Umsetzung 2024-2027
⇒ Umsetzung 2028-2031
Alle übrigen Gewässer bzw. Gewässerabschnitte mit hohem oder mittlerem Nut-
zen bzw. solche, bei denen Revitalisierungsmassnahmen planmässig oder fi-
nanztechnisch nicht innerhalb der ersten 20 Jahre umgesetzt werden konnten,
werden in den nachfolgenden 12-jährlichen Planungsrhythmen berücksichtigt.
Eine erste Aktualisierung der strategischen Planung ist per Ende 2026 zu verab-
schieden, so dass die Planungsergebnisse ab der Programmperiode 2028-2031
berücksichtigt werden können.
Die konkreten Massnahmenplanungen sind im Rahmen der einzelnen konkreten
Wasserbauprojekte umzusetzen. In Tab. 6 sind die prioritär zu revitalisierenden
Gewässerabschnitte6 bis 2031 angeführt und in Kap. 5.2 bis 5.8 kurz beschrie-
ben.
6
Revitalisierungen häufig im Rahmen von Hochwasserschutzprojekten
Bericht vom 27.11.2014 20/57Gemeinde Gewässer Abschnitt von [m] bis [m] L [m] Umsetzung Nutzen f. Natur, Landschaft, Erholung
BU/OB Engelberger Aa unterhalb Kurve Ännerberg 2774 2996 222 2012-2015 gross
ST Dorfbach Stans Länderpark bis Spichermatt (Projekt ASTRA) 1249 1480 231 2012-2015 gross
BU Dorfbach Buochs Fischmattstrasse bis Dorfplatz 242 449 207 2016-2019 gross
BU Schüpfgraben/Giessen Mündung bis ausserhalb Siedlungsgebiet 0 1313 1313 2016-2019 gross
Bericht vom 27.11.2014
BU/EB Mühlebach Buochs Mündungsabschnitt 0 241 241 2016-2019 gross
DA Dorfbach_Dallenwil Städtli bis Allmend 522 1186 664 2016-2019 gross
EB Dorfbach Ennetbürgen Mündung bis Öltrotte 0 810 810 2016-2019 gross
EB Dorfbach Ennetbürgen Hirsacher 895 1020 125 2016-2019 gross
EB Dorfbach Ennetbürgen oberhalb Riedmatt 1175 1389 214 2016-2019 gross
Strategische Revitalisierungsplanung
EB Vorderbodenbach Mündungsabschnitt 0 232 232 2016-2019 gross
EM Dorfbach Emmetten Perimeter Gestaltungsplan Bergrausch bis Hinterhofstattstrasse 0 309 309 2016-2019 gross
HE Steinibach Hergiswil Kantonsstrasse bis Autobahn 120 670 550 2016-2019 mittel
Tab. 6: Übersicht 20 Jahresplanung
OB Mühlebach Oberdorf Mündung bis oberhalb Tuftloch 1066 1515 920 2016-2019 gross
OB Mühlebach Oberdorf Mündungsabschnitt 0 119 119 2016-2019 gross
OB Chrottenbach Mündung bis Oberallmend 0 530 530 2016-2019 gross
OB/WO Buoholzbach Mündung bis Geschiebesammler 0 309 309 2016-2019 gross
WO Nechimattbach Mündung bis Wald 0 610 610 2016-2019 gross
WO Humligenbach Mündungsabschnitt 0 95 95 2016-2019 gross
EB Rotigraben Mündung bis Gemeindegrenze 0 1392 1392 2020-2023 gross
ES Melbach St. Jakob 4265 4598 333 2020-2023 gross
ES Bruderhausbach Mündung bis Quellaustritt 0 303 303 2020-2023 gross
HE Steinibach Hergiswil Mündungsabschnitt bis Kantonsstrasse 0 120 120 2020-2023 gross
OB alter Mühlebach Mündung bis Zilibach 0 1066 1066 2020-2023 gross
OB Baumgartenbach Mündung bis Steilstufe 0 210 210 2020-2023 gross
SD Galgenriedbach Mündung bis Ursprung 0 287 287 2020-2023 gross
SD Mühlebach Stansstad Abschnitt Fischzucht Zugweid 1559 1735 176 2020-2023 gross
SD/ST Rosstraenkekanal Mündung bis Ried 0 1468 1468 2020-2023 gross
SD/ST A2-kanal/Dorfbach Stans Mündung bis Länderpark 0 1053 1053 2020-2023 gross
ST Mühlebach Stans Gemeindegrenze Stansstad bis Ursprung 1735 3432 1697 2020-2023 gross
ST Bürgenberggraben Risismühle 2853 3025 172 2020-2023 gross
WO Lutherseebach Mündung bis Steilstufe 0 645 645 2020-2023 gross
WO Secklisbach Mündung bis Geschiebesammler 0 200 200 2020-2023 gross
ES Luterbach/Sagenbachkanal Mündung bis inklusive Fischzucht 0 1062 1062 2024-2027 gross
HE Feldbach Mündung bis Sonnenbergstrasse 0 859 859 2024-2027 mittel
HE Dorfbach Hergiswil Mündungsabschnitt bis Kantonsstrasse, Rösslipark 0 50 50 2024-2027 gross
OB Dorfbach Oberdorf Gemeindegrenze Stans bis Staldifeld/Ursprung 3434 5231 1797 2024-2027 gross
ST Dorfbach Stans Autobahn/Spichermatt bis Zentralbahn 1521 2511 990 2024-2027 gross
ST Dorfbach Stans Schlüsselmättli bis Winkelriedhostatt 3140 3434 294 2024-2027 gross
WO Lochrütibach Kantonsstrasse bis Geschiebesperre Ennetacher 184 1218 1034 2024-2027 mittel
WO Lochrütibach Mündung bis Kantonsstrasse 0 184 184 2024-2027 gross
BU Engelberger Aa Mündungsabschnitt 0 650 650 2028-2031 gross
HE Mühlebach Hergiswil Mündungsabschnitt bis Kantonsstrasse 0 38 38 2028-2031 mittel
WO Giessen Dörfli Mündung bis ca. Bahnhof Dörfli 0 300 299.9 2028-2031 gross
WO (+OW) Engelberger Aa Grafenort Auenperimeter 14100 16950 2850 2028-2031 gross
21/57Strategische Revitalisierungsplanung
5.1 Revitalisierungsschwerpunkte und –grundsätze allgemein
Der Revitalisierungsplanung werden folgende Grundsätze zugrundegelegt:
− Erhaltung der natürlichen/naturnahen Gewässerstrecken mit einer allenfalls
notwendigen Verbesserung des morphologischen Zustandes sowie der Ab-
fluss- und Geschiebedynamik.
− Wiederherstellung der Längsvernetzung, Anbindung von Seitengewässern
sowie Verbesserung der Vernetzung mit dem Umland (dabei wird die Proble-
matik der Verbreitung von Neozoen bzw. die Erhaltung von Rückzugsgebieten
für bedrohte einheimische Arten berücksichtigt).
− Sicherstellung eines ausreichenden Gewässerraumes für den Hochwasser-
schutz und zur Verbesserung des Gewässerzustandes bei beeinträchtigten
Gewässern.
− Wiederherstellung bzw. Förderung einer gewässergerechten Ufervegetation.
− Extensive Gestaltung und Bewirtschaftung des Gewässerraumes.
Mit den getroffenen Revitalisierungsmassnahmen sollen vorwiegend die Ursa-
chen für Beeinträchtigungen behoben werden und keine Symptombehandlung er-
folgen. Eine eigendynamischen Entwicklung des Gewässers ist dem Bau des
Zielzustandes vorzuziehen.
5.2 Engelberger Aa
Die Engelberger Aa weist sowohl morphologische (Ökomorphologie, Geschiebe)
als auch hydrologische (Restwasser, Schwall-Sunk) Defizite auf. Hochwasser-
schutzmassnahmen sind zwischen der Mündung in Buochs und Dallenwil umge-
setzt, weiter flussaufwärts bis Grafenort bzw. weiterreichend auf dem Kantons-
gebiet von Obwalden wird gegenwärtig ein Hochwasserschutzprojekt erarbeitet.
Der Talboden des Engelbergertals wird von verschiedenen Nutzungen bean-
sprucht (Siedlung, Zentralbahn, Kantonsstrasse, Landwirtschaft). Grossflächige
Revitalisierungen werden aufgrund der Flächenbeanspruchung zum heutigen
Zeitpunkt als nicht realistisch eingeschätzt, obwohl Aufwertungspotenzial, ökolo-
gisches und landschaftliches Potenzial und damit auch der Nutzen für die Natur
und Landschaft als gross eingestuft werden.
In der ersten Planungsphase werden demnach einerseits nur einzelne lokale
Aufweitungen, die auch hochwasserschutztechnisch begründet sind, integriert.
Andererseits aufgrund er vielfältigen Bedeutung des Gewässers auch für die Er-
holungsnutzung, die Aufwertung des Deltas in den Vierwaldstättersee, eine loka-
le Aufweitung unterhalb der Kurve Ännerberg sowie in Koordination mit dem Kan-
ton Obwalden eine Auenreaktivierung im Bereich Grafenort.
Im Weiteren ist eine Koordination mit erforderlichen Massnahmen zur Sanierung
Schwall-Sunk, Wiederherstellung der Fischdurchgängigkeit sowie Sanierung des
Geschiebehaushalts erforderlich.
− Engelberger Aa Öffnung Delta
− Engelberger Aa Auenreaktivierung Grafenort/Mettlen
− Engelberger Aa Aufweitung unterhalb Kurve Ännerberg
− Engelberger Aa lokale Aufweitungen zwischen Dallenwil und Grafenort.
5.3 Seitengewässer Engelberger Aa
Prioritäre Massnahmen an den Seitengewässern der Engelberger Aa sind vor al-
lem an deren Unterläufen bis zur Mündung in den Hauptfluss vorgesehen. Diese
Abschnitte haben als Rückzugsgebiete bei Hochwasser, aber auch als Laich-
und Jungfischlebensräume grosse Bedeutung. Eine funktionierende Anbindung
an die Engelberger Aa ist hier essentiell wie auch eine gewässertypspezifische
Strukturierung des Gewässerbettes und der Ufer mit einer ausreichenden Besto-
Bericht vom 27.11.2014 22/57Strategische Revitalisierungsplanung
ckung zur Beschattung des Gewässers bzw. zum Eintrag von Nahrungsgrundla-
gen. Wichtig sind vor allem jene Gewässer mit ausreichender, ganzjähriger Was-
serführung, wie die Grundwasser gespiesenen Bäche und Giessen. Revitalisie-
rungen und Aufwertungen in der ersten Planungsphase von 20 Jahren sind an
folgenden Gewässern vorgesehen:
− Lutherseebach
− Giessen Dörfli
− Secklisbach
− Humligenbach Mündungsabschnitt
− Lochrütibach
− Chrottenbach
− Nechimattbach
− Mühlebach Oberdorf
− Buoholzbach
− Dorfbach Dallenwil
5.4 Talgewässer Stanser Boden (Gemeinden Stans, Stansstad, z.T. Oberdorf)
Bezüglich der Talgewässer im Stanser Boden erfolgt die Massnahmenpriorisie-
rung vor allem abgeleitet aus möglichen Synergien mit den erforderlichen Hoch-
wasserschutzmassnahmen. Abschliessende Ergebnisse zu den hochwasser-
schutztechnischen Erfordernissen liegen gegenwärtig noch nicht vor. Im Rahmen
von verschiedenen Baugesuchen bzw. Voranfragen zu Gestaltungsplänen wur-
den an einzelnen Gewässern jedoch bereits Vorgaben gemacht. Bezüglich
Durchgängigkeit der Gewässer für Fische ist die Barriere bei der ehemaligen
Fischzucht Zugweid von Bedeutung. Für Aufwertungen in den nächsten 20 Jah-
ren sind folgende Gewässer vorgesehen:
− Dorfbach Stans/Oberdorf
− Baumgartenbach
− Rosstränkekanal
− Galgenriedbach mit Seitenarm
− Mühlebach Stans/Bürgenberggraben
− A2-Kanal
− Mühlebach Stansstad
5.5 Gewässer in der Gemeinde Emmetten
In der Gemeinde Emmetten ist prioritär der Dorfbach offenzulegen. Der zukünfti-
ge Bachlauf soll als Naturelement einerseits die Ortszone aufwerten und trägt
anderseits auch zur Entschärfung der Entwässerungsproblematik bei.
− Dorfbach Emmetten
5.6 Gewässer in den Gemeinden Buochs/Ennetbürgen
In der Gemeinde Ennetbürgen wird gegenwärtig ein Hochwasserschutzprojekt
erarbeitet, welches sowohl die steilen Hanggewässer, als auch die Gewässer des
flachen Talgrundes einschliessen. Bezüglich Revitalisierung stehen der Dorfbach
sowie der Rotigraben im Vordergrund. Einzelne bereits umgesetzte Aufwer-
tungsmassnahmen sollen miteinander vernetzt und vor allem im Längskontinuum
zum See hin angebunden werden. Aufgrund der Lage spielt auch die Erholungs-
funktion sowie Aufwertung des Siedlungsgebietes eine wesentliche Rolle. Auch
eine Ausdolung des Vorderbodenbaches wird diesbezüglich geprüft. Weitere
Gewässer, die im Rahmen der vorliegenden Planung aufgewertet werden sollen
sind nachfolgend angeführt.
Bericht vom 27.11.2014 23/57Sie können auch lesen