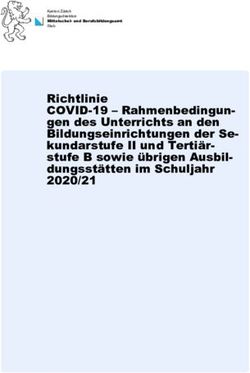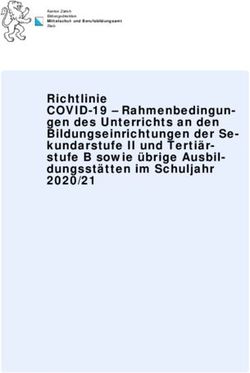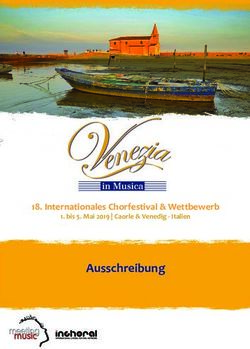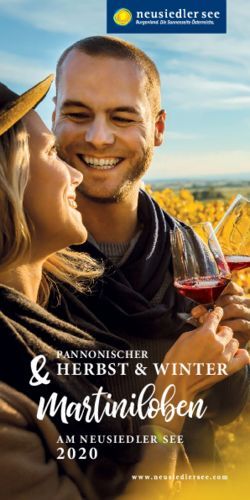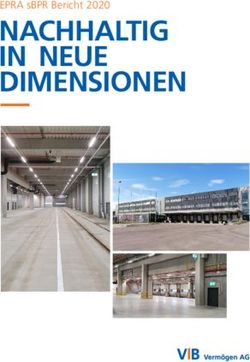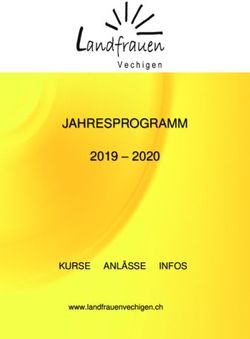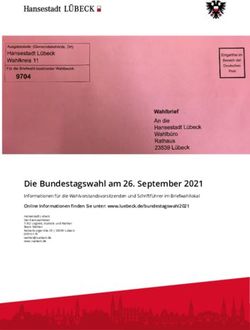Themenkatalog HS21 Seminar- und Abschlussarbeiten - ETH Zürich
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Themenkatalog HS21
Seminar- und Abschlussarbeiten
Departement Bau, Umwelt und Geomatik
Institut für Raum- und Landschaftsentwicklung
ETH Zürich
HIL H 51.1
Stefano-Franscini-Platz 5
8093 Zürich
https://irl.ethz.ch/de/research/stl.html
Stand: Juli 2021
STL
Spatial
Transformation
LaboratoriesThemenliste STL HS21
Der aktuelle Themenkatalog ist unter folgender Adresse abrufbar:
https://irl.ethz.ch/de/education/vorlesungen/master_thesis.html
Auf den folgenden Seiten und in der untenstehenden Wortwolke sind mögliche Fra-
gestellungen für studentische Arbeiten aufgeführt. Sie enthalten bewusst keine fertig
ausformulierten Aufgabenstellungen, da diese als elementare Bestandteile der Arbeit
eigenständig durch die Studierenden zu schärfen sind. Der Themenkatalog ist somit
lediglich ein Impulsgeber. Neue Themen können jederzeit vorgeschlagen werden: Vor-
aussetzung ist die Behandlung raumbedeutsamer Konflikte bzw. Probleme. Wir freuen
uns auf viele spannende Arbeiten mit euch!
STL
Spatial
Transformation
2
LaboratoriesThemenliste STL HS21
Fachbereich Spatial Transformation Laboratories STL – Focus Design
Dr. Markus Nollert
Leitung
nollertm@ethz.ch
Giovanni Di Carlo
Betreuung
gdicarlo@ethz.ch
Vorläufiger Titel der Arbeit Rückzonung überdimensionierter Bauzonen
Typ MSc, BSc, Seminar (nach Absprache)
Das revidierte eidgenössische Raumplanungsgesetz (RPG) ist vom Bundesrat am 1.
Beschreibung
Mai 2014 in Kraft gesetzt worden. Es zielt auf einen Stopp der Zersiedelung und einen
haushälterischen Umgang mit dem Boden ab: Dörfer und Städte müssen u.a. die
Bauzonen reduzieren, die sie nicht für das Wachstum der nächsten 15 Jahre benötigen.
Die Kantone haben diese Bundesvorgabe in ihren kantonalen Richtplänen bereits
übernommen und in vielen Fällen kantonale Rückzonungsstrategien erarbeitet. Die
Umsetzung der Rückzonungen steht auf der kommunalen Ebene noch aus und wird
die betroffenen Gemeinden in den nächsten Jahren vor grossen Herausforderungen
stellen.
› Welche Kantone weisen überdimensionierte Bauzonen auf?
› Welche Rückzonungsstrategien wenden die Kantone an und wie unterscheidet sich
die Bauzonendimensionierung?
› Wie viele Gemeinden sind schweizweit von den Rückzonungen betroffen?
› In welchem Umfang müssen Bauzonen rückgezont werden und welches Ausmass
ist tatsächlich umsetzbar?
› Welche Herausforderungen sind mit den Rückzonungen verbunden und wie können
Gemeinde damit umgehen?
Besonderes (Bemerkungen -
zur Gruppenarbeit u.ä.)
Gruppenarbeit nein
Anzahl Personen pro Gruppe
Total Anzahl Personen für Thema
STL
Spatial
Transformation
3
LaboratoriesThemenliste STL HS21
Fachbereich Spatial Transformation Laboratories STL – Focus Design
Dr. Markus Nollert
Leitung
nollertm@ethz.ch
Giovanni Di Carlo
Betreuung
gdicarlo@ethz.ch
Vorläufiger Titel der Arbeit Von der Gemeindeversammlung zum Gemeindeparlament: Auswirkungen auf die
Raumplanung
Typ MSc, BSc, Seminar (nach Absprache)
Beschreibung In der Deutschschweiz kommen in der überwiegenden Mehrheit der Gemeinden die
Gemeindeversammlungen vor. Diese diskutiert und entscheidet u.a. über die Ortspla-
nung, Bauvorhaben und über Verkehrsmassnahmen.
U.a. aufgrund von tiefen Stimmbeteiligungen, untervertretenen Bevölkerungsgruppen
oder der stärkeren Gewichtung von Partikularinteressen an Gemeindeversammlungen
entscheiden sich insbesondere grössere Gemeinden (>10‘000 Einwohner) für ein
Systemwechsel zum Gemeinde- bzw. Stadtparlament mit Urnenabstimmung.
In der französischen und italienischen Schweiz besitzen hingegen (je nach Kanton)
bereits Kleinstgemeinden ein Parlament. Die regionalen Unterschiede fallen somit
gross aus.
› Aus welchem Gründen entscheiden sich Gemeinden oder Städte zu einem System-
wechsel in der Leglisative?
› Welche Erfahrungen haben Gemeinden gesammelt, die diesen Wechsel (in beide
Richtungen) vollzogen haben?
› Welches System ist besser geeignet, um die Bevölkerung zu repräsentieren? Wel-
ches hat eine höhere Stimmbeteiligung?
› Was ist der Einfluss auf die Raumplanung- wie werden Vorhaben diskutiert, Ortspla-
nungen revidiert und Budgets beschlossen? Gibt es Unterschiede in der Akzeptanz?
› Weshalb bestehen zwischen der deutschen und der lateinischen Schweiz grosse
Unterschiede?
Besonderes (Bemerkungen -
zur Gruppenarbeit u.ä.)
Gruppenarbeit nein
Anzahl Personen pro Gruppe
Total Anzahl Personen für Thema
STL
Spatial
Transformation
4
LaboratoriesThemenliste STL HS21
Fachbereich Spatial Transformation Laboratories STL – Focus Design
Dr. Markus Nollert
Leitung
nollertm@ethz.ch
Marianne Gatti
Betreuung
mgatti@ethz.ch
Vorläufiger Titel der Arbeit Die Zukunft des «Traums vom Eigenheim»
Typ MSc, BSc, Seminar (nach Absprache)
Beschreibung Von den rund 1.7 Millionen Gebäuden mit Wohnnutzung in der Schweiz sind 57% Ein-
familienhäuser (EFH)1. Erhebungen des Immobilienmarktplatzes Homegate2 zeigen,
dass die Insertionszeit von EFHs im Zeitraum von 2015 bis 2020 stetig gesunken
ist. Im gleichen Zeitraum nahm das Angebot, mit Ausnahme im Jahr 2019, zu. Auch
das Coronajahr hat an der anhaltenden Nachfrage nach EFHs im Raum Zürich nur
wenig geändert, während in peripheren Lagen ein Rückgang festzustellen ist3. Hier
stehen mehrere Sachverhalte im Gegensatz zueinander. Einerseits wird das EFH
aufgrund steigender Preise zunehmend unerschwinglich. Gleichzeitig machen tiefe
Hypothekarzinsen und die Unattraktivität des Sparens Immobilien zu einer sicheren
und nachgefragten Geldanlage.
Obwohl das Schweizer Volk 2013 das revidierte Raumplanungsgesetz und damit das
Gebot zur Innenentwicklung deutlich angenommen hat, scheint der Traum vom Eigen-
heim weiter zu bestehen und die Mehrheit der SchweizerInnen in einem eigenen Haus
im Grünen leben zu wollen. Dieser Traum muss aber aufgrund der raumplanerischen
und finanziellen Rahmenbedingungen zusehends ein Traum bleiben. Im Rahmen der
Arbeit soll untersucht werden, welche Wünsche, aber auch Anforderungen heute
und in Zukunft an das EFH bestehen und inwiefern andere Wohntypologien diesen
Anforderungen alternativ nachkommen können.
Mögliche Fragen zur Bearbeitung des Themas sind:
› Wie sieht der EFH-Bestands aus und wie die prognostizierte Entwicklung?
› Welche räumliche Auswirkungen hat das EFH auf die Schweizer (Stadt-)Landschaft
(Zersiedlung, Infrastrukturkosten, Pendlerverkehr etc.)?
› Welche Beweggründe und Anreizsysteme für den Kauf eines Einfamilienhauses
bestehen und welche Alternativen könnten gesetzt werden?
› Woher stammt der «Traum vom Eigenheim» und welche Qualitäten treiben ihn an?
1
BfS (2018): Bau- und Wohnungswesen. › Welche alternativen Wohntypologien könnten die am EFH geschätzten Qualitäten
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/
statistiken/bau-wohnungswesen.assetde- ebenfalls erfüllen und gleichzeitig erschwinglicher und nachhaltiger sein?
tail.12507412.html (Zugriff: 26.05.20) › Wie kann die Raumplanung Einfluss nehmen?
2
Online Home Market Analysis (OHMA) (2020).
https://presse.homegate.ch/de/2020/05/07/
online-home-market-analysis-einfamilienha- Basisliteratur:
euser-verkauften-sich-2019-so-schnell-wie-
noch-nie-kuenftig-duerfte-es-wieder-laen- › Hartmann, S. (2020): (K)ein Idyll – Das Einfamilienhaus. Zürich: Triest Verlag
ger-dauern/ (Zugriff: 21.06.21)
3
Homegate: Einfamilienhäuser im Corona- › Moser, W.; Reicher, D.; Rosegger, R.; de Frantz, M.; Havel, M. (2002): Was ist so schön
Jahr (2021) https://presse.homegate.ch/ am Eigenheim Ein Lebensstilkonzept des Wohnens. Wien.
de/2021/05/04/einfamilienhaeuser-im-corona-
jahr-starke-regionale-unterschiede-bei-den- › Kaschuba, W. (2007): Das Einfamilienhaus: Zwischen Traum und Trauma? In: archi-
insertionszeiten/ (Zugriff: 21.06.21) these. http:// www.kaschuba.com/texte/Einfamilienhaus.pdf (Zugriff: 04.05.2021).
Besonderes (Bemerkungen -
zur Gruppenarbeit u.ä.)
Gruppenarbeit nein
Anzahl Personen pro Gruppe
Total Anzahl Personen für Thema
STL
Spatial
Transformation
5
LaboratoriesThemenliste STL HS21
Fachbereich Spatial Transformation Laboratories STL – Focus Design
Dr. Markus Nollert
Leitung
nollertm@ethz.ch
Dr. Roman Streit
Betreuung
rstreit@ethz.ch
Vorläufiger Titel der Arbeit Schwellenwerte von Infrastrukturen
Typ MSc, BSc, Seminar (nach Absprache)
Die Qualität von Siedlungsgebieten ist entscheidend von ihrer Versorgung mit Ver-
Beschreibung
kehrs-, Dienstleistungs-, Freiraum-, Bildungs- und Kultureinrichtungen abängig. Diese
Versorgung ist wiederum auf eine bestimmte Nachfrage innerhalb ihres räumlichen
Einzugsgebiets angewiesen, um ökonomisch funktionieren zu können. In dieser Arbeit
soll einerseits grundsätzlich der Frage nachgegangen werden, von welchen Faktoren
eine entsprechende Versorgungsqualität abhängig ist. Dabei soll insbesondere der
Faktor der Raumnutzendendichte genauer untersucht werden:
› Welche Dichte an Nutzenden (Bewohnerinnen und Beschäftigte) ist notwendig, da-
mit spezifische Versorgungsqualitäten mit oben genannten Infrastrukturen erzielt
werden können? (Schwellenwerte für funktionierende Versorgungsinfrastrukturen)
› Welche sonstigen Faktoren können für die Versorgungsqualität eine Rolle spielen?
› Welche Rolle kommt hierbei der Raumplanung als Steuerungsinstrument räumli-
cher Entwicklungen zu? (z.B. Zieldichten in Entwicklungsstrategien, Nutzungsvor-
gaben und -mischung in Planungsinstrumenten etc.)
In der Arbeit sollen in einem ersten Schritt anhand vorhandener Literatur eine theore-
tische Grundlage zu bestehenden Erkenntnissen hinsichtlich Beeinflussungsfaktoren
für die Versorgungsqualität geschaffen und, wo möglich, auch quantitative Schwel-
lenwerte (bzw. -spannweiten) für spezifische Versorgungsinfrastrukturen dargelegt
werden. In einem zweiten Schritt soll anhand geeigneter Gebiete empirisch geprüft
werden, in welchem Umfang die beobachtete Versorgungsdichte mit der theoretisch
erwartbaren Dichte aufgrund der massgebenden Beeinflussungsfaktoren überein-
stimmt. Besonders interessante Gebiete (z.B. solche mit einer grossen Übereinstim-
mung sowie solche mit grossen Abweichungen zwischen theoretischer Erwartung
und empirischer Überprüfung) sollen in einem dritten Schritt vertieft geprüft werden:
Welche Rolle spielen raumplanerische Vorgaben in diesen Beispielen? Welche Ansätze
gibt es zur Erklärung der abweichenden Beobachtungen?
Besonderes (Bemerkungen -
zur Gruppenarbeit u.ä.)
Gruppenarbeit nein
Anzahl Personen pro Gruppe
Total Anzahl Personen für Thema
STL
Spatial
Transformation
6
LaboratoriesThemenliste STL HS21
Fachbereich Spatial Transformation Laboratories STL – Focus Design
Dr. Markus Nollert
Leitung
nollertm@ethz.ch
Dr. Roman Streit
Betreuung
rstreit@ethz.ch
Bodenpolitische Massnahmen zur Beeinflussung des Wohnungsmarktes – eine
Vorläufiger Titel der Arbeit
vergleichende Studie
Typ MSc, BSc, Seminar (nach Absprache)
Beschreibung Verschiedene Städte versuchen auf unterschiedliche Weise, die Wohnraumversorgung
durch bodenpolitische Massnahmen zu beeinflussen. Möglichkeiten hierzu umfassen
eine aktive Bodenpolitik (Flächenbevorratung und -vergabe durch öffentliche Hand)
oder die Einforderung von Gegenleistungen von Seiten der Bauherrschaften durch
die öffentliche Hand für die Gewährung planungsrechtlicher Mehrwerte (z.B. über
Vorgaben zu Höhe und Verwendungszweck des Mehrwertausgleichs bei Ein-, Auf- und
Umzonungen, Besteuerung der Wertsteigerung des Bodens, städtebauliche Verträge
etc.).
In dieser Arbeit soll anhand geeigneter Beispielstädten (international) eine systema-
tische Übersicht zu entsprechenden Praktiken geschaffen werden:
› Auf welche Weise und in welchem Umfang betreiben die Behörden eine aktive
Bodenpolitik (Organisation und Zuständigkeiten für den Kauf und die Vergabe von
öffentlichen Flächen, finanzieller Umfang und räumlicher Anwendungsbereich die-
ser Massnahmen, Verknüpfung mit politischen Zielen, Kompetenzen der Behörden
zum Landerwerbe etc.)?
› Welche Möglichkeiten zur Qualitätssicherung sind mit der aktiven Bodenpolitik
durch die öffentliche Hand vorhanden und wie wirksam sind diese?
› Auf welche Weise und in welchem Umfang geschieht ein Ausgleich der durch pla-
nerische Massnahmen wie Ein-, Auf- und Umzonungen entstehenden Mehrwerte?
Zu welchem Zweck werden die Einnahmen aus dem Mehrwertausgleich von Seiten
der öffentlichen Hand wiederum eingesetzt? Wie wirksam wird diese Massnahme
eingeschätzt in Bezug auf die Wohnraumversorgung?
Die Arbeit besteht aus einer komparativen Studie verschiedener Städte. Dazu sind
u.a. folgende Schritte notwendig:
› Begründete Auswahl von Vergleichsstädten aufgrund der Literaturrecherche bzw.
geeigneten Indikatoren
› Systematischer Vergleich der Städte zu obengenannten Fragen, bspw. mittels
Literaturrecherche, ExpertInneninterviews, räumliche Erkundungen und Aus-
wertungen (z.B. Vergleich der räumliche Verteilung von Flächen im städtischen
Eigentum in den verschiedenen Untersuchungsstädten, Vergleich der gesetzlichen
Grundlagen der Bodenpolitik etc.)
Besonderes (Bemerkungen -
zur Gruppenarbeit u.ä.)
Gruppenarbeit nein
Anzahl Personen pro Gruppe
Total Anzahl Personen für Thema
STL
Spatial
Transformation
7
LaboratoriesThemenliste STL HS21
Fachbereich Spatial Transformation Laboratories STL – Focus Design
Dr. Markus Nollert
Leitung
nollertm@ethz.ch
Dr. Roman Streit
Betreuung
rstreit@ethz.ch
Vorläufiger Titel der Arbeit Vorgaben und Anreizsysteme der Wohnbauförderung in der Schweiz
Typ MSc, BSc, Seminar (nach Absprache)
Beschreibung Die Wohnbauförderung durch den Bund ist der Schweiz im Wohnraumförderungs-
gesetz sowie in der dazugehörigen Wohnraumförderungsverordnung geregelt. Die
gesetzlichen Grundlagen sehen vor, dass der Bau, die Erneuerung und der Erwerb
preisgünstigen Wohnraums sowie die Tätigkeit von Organisationen des gemeinnützi-
gen Wohnungsbaus durch den Bund gefördert werden. Dabei gelten unterschiedliche
Vorgaben zur Unterstützung des haushälterischen Umgangs mit der Ressource Boden,
einer guten baulichen Qualität sowie der Preisgünstigkeit und Nutzbarkeit der geför-
derten Wohnungen. Einzelne Aspekte der Förderung sind dabei als Anreizsysteme
ausgestaltet, so etwa die Darlehensbeträge pro Wohnung, welche je nach erzielten
Standards für energieeffizientes und hindernisfreies Wohnen in ihrer Höhe abgestuft
sind. Gleichzeitig fehlt eine systematische Übersicht zu der Wirksamkeit dieser Vorga-
ben im Hinblick auf die anvisierten Ziele. Ausserdem stellt sich die Frage, ob für eine
zukunftsgerichtete Wohnraumförderung im Sinne der nachhaltigen Raumentwicklung
noch weitere Vorgaben bzw. Anreizsysteme zielführend wären.
In dieser Arbeit soll das bestehende Wohnraumförderungssystem in der Schweiz in
einem ersten Schritt systematisch untersucht werden:
› Welche Vorgaben und Anreize sind im heutigen System vorhanden? Wie gross ist
der finanzielle Umfang dieser Förderung?
› Wie kann das Schweizer Wohnbauförderungssystem im Vergleich zu anderen
europäischen Ländern eingeordnet werden?
› Wie wird die Wirksamkeit des Schweizer Wohnbauförderungssystems im Hinblick
auf die Ziele einer nachhaltigen Raumentwicklung (Wohnflächeninanspruchnahme,
Energie, Klima, soziale Durchmischung etc.) eingeschätzt?
› Welche Ansatzpunkte zur Weiterentwicklung des Schweizer Wohnbauförderungs-
systems sind geeignet, um die genannten Ziele bestmöglich in ein künftiges adap-
tiertes System zu integrieren? Dabei sind auch Möglichkeiten zur Förderung eines
langfristigen und möglichst selbständigen Wachstums der geförderten Bauträger-
schaften zu berücksichtigen (Wachstumsanreize, z.B. hinsichtlich Organisations-
und Finanzierungsmodellen der geförderten Bauträgerschaften)
STL
Spatial
Transformation
8
LaboratoriesThemenliste STL HS21
Zur Bearbeitung der Fragestellung sind unterschiedliche Methoden möglich. Die
Schaffung einer Übersicht zu bestehenden Elementen der Wohnbauförderung sowie
internationalen Vergleichsbeispielen kann bspw. durch Literaturrecherchen sowie
Interviews mit ausgewählten ExpertInnen angegangen werden.
Die Prüfung Wirksamkeit der Massnahmen hinsichtlich der anvisierten Ziele kann
einerseits mittels ausgewählter statistischer Auswertungen (kriterienbasierte Eva-
luation), andererseits aber auch durch weitere Methoden wie Interviews, Umfragen
o.Ä. geschehen.
Die Erkundung konkreter Vorschläge für die Weiterentwicklung der Wohnbauförde-
rung kann bspw. durch die Erarbeitung konkreter Möglichkeiten zur Anpassung der
gesetzlichen Grundlagen und deren Validierung durch ExpertInnen oder die Schaffung
von räumlichen Testentwürfen, welche mögliche Wirkungen der weiterentwickelten
Vorgaben und Anreize verdeutlichen sollen, umgesetzt werden.
Besonderes (Bemerkungen In Kollaboration mit Prof. Dr. David Kaufmann vom SPUR
zur Gruppenarbeit u.ä.)
Gruppenarbeit nein
Anzahl Personen pro Gruppe
Total Anzahl Personen für Thema
STL
Spatial
Transformation
9
LaboratoriesThemenliste STL HS21
Fachbereich Spatial Transformation Laboratories STL – Focus Design
Dr. Markus Nollert
Leitung
nollertm@ethz.ch
Giovanni Di Carlo
Betreuung
gdicarlo@ethz.ch
Vorläufiger Titel der Arbeit Die Rolle der Raumplanung in der Kreislaufwirtschaft
Typ MSc, BSc, Seminar (nach Absprache)
Beschreibung Der Verbrauch natürlicher Ressourcen trägt zu ihrer Verknappung bei und ist mit
erheblichen Mengen an Abfall verbunden. Insbesondere die Linearwirtschaft ist auf-
grund ihrer einseitigen Ausrichtung auf Konsum und einmalige Nutzung von Gütern
wenig nachhaltig: Rohstoffe werden nach kurzer Nutzungsdauer deponiert oder
verbrannt, nur ein geringer Teil wird wiederverwertet.
Ihr gegenüber steht die Kreislaufwirtschaft, bei der die Abfallproduktion und die Er-
zeugung von Emissionen durch das Schliessen von Materialkreisläufen möglichst
minimiert werden. Rohstoffe werden möglichst lange im Kreislauf gehalten, dies
erfolgt u.a. durch Wiederverwendung, Recycling oder Instandsetzung. Die Kreislauf-
wirtschaft ist für eine nachhaltige Raumentwicklung sowie das Erreichen von Klima-
und Energiezielen daher von grosser Bedeutung.
In der Arbeit soll untersucht werden, welchen Beitrag die Raumplanung zur Kreislauf-
wirtschaft beitragen kann und welche Chancen und Risiken damit verbunden sind.
Weiterführende Literatur:
Die Stadt als Mine / „urban mining“:
https://gewerbe-basel.ch/themen/umwelt-energie/kreislauf/
kreislaufwirtschaft-im-baubereich-die-stadt-als-mine/
Besonderes (Bemerkungen -
zur Gruppenarbeit u.ä.)
Gruppenarbeit nein
Anzahl Personen pro Gruppe
Total Anzahl Personen für Thema
STL
Spatial
Transformation
10
LaboratoriesThemenliste STL HS21
Fachbereich Spatial Transformation Laboratories STL – Focus Design
Dr. Markus Nollert
Leitung
nollertm@ethz.ch
Marianne Gatti
Betreuung
mgatti@ethz.ch
Vorläufiger Titel der Arbeit Innenentwicklung in Ländern Europas*
Typ MSc, Seminar (nach Absprache)
Beschreibung Die Zersiedelung der Landschaft durch Jahrzehnte der uneingeschränkten Sied-
lungsentwicklung ist nicht nur ein Thema in der Schweiz. Auch in anderen Ländern
Europas ist der Umgang mit der Ausbreitung des Siedlungsteppichs und der MIV-
orientierten Siedlungsentwicklung zu einem zentralen Aspekt der Raumentwick-
lung geworden. Egal ob die Thematik durch Begriffe wie «compact cities», «Stadt
der kurzen Wege», «Verdichtung nach Innen» oder «dreifacher Innenentwicklung»
angenähert wird, teilen doch alle ein ähnliches Prinzip, nämlich die Verdichtung
und Transformation bestehender Siedlungsgebiete.
In dieser Arbeit soll ein Blick über die Schweizer Landesgrenzen geworfen werden,
um einen Überblick über den Stand und den Diskurs der Innenentwicklung in einem
anderen europäischen Land zu erarbeiten und die Innenentwicklung in der Schweiz
in einem internationalen Kontext zu beleuchten und kritisch einbetten zu können.
Mögliche Fragen zur Bearbeitung des Themas sind:
› Welche Begrifflichkeiten werden im Betrachtungsland für „Zersiedelung“ und „In-
nenentwicklung“ verwendet?
› Wie präsent ist der Diskurs in politischen Debatten? Wie präsent ist der Diskurs im
akademischen Rahmen? Inwiefern gleichen, respektive unterscheiden sich diese
Debatten?
› Welche Instrumente stehen seit wann zur Umsetzung der Innenentwicklung zur
Verfügung?
› Welche Instrumente hemmen oder durchkreuzen die Bemühungen um eine Sied-
lungsentwicklung nach Innen?
› Wie erfolgreich sind diese Instrumente in der Umsetzung?
› Gibt es (gute) Beispiele von Projektumsetzungen (architektonisch/städte-
baulich) oder der Implementierung von Instrumenten (formelle/informelle
Planungsinstrumente)?
› Kann die Schweizer Raumplanung von ausländischen Instrumenten oder Projekten
lernen? Welche Instrumente aus dem Ausland könnten auch in der Schweiz Um-
setzung finden? Welche Instrumente in der Schweiz haben modellhaften Charakter
für Situationen im Ausland?
Besonderes (Bemerkungen *Länder Europas: Für die Wahl des Landes oder der Länder muss die Studentin/der
zur Gruppenarbeit u.ä.) Student eine erste Einschätzung der Situation (Literatur, Landeskenntnisse, etc.) zum
ersten Gespräch mitbringen und aufzeigen wie sprachliche Barrieren überwunden
werden können, um die Arbeit selbstständig vornehmen zu können. Grundlegende
Kenntnisse des Planungssystems des Betrachtungslandes sind von Vorteil, aber nicht
erwartet.
Gruppenarbeit nein
Anzahl Personen pro Gruppe
Total Anzahl Personen für Thema
STL
Spatial
Transformation
11
LaboratoriesThemenliste STL HS21
Fachbereich Spatial Transformation Laboratories STL – Focus Design
Dr. Markus Nollert
Leitung
nollertm@ethz.ch
Marianne Gatti
Betreuung
mgatti@ethz.ch
Vorläufiger Titel der Arbeit Das Testplanungsverfahren – Ursprung und Anwendung in Ländern Europas
Typ MSc, Seminar (nach Absprache)
Das Testplanungsverfahren ist vor allem in der Schweiz, aber auch in Deutschland
als qualitätssichernder Prozess etabliert. Dabei arbeiten typischerweise drei bis vier
Beschreibung
interdisziplinäre Planungsteams an einer Aufgabe. Diese ist aber nur grob umrissen,
denn Ziel des Verfahrens ist die gemeinsame Diskussion und Auslotung möglicher
planersicher Entwicklungsrichtungen. Im Rahmen dieser Arbeit soll investigativ der
Ursprung und die Verbreitung des Testplanungsverfahrens in Europa erforscht und
reflektiert werden.
Mögliche Fragen zur Bearbeitung des Themas sind:
› Wo wurde das TP-Verfahren zum ersten Mal angewendet und in welchem Kontext?
› Wer war an der Erarbeitung und Einführung des Verfahrens beteiligt?
› Welche Umstände haben zum Einsatz des Verfahrens geführt?
› Wie ist der Wissenstransfer national und international vonstattengegangen?
› In welchen Ländern sind TP-Verfahren oder ähnliche Verfahren zu finden und wie
werden diese Verfahren bezeichnet?
› Wie funktionieren diese Verfahren und welche Ähnlichkeiten und Unterschiede
lassen sich zwischen ihnen feststellen?
› Welchen Stellenwert nehmen diese Verfahren im gesamten Planungsprozess ein?
› Was kann die Schweiz von diesen Verfahren im Ausland lernen, was können andere
Verfahren vom Schweizer TP-Verfahren lernen?
› Wie sieht ein TP-Verfahren normalerweise in der Schweiz aus? Inwiefern unter-
scheiden sich diese Verfahren innerhalb der Schweiz?
Basisliteratur:
› Papmichail, T., Peric, A. (2018): Informal democracy in Patras, Greece: A mechanism
for improved planning? Cities, 74.
› Mishra, A. (2018): The Process of informal spatial planning: a literature overview.
Baltic Journal of Real Estate Economics and Construction Management, Vol. 7/1.
› Scholl, B. (2013): Testplanung - Methode mit Zukunft. ARE Solothurn.
Das STL forscht zur Zeit zu Erfolgsfaktoren und Stolpersteinen in Schweizer TP-
Verfahren und erarbeitet eine Übersicht über die unterschiedlichen Arten von TP-
Verfahren in der Schweiz. Dadurch können weitere bereits aufgearbeitete Informa-
tionen bezogen werden. Die Integration des Studierenden in die Erarbeitung einer
zusätzlichen Publikation kann diskutiert werden.
Besonderes (Bemerkungen *Länder Europas: Für die Wahl der Länder muss die Studentin/der Student eine erste
zur Gruppenarbeit u.ä.) Einschätzung der Situation (Literatur, Landeskenntnisse, etc.) zum ersten Gespräch
mitbringen und aufzeigen wie sprachliche Barrieren überwunden werden können,
um die Arbeit selbstständig vornehmen zu können. Grundlegende Kenntnisse des
Planungssystems des Betrachtungslandes sind von Vorteil, aber nicht erwartet.
Gruppenarbeit nein
Anzahl Personen pro Gruppe
Total Anzahl Personen für Thema
STL
Spatial
Transformation
12
LaboratoriesThemenliste STL HS21
Fachbereich Spatial Transformation Laboratories STL – Focus Design
Dr. Markus Nollert
Leitung
nollertm@ethz.ch
Marianne Gatti
Betreuung
mgatti@ethz.ch
Vorläufiger Titel der Arbeit Der rechtsrheinische Korridor in Köln - Exempel einer neuen Form von Stadt?
Typ MSc, Seminar (nach Absprache)
Der Rechtsrheinische Korridor (RRK) ist Teil der Stadt Köln auf der rechten Seite des
Beschreibung
Rheins. Das rechtsrheinische Köln unterscheidet sich fundamental von der links-
rheinischen Seite. Während der linksrheinische Raum eine klassisch gewachsene
ringförmige Struktur aufweist mit einem radialen Strassensystem, ist der linksrhei-
nische Raum sehr heterogen mit grossen homogenen Nutzungsschollen und keiner
erkennbaren Struktur. Der RRK ist verkehrstechnisch von vielen Infrastrukturen
durchschnitten und siedlungstechnisch in sehr kurzer Zeit seit Ende des Zweiten
Weltkrieges gebaut worden. Im Rahmen dieser Arbeit soll erforscht werden, inwie-
fern der RRK ein Paradebeispiel für einen bisher übergangenen Siedlungstyp ist und
Handlungsmöglichkeiten aufgezeigt werden, wie mit diesem Raum raumplanerisch
und stadträumlich in Zukunft umgegangen werden soll.
Mögliche Fragen zur Bearbeitung des Themas sind:
› Inwiefern ist dieser Raum ein sich wiederholender Siedlungstyp?
› Wo lassen sich solche Räume in Deutschland/der Schweiz finden?
› Was zeichnet diesen Siedlungstyp aus?
› Inwiefern unterscheidet sich dieser Siedlungstyp von der Idee der «Zwischenstadt»
(nach Thomas Sieverts) oder der «Edge city» (nach Joel Garreau)?
› Welche Entwicklungsmöglichkeiten gibt es für diesen Siedlungstypen, um einen
attraktiven und wertvollen und nachhaltigen Stadtraum zu werden?
› Können die gleichen Prinzipien der Transformation angewendet werden, wie dies
bei bekannten innerstädtischen Räumen der Fall ist?
Basisliteratur:
› Sieverts, T. (1997): Zwischenstadt. Zwischen Ort und Welt, Raum und Zeit, Stadt
und Land. Braunschweig: Vieweg,
› Sieverts, T.; Koch, M.; Stein, U.; Steinbusch, M. (2005): Zwischenstadt – inzwischen
Stadt? Entdecken, Begreifen, Verändern. Wuppertal: Müller und Busmann
Zeitgleich mit dieser Arbeit findet die Interdisziplinäre Projektarbeit (IPA) im HS21 im
rechtsrheinischen Korridor statt. Diese Arbeit kann aus den projektbezogenen Arbei-
ten Inspiration ziehen, diese aber auch aufgrund des vertieften wissenschaftlichen
Verständnis kritisch reflektieren.
Besonderes (Bemerkungen -
zur Gruppenarbeit u.ä.)
Gruppenarbeit nein
Anzahl Personen pro Gruppe
Total Anzahl Personen für Thema
STL
Spatial
Transformation
13
LaboratoriesThemenliste STL HS21
Fachbereich Spatial Transformation Laboratories STL – Focus Design
Dr. Markus Nollert
Leitung
nollertm@ethz.ch
Marianne Gatti
Betreuung
mgatti@ethz.ch
Vorläufiger Titel der Arbeit Szenarien für ...
Typ MSc, Seminar (nach Absprache)
Beschreibung Die Szenarienmethode bietet die Möglichkeit unsichere zukünftige Entwicklungen
denkbar und damit greifbarer und diskutierbar zu machen. Ziel der Methode ist es,
den Möglichkeitstrichter von zukünftigen Entwicklungen möglichst weit zu öffnen,
um Entwicklungen antrizipieren zu können und damit in Angesicht sich änderender
Verhältnisse handlungsbereit zu sein. Damit dürfen Szenarien radikalen Charakter
haben. Oberstes Primat ist, dass ein Szenario dabei plausibel bleibt. Wünschbar-
keit und Wahrscheinlichkeit sind hingegen explizit keine Kriterien. Ein Szenario
kann auch als Narration verstanden werden. Es ist durch seine erzähltechnische
Entwicklung von heute über einen Entwicklungspfad in die Zukunft immer an das
Heute geknüpft und ist somit keine realitätsfremde «Träumerei». Die zwei wichtigs-
ten Mittel der Szenarienmethode ist zum einen eine textlich verarbeitete Geschich-
te und zum anderen eine grafische Repräsentation.
Im Rahmen dieser Arbeit suchen sich die Studierenden ein planungsrelevantes
Thema aus, welches eine besonders unsichere zukünftige Entwicklungen mit
sich bringt oder einer radikal anderen Sichtweise bedarf. Mittels Geschichten und
dem grafischen Mittel der Collage sollen diese Szenarien textlich und grafisch
ausgelotet und aufgezeigt werden, um so ein besseres Verständnis über mögliche
zukünftige Entwicklungen zu erlangen.
Mögliche Themen zur Bearbeitung:
› Die Mobilitätswende und deren Einfluss auf unsere Strassenräume
› Das Raumkonzept Schweiz neu gedacht
› Arbeitswelten der Zukunft (Teilthema: Logistik und Güter)
› Energielandschaft Schweiz - was ist möglich?
Basisliteratur:
› Salewski C. (2012): Dutch New Worlds. Scenarios in Physical Planning and Design
in the Netherlands, 1970–2000. Rotterdam: 010 Pulishers.
› Hallding, K. (2014): Scenarios to envision urban futures in a changing world. In: H.
Palmer (Hrsg.): Access to Ressources. An Urban Agenda. Baunach: Spurbuchverlag.
Besonderes (Bemerkungen -
zur Gruppenarbeit u.ä.)
Gruppenarbeit nein
Anzahl Personen pro Gruppe
Total Anzahl Personen für Thema
STL
Spatial
Transformation
14
LaboratoriesSie können auch lesen