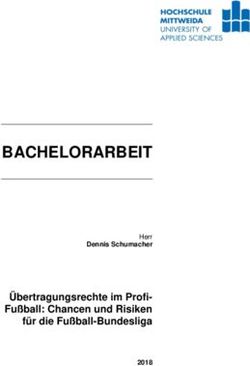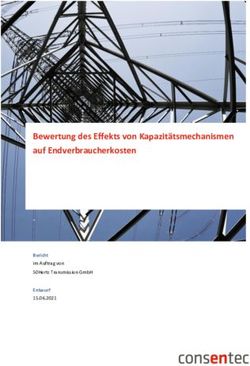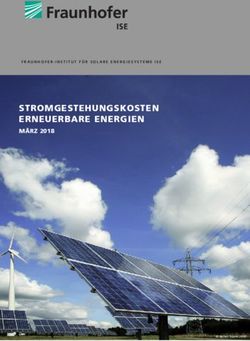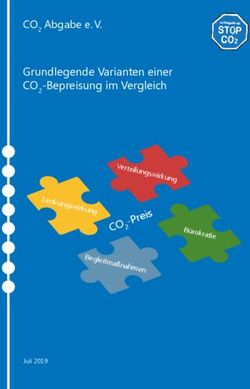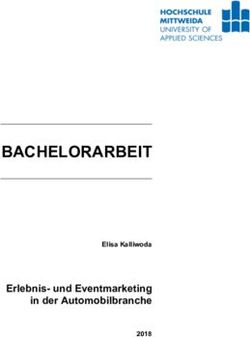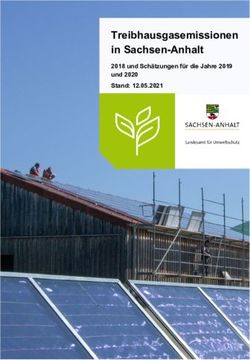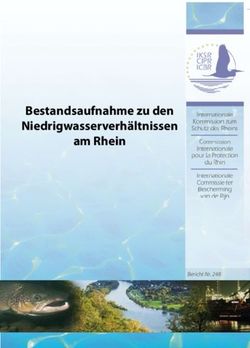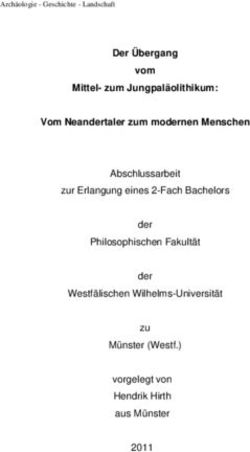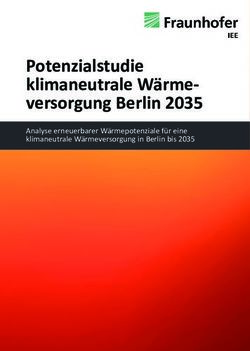Transnationale Vermarktung regionaler Lebensmittel am Beispiel von GlaMUR
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Transnationale Vermarktung regionaler Lebensmittel am
Beispiel von GlaMUR
Diplomarbeit
zur Erlangung des akademischen Grades eines Magisters der
Naturwissenschaften
an der Karl-Franzens-Universität Graz
vorgelegt von
Josef TSCHIGGERL
am Institut für Geographie und Raumforschung
Begutachter: Univ.-Prof. Dr. phil. Ulrich Ermann
Weinburg am Saßbach, 2021Ehrenwörtliche Erklärung
Ich erkläre ehrenwörtlich, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig und ohne
fremde Hilfe verfasst, andere als die angegebenen Quellen nicht benutzt und die den
Quellen wörtlich oder inhaltlich entnommenen Stellen als solche kenntlich gemacht
habe. Die Arbeit wurde bisher in gleicher oder ähnlicher Form keiner anderen
inländischen oder ausländischen Prüfungsbehörde vorgelegt und auch noch nicht
veröffentlicht. Die vorliegende Fassung entspricht der eingereichten elektronischen
Version.
Weinburg am Saßbach, 2021 ________________________
Unterschrift
1Vorwort und Danksagung
In meiner Zeit als Lehramtsstudent mit den Unterrichtsfächern Mathematik und
Geographie/Wirtschaftskunde war es mir möglich, einiges an Fachwissen zu erwerben. Ich wollte
meine Diplomarbeit unbedingt über ein realitätsnahes Thema schreiben. Nach längerem
Überlegen und mithilfe meines Diplomarbeitsbetreuers fand ich ein passendes Themengebiet,
welches für meine Heimatregion relevant ist. Der Verein GlaMUR ist mir schon länger bekannt,
da er regionale Produkte fördert und Veranstaltungen organisiert. Die Idee, den Begriff der
Regionalität über die Staatsgrenze hinweg zu definieren, weckte mein Interesse und ist das
Kernelement meiner Arbeit.
Ich möchte mich recht herzlich bei meiner Familie und meinen FreundInnen bedanken, die mich
immer wieder während meines gesamten Studiums unterstützten. Besondere Dank gilt meinem
Betreuer Univ.-Prof. Dr. phil. Ulrich Ermann für seinen Einsatz bei der Begleitung meiner
Diplomarbeit und allen InterviewpartnerInnen, die sich die Zeit nahmen, meine Fragen zu
beantworten.
2Zusammenfassung
Die Diplomarbeit befasst sich damit, dass der Begriff „Regionalität“ im Lebensmittelsektor nicht
an der Staatsgrenze enden muss. Untersuchungsregion ist dabei der Grenzraum zwischen
Steiermark und Slowenien. Der Verein GlaMUR versucht ein Bewusstsein bei der Bevölkerung zu
schaffen, dass ein slowenisches Produkt auch als regional anerkannt werden kann. Ziel dieser
Arbeit ist aufzuzeigen, welche Probleme dieses transnationale Verständnis von Regionalität beim
Vermarkten eines regionalen Nahrungsmittels mit sich bringt.
Im ersten Teil der Arbeit wird die theoretische Basis geschaffen. Verschiedene Aspekte eines
regionalen Lebensmittels werden erläutert und auf wichtige Ansätze bei der Vermarktung
eingegangen. Der zweite Teil beschäftigt sich speziell mit dem Fallbeispiel GlaMUR. Mithilfe von
Interviews wird der Verein analysiert. Eine Befragung in der Untersuchungsregion repräsentiert
dabei die Sicht der KonsumentInnen. Durch diese zwei Methoden können einige Problemfelder
aufgezeigt werden, die eine transnationale Vermarktung regionaler Lebensmittel mit sich bringt.
3Abstract
The thesis deals with the fact that the term “regionality” in the food sector does not have to end
at the state border. The region under investigation is the border area between Styria and Slovenia.
The GlaMUR association tries to create awareness among the population that a Slovenian product
can also be recognized as regional. The aim of this work is to show which problems this
transnational understanding of regionality brings with it when marketing regional food.
In the first part of the thesis, the theoretical basis is created. Various aspects of regional food are
explained and important approaches to marketing are discussed. The second part deals
specifically with the GlaMUR case study. The association is analyzed with the help of interviews.
A survey in the research region represents the consumer's point of view. With these two methods,
some problem areas can be identified that the transnational marketing of regional foods entails.
4Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung ............................................................................................................................................... 8
2. Regionalität ........................................................................................................................................... 9
2.1. Definition ....................................................................................................................................... 9
2.2. Regionale Lebensmittel ............................................................................................................... 10
2.2.1. Die vier Haupttypen von Regionsbildungen ........................................................................ 11
2.2.2. Lokale Lebensmittel............................................................................................................. 14
2.3. Herkunft und Moral des Essens................................................................................................... 15
2.4. Sehnsucht nach Regionalität ....................................................................................................... 16
2.5. Vorteile regionaler Lebensmittel................................................................................................. 17
3. Vermarktung regionaler Lebensmittel ................................................................................................ 19
3.1. Produkt branding......................................................................................................................... 20
3.2. Formen von regionalem Marketing............................................................................................. 21
3.3. Kooperationen ............................................................................................................................. 23
3.3.1. Voraussetzungen für das Zustandekommen einer Kooperation......................................... 24
3.3.2. Cummunity Supported Agriculture (CSA) ............................................................................ 24
4. Transnationale Zusammenarbeit innerhalb der EU ............................................................................ 26
5. Methodik ............................................................................................................................................. 28
5.1. Interviews .................................................................................................................................... 28
5.1.1. Interviewarten ..................................................................................................................... 29
5.1.2. Durchführung der Interviews .............................................................................................. 29
5.1.3. Auswertung der Interviews ................................................................................................. 30
5.2. Fragebogen .................................................................................................................................. 31
6. Untersuchungsregion .......................................................................................................................... 33
6.1. Mitgliedsgemeinden von GlaMUR .............................................................................................. 33
6.2. Unteres Murtal ............................................................................................................................ 35
6.3. Mitgliedsbetriebe ........................................................................................................................ 36
6.3.1. Die slowenische Region ....................................................................................................... 37
56.3.2. Die österreichische Region .................................................................................................. 38
7. GlaMUR - Genuss am Fluss .................................................................................................................. 39
7.1. Gründung des Vereins ................................................................................................................. 41
7.2. Ziele des Vereins.......................................................................................................................... 43
7.2.1. Zusammenarbeit ................................................................................................................. 43
7.2.2. Gastronomie und Hotellerie ................................................................................................ 43
7.2.3. Bewusstsein für regionale Produkte schaffen ..................................................................... 45
7.2.4. Tourismus und Landwirtschaft ............................................................................................ 46
7.2.5. Regionale Wirtschaftskreisläufe .......................................................................................... 48
7.2.6. Grenzenloses Denken .......................................................................................................... 50
7.3. Kooperationen des Vereins ......................................................................................................... 53
7.3.1. Vereinsveranstaltungen ...................................................................................................... 53
7.3.2. Einflüsse der Pandemie ....................................................................................................... 54
7.3.3. Regionaltheken.................................................................................................................... 55
8. Problemfelder...................................................................................................................................... 57
8.1. Preisunterschiede ........................................................................................................................ 57
8.2. Kaufverhalten der Bevölkerung ................................................................................................... 58
8.2.1. Allgemeine Informationen der befragten Personen ........................................................... 58
8.2.2. Der Begriff „Regionalität“ .................................................................................................... 59
8.2.3. Einkaufsszenarien ................................................................................................................ 61
8.3. Administrative Hindernisse ......................................................................................................... 64
8.4. Grenzenloses Denken .................................................................................................................. 65
9. Schlussfolgerung.................................................................................................................................. 67
Literaturverzeichnis ..................................................................................................................................... 69
Anhang ........................................................................................................................................................ 75
6Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Darstellung der Wirtschaftsverflechtungen in den vier Haupttypen von Regionsbildungen……………….…13
Abbildung 2: Formen der Regionalvermarktung………………………………………………………………………………………….…………..23
Abbildung 3: Landschaftsgliederung der Steiermark. Unteres Murtal rot markiert…………………………..……………………….36
Abbildung 4: Tätigkeitsregion von GlaMUR nach Mitgliedsbetrieben…………………………………………………….…………………37
Abbildung 5: Vereinslogo von GlaMUR……………………………………………………………………………………………….……………………40
Abbildung 6: Regionaltheken im Siebinger Hof (Gastronomiebetrieb)……………………………………………….…………………….56
Abbildung 7: Regionaltheken im Siebinger Hof (Gastronomiebetrieb)………………………………………………….………………….56
Abbildung 8: Häufigkeiten von Einkäufen regionaler Lebensmittel…………………………………………………….…………………….58
Abbildung 9: Altersgruppen der TeilnehmerInnen…………………………………………………………………………………………………..59
Abbildung 10: Assoziationen mit regionalen Lebensmitteln……………………………………………………………………………………..60
Abbildung 11: Bevorzugte Herkunftsregion frischer Tomaten………………………………………………………………………………….62
Abbildung 12: Bevorzugte Herkunftsregion frischer Tomaten………………………………………………………………………………….62
Abbildung 13: Bevorzugte Herkunftsregion eines Marillen Joghurts…………………………………………………………………………62
Abbildung 14: Bevorzugte Herkunftsregion eines Marillen Joghurts…………………………………………………………………………62
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1: Die zwei Typen von Regionalvermarktung………………………………………………………………………………………………19
Tabelle 2: Überblick über Interviewpartner und deren Funktion…………………………………………………………………………….30
Tabelle 3: Mitgliedsgemeinden von GlaMUR…………………………………………………………………………………………………………..34
71. Einleitung
In der Grenzregion zwischen Steiermark und Slowenien befinden sich viele Direktvermarkter. Die
Bevölkerung ist sich gar nicht bewusst, dass unzählige regionale Produkte in ihrer Nähe produziert
werden. Es ist irgendwie bedauerlich, dass die BewohnerInnen einer Region in den Supermarkt
gehen und Lebensmittel aus weiter Ferne kaufen, wenn doch auch die Möglichkeit besteht, sich
direkt vor Ort zu versorgen. Der Verein GlaMUR erkannte dieses Potential, das in dieser Region
steckt. Er möchte darauf aufmerksam machen und versucht das Regionalmarketing zu
unterstützen. Das Interessante dabei ist, dass der Verein auch auf slowenische Lebensmittel setzt.
VertreterInnen des Vereins sind nämlich der Meinung, dass in der Grenzregion ein slowenisches
Lebensmittel auch als regional bezeichnet werden sollte. Diese Denkweise hat durchaus seine
Berechtigung, wenn man bedenkt, dass beispielsweise die Stadtgemeinden Mureck und Bad
Radkersburg direkt an der slowenischen Grenze liegen.
Diese Ansicht teilt aber nicht die ganze Bevölkerung. Dadurch entstehen Konflikte. Es stellt sich
die Frage, ob ein regionales Lebensmittel überhaupt aus einem anderen Land kommen darf und
welche weiteren Schwierigkeiten mit diesem staatsübergreifenden Denken verbunden sind?
Dabei müssen zuerst einmal die Kriterien für ein regionales Lebensmittel festgelegt werden. Im
ersten Teil der Arbeit wird aus diesem Grund die theoretische Basis geschaffen. Der zweite Teil
gibt dann einen näheren Einblick in den Verein GlaMUR und gibt Aufschluss über die Sichtweise
der VertreterInnen. Die Perspektive der KonsumentInnen sollte dabei auch nicht ungeachtet
bleiben. Um an brauchbare Daten kommen zu können, werden zwei Forschungsmethoden
angewendet. Letztendlich soll eine Antwort auf folgende Forschungsfrage gefunden werden:
Welche Probleme sind damit verbunden, regionale Lebensmittel, transnational zu vermarkten
am Fallbeispiel GlaMUR?
Die Einstellung Lebensmittel über eine Nation als regional zu bewerten, macht GlaMUR zu einem
hervorragenden Fallbeispiel meine Problemstellung zu betrachten. Das letzte Kapitel der Arbeit
konzentriert sich darauf, die wichtigsten Erkenntnisse wiederzugeben und Antworten auf die
Forschungsfrage zu liefern.
82. Regionalität
Dieses Kapitel soll zur Erläuterung des Begriffes Regionalität dienen. Wörter wie „lokal“ und
regional“ sind den meisten LeserInnen wahrscheinlich geläufig, da sie im Alltag verwendet
werden. Autoren sind sich bei genaueren Definitionen jedoch oft uneinig.
2.1. Definition
Das Wort Region wird in der Öffentlichkeit, aber auch im wissenschaftlichen Bereich sehr vielseitig
verwendet. Nach Klement (2012, S. 64) wird dabei meist ein mittelgroßer zusammenhängender
Raum beschrieben. Dieser wird wegen seiner bestimmten Merkmale von einem anderen Gebiet
abgegrenzt. Regionen können auch administrativ in Form von Bundesländern oder Bezirken
abgegrenzt werden.
Eine meiner Meinung nach etwas bessere Definition entsteht, wenn der Begriff über zwei Aspekte
beleuchtet wird: Während sich die naturwissenschaftliche Betrachtung vor allem auf den Boden
und das Klima bezieht, priorisiert die sozialwissenschaftliche Betrachtung den geschichtlichen
Hintergrund des Gebietes (Wiesmann et al. 2015, S. 3). Eine Region kann somit als eine
Landschaft, welche von Mensch wahrgenommene Gemeinsamkeiten aufweist, oder auch als ein
Gebiet mit politischen, wirtschaftlichen oder kulturellen Besonderheiten verstanden werden
(Sauter und Meyer 2003, S. 25).
Nach Maier et al. (2012, S. 13) kann „Region“ für drei sehr unterschiedliche räumliche Gebiete
verwendet werden. Deshalb untergliederten sie den Begriff in drei Arten: subnationale,
supranationale und transnationale Gebiete. Subnationale Regionen sind Teilgebiete eines
Staates, wie beispielsweise das Waldviertel. Mittelamerika hingegen ist als eine
Zusammenfassung von mehreren Staaten als eine supranationale Region zu verstehen. Wenn
man den Begriff in der transnationalen Ebene betrachtet, könnte man die „Europaregion Tirol“,
als Beispiel anführen. Dabei versteht man ein Territorium, das sich über mehrere Staaten
erstreckt (Maier et al. 2012, S. 13).
92.2. Regionale Lebensmittel
Die unterschiedlichen Betrachtungsweisen machen eine einheitliche Erläuterung des Begriffes
„Region“ kaum möglich. Das Verständnis des Wortes hat aber großen Einfluss auf die regionale
Nahrungsmittelversorgung. So haben die ungenauen Definitionen unterschiedliche Methoden bei
der Produktion und Vermarktung regionaler Lebensmittel hervorgebracht (Sauter und Meyer
2003, S. 26). Pícha et al. (2018, S. 126) unterscheiden sogar zwischen lokalen, regionalen und
nationalen Lebensmitteln, welche Aufgrund ihrer Entfernung, die sie von der Produktion bis zum
Verbrauch zurücklegen, untergliedert werden.
Mit der Frage: „Kann man eine Region essen?“ beschäftigte sich Ermann (2005) in seinem Buch
„Regionalprodukte. Vernetzungen und Grenzziehungen bei der Regionalisierung von
Nahrungsmitteln“. Lebensmittelwerbungen, die aufgrund ihrer Regionalität vermarktet werden,
versuchen den Eindruck zu vermitteln, eine bestimmte Landschaft schmecken zu können (Ermann
2005, S. 11). Bio – Lebensmittel müssen bestimmte Produktrichtlinien erfüllen, um als solche
gekennzeichnet werden zu dürfen. Da der Begriff „Regionalität“ keiner genauen Definition
unterliegt, müssen Lebensmittel, die unter diesem Begriff verkauft werden, auch keine
bestimmten Kriterien erfüllen (Wiesmann et al. 2015, S. 3). Ein weiteres Problem entsteht, dass
bei den mehrmals zusammengesetzten Nahrungsmitteln heutzutage nicht nur die endgültige
Verarbeitung regional erfolgen sollte, sondern auch alle landwirtschaftlichen Vorprodukte aus der
Region stammen sollten. Somit ist eine strenge Regionalität bei den meisten Lebensmitteln gar
nicht möglich (Sauter und Meyer 2003, S. 26).
Bei regionalen Lebensmitteln geht es vor allem um Produkte, die in der Nähe des Verkaufsortes
erzeugt wurden. Der Begriff „Nähe“ kann aber auch hier als sehr vielschichtig verstanden werden.
Es ist möglich sich darunter eine Gemeinde, aber auch ein ganzes Bundesland vorzustellen
(Ermann 2015, S. 81). Dennoch sind es vielmehr die sozialen Gegebenheiten, die den Begriff
„Region“ prägen. Sie sind bereits im Vorhinein in diesem Gebiet verankert und charakterisieren
diesen Teil der Erde (Ermann 2005, S. 62).
Des Weiteren ist es durchaus hilfreich, die gebildeten Netzwerke in einer Region genau zu
untersuchen. Nach Ermann (2005) kann man Regionen zwischen objektivistischen und
10subjektivistischen, aber auch zwischen kollektivistischen und individualistischen Konstrukten
unterscheiden. Objektivistische Regionsbildungen orientieren sich an bestimmten
Distanzangaben, wohingegen es bei den subjektivistischen Regionsbildungen vor allem um die
Gemeinsamkeit und Vertrautheit in einem bestimmten Gebiet geht. Somit werden hier keine
klaren Grenzen gezogen. In einem kollektivistischen Konstrukt schließt die Region alle Akteure,
die sich in diesem Gebiet befinden, mit ein. Eine individualistisch kreierte Region setzt dabei eher
auf einzelne Menschen, Haushalte oder Betriebe (Ermann 2005, S. 62–63).
2.2.1. Die vier Haupttypen von Regionsbildungen
Mithilfe der oben genannten Differenzierung ist es nun möglich vier Haupttypen von
Regionsbildungen zu benennen, die für die Regionalität von Lebensmitteln entscheidend sind:
Kollektivistisch – objektivistische Regionen:
Dabei handelt es sich um klar definierte Teile der Erdoberfläche, die durch naturräumliche,
administrative oder historische Grenzen bestimmt sind. Gemeinden und Bezirke können als
solche Regionen bezeichnet werden.
Kollektivistisch – subjektivistische Regionen:
Falls in einer kollektivistisch – objektivistischen Region die BewohnerInnen ein gewisses
Zusammengehörigkeitsgefühl entwickelt haben, kann diese auch als kollektivistisch –
subjektivistisch gebildete Region betrachtet werden. Wenn eine Person von seiner/ihrer
Heimatregion spricht, verwendet er/sie den Begriff „Region“ unter diesem Aspekt. Das Problem
bei allen kollektivistischen Regionen ist allerdings, dass sich die internen Verflechtungen von
Menschen, Haushalten und Betrieben nicht an die vorgegebenen Grenzen halten. Ein am Rand
der Region befindlicher Betrieb, wird weder seinen Kunden-, noch seinen Lieferantenkreis
ausschließlich von der Region beziehen.
11 Individualistisch - objektivistische Regionen:
Bei den individualistischen Regionsbildungen hat man das oben genannte Randproblem einer
Region nicht, da sich die Region um einen bestimmten Akteur herum bildet. In einer
individualistisch – objektivistisch entwickelten Region wird genau dann ein Produkt als regional
anerkannt, wenn es in einem gewissen Umkreis um den Ort der Vermarktung produziert und
verarbeitet wurde. Dieser Regionstyp wird nicht durch politische Unterschiede oder anderen
Erschwernissen abgegrenzt und kann somit auch länderübergreifend auftreten.
Individualistisch – subjektivistische Regionen:
Die Entfernung wird hierbei nicht durch eine vorgegebene Distanz bestimmt, sondern bezieht sich
auf die Vertrautheit. Je unbekannter etwas ist, desto weiter ist es entfernt. Ein bekanntes Produkt
ist somit auch ein Produkt aus der Region (Ermann 2005, S. 62–64).
Abbildung 1 zeigt eine vereinfachte Darstellung der Wirtschaftsverflechtungen, die man in den
angeführten Arten von Regionsbildungen wiederfindet: Die Punkte stellen dabei diejenigen
Betriebe dar, welche das Lebensmittel im Vorhinein bearbeitet haben. Am Ende dieser
Produktionskette befindet sich der Vermarktungsort des Nahrungsmittels, welcher mit einem
schwarzen Quadrat gekennzeichnet ist. Im ersten System kann man eine deutliche Grenze der
Region erkennen. Das Produkt gelangt innerhalb dieser Abgrenzung von Betrieb zu Betrieb, bis es
schließlich zum Ort des Verkaufes gelangt. Lieferbeziehungen befinden sich dabei nicht immer
auf der kürzesten Strecke. Im zweiten Verflechtungsmuster kommt gerade der Aspekt der
kleinsten Distanz zum Vorschein. Das Produkt wandert in einem gewissen Radius von einem
Betrieb bis zum nächsten. In den subjektivistischen Regionsbildungen sind keine klaren Grenzen
erkennbar, wobei vor allem das vierte System die Ungebundenheit des Produkts an eine
bestimmte räumliche Distanz wiederspiegelt (Ermann 2005, 64-66).
12Abbildung 1: Darstellung der Wirtschaftsverflechtungen in den vier Haupttypen von Regionsbildungen
(Quelle: Ermann 2005, S. 65)
132.2.2. Lokale Lebensmittel
In der Literatur wird auch von „lokalen“ Lebensmitteln gesprochen. Ähnlich wie in der
individualistisch-objektivistischen Regionalität spielt hier die Entfernung eine Rolle, die das
Lebensmittel von der Herstellung bis zum Konsum zurücklegt. Im Vereinigten Königreich
beispielweise, müssen zertifizierte Bauernmärkte ihr Produkt innerhalb eines Radius von 30
Meilen herstellen, damit dieses als lokal gilt (Pearson et al. 2011, S. 887–888). Eine aus meiner
Sicht etwas gelungenere Definition wäre:
“local food is food produced and consumed by exploiting the raw material and production
inputs within the region, promoting the economic development and employment of this
particular area. This particular area may be a municipality, province, or economic area”
(Forsman und Paananen 2003, zitiert nach Pícha et al. 2018, S. 127–128)
Es stellt sich die Frage, wie man ein regionales Lebensmittel von einem lokalen Lebensmittel
unterscheiden kann? Ein regionales Produkt ist ein traditionelles Produkt, das in einem genau
definierten geographischen Gebiet erzeugt wurde. Ein lokales Produkt hingegen wird in der Nähe
des Konsumortes auch fabriziert (Pícha et al. 2018, S. 128). Nach dieser Definition müsste ich in
meiner Arbeit den Begriff „regional“ durch „lokal“ ersetzen, da GlaMUR - Genuss am Fluss (2020a,
S. 2–3) eindeutig hervorhebt:
„Wir erzeugen und vermarkten regionale Produkte – im GlaMURtal.“
„Wir wollen, dass in der Gastronomie und Hotellerie mehr regionale Produkte verarbeitet
werden.“
„Wir wollen, dass die Bevölkerung gezielt auf Produkte aus ihrer Heimatregion greifen.“
Es wird aber auch der Gedanke vertreten, dass regionale Produkte außerhalb der Region
vermarktet und somit konsumiert werden (GlaMUR - Genuss am Fluss 2020a, S. 2–3). Deshalb
sind meiner Meinung nach beide Begriffe zutreffend und werden aus diesem Grund in der Arbeit
auch als Synonyme behandelt.
142.3. Herkunft und Moral des Essens
Das Bundesministerium für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus schreibt auf ihrer
Homepage, dass es vielen ÖsterreicherInnen bedeutend ist, woher die Lebensmittel stammen.
KonsumentInnen greifen häufiger zu regionalen Lebensmitteln. Das Interesse über die Herkunft
und die Herstellung eines Nahrungsmittels nimmt zu.
Der moralische Aspekt der KonsumentInnen hinter einem regionalen Lebensmittel muss
berücksichtigt werden. Ein regional erzeugtes Nahrungsmittel ist nämlich ein „gutes
Nahrungsmittel“ und kann mit gutem Gewissen gekauft und konsumiert werden.
VerbraucherInnen verbinden mit einem regionalen Lebensmittel ein hohes qualitatives
Produktionsniveau und durch die kürzeren Transportwege auch einen behutsameren Umgang mit
der Natur (Ermann 2015, S. 77). Pícha et al. (2018, S. 129) schreiben, dass ein regionales
Lebensmittel wegen seiner kurzen Lieferketten weniger Energie verbraucht, weshalb es mit dem
Begriff „Nachhaltigkeit“ assoziiert wird. Die Herkunftsfrage ist somit keine reine „Wo-Frage“,
sondern auch eine „Wie-Frage“. (Ermann 2015, S. 77).
Für die VerbraucherInnen ist die regionale Herkunft vor allem bei Produkten wie Fleisch, Obst,
Gemüse und Milch von großer Bedeutung. Diese Produkte werden unter anderem auf
Bauernmärkten angeboten ( Wirthgen et al. 1999, zitiert nach Sauter und Meyer 2003, S. 27). Bei
diesen Frischeprodukten steht die regionale Herkunft für die kurze Distanz, die die Ware
zurückgelegt hat, und ist somit ein wichtiger Indikator für die Frische des Erzeugnisses. Je größer
der Verarbeitungsgrad des Produktes ist, desto unbedeutender wird die regionale Herkunft der
Ware (Czech et al. 2002, S. 16–17). Besonders KonsumentInnen aus den Städten zeigen Interesse
an der geographischen Herkunft der Ware und legen Wert auf die Rückverfolgbarkeit des
Produkts (Pícha et al. 2018, S. 129).
Food from Somewhere
Campbell (2009, S. 309) spricht von einem Umdenken von „Food from Nowhere“ zu „Food from
Somewhere“. Darunter kann die neue Denkweise vieler KonsumentInnen in Bezug auf die
15Herkunft eines Lebensmittels verstanden werden. Mit der Globalisierung und seit dem Beitritt
Österreichs zur EU ist ein erhöhtes Aufkommen an regionalen und nationalen Lebensmitteln zu
erkennen. VerbraucherInnen zeigen ein erhöhtes Interesse, die Herkunft eines Lebensmittels zu
lokalisieren (Schermer 2015, S. 121). Nach Pícha et al. (2018, S. 125) sehen KonsumentInnen
Nahrungsmittel, die von einem lokalen Produzenten hergestellt wurden, als
„[…] being of higher quality and better complying with their habits and requirements than
“regional” or “national” food products. […]” (Pícha et al. 2018, S. 125)
Daraus lässt sich entnehmen, dass der Erfolg eines lokalen Produktes wieder eine Frage des
Vertrauens ist. Der Begriff „lokal“ bedeutet hier eine viel nähere Beziehung zu den
HerstellerInnen und wird von den Autoren nicht mit dem „regional“ oder „national“ gleichgesetzt.
2.4. Sehnsucht nach Regionalität
Die Globalisierung hat viele kleine ProduzentInnen vom Markt verdrängt. Regionale
HerstellerInnen können die großen Lieferungsanforderungen von Einzelhandelsketten nicht
erfüllen und sind deshalb nicht wettbewerbsfähig (Pícha et al. 2018, S. 125). Ein weiteres Problem
beschreibt Ermann (2005):
„[…] Durch eine zunehmende Spezialisierung der Industriebetriebe und eine wachsende
Bedeutung von Markenprodukten lösten sich immer mehr regionale Absatzverflechtungen auf
und wurden durch überregionale bis internationale Distributionssysteme ersetzt. […]“ (Ermann
2005, S. 31).
VerbraucherInnen zeigen aber durchaus Interesse ihre Identitäten wiederzuerlangen und setzen
vermehrt auf lokale Kulturen und traditionelle Werte. Dies kann sich als eine Möglichkeit für
kleinere, regionale Hersteller darstellen, um ihre Produkte in der Region zu vermarkten (Pícha et
al. 2018, S. 125). Auch Pearson et al. (2011, S. 887) verweisen darauf, dass KonsumentInnen
wieder Interesse zeigen in, was sie essen, woher es kommt und wie es produziert wurde. Durch
die globalisierte Wirtschaft und die Vereinigung der Lebensmittelproduktion haben die
16VerbraucherInnen den Bezug zu ihrem Nahrungsmittel verloren und wünschen sich diesen zurück
(Pearson et al. 2011, S. 887).
2.5. Vorteile regionaler Lebensmittel
Für Einheimische gibt es einen besonderen Grund, ein regionales Lebensmittel zu kaufen. Anstatt
sich ein Lebensmittel aus einem fernen Land zuzulegen, haben sie die Möglichkeit mit ihrer
Anschaffung ihr regionales Lebensmittelnetzwerk zu fördern. Das hat sowohl einen ökologischen
(1), als auch sozialen (2), wirtschaftlichen (3) und gesundheitlichen (4) Nutzen (Pearson et al.
2011, S. 888).
Die ökologischen Vorteile (1) sind aber durchaus umstritten. Der verringerte Transportweg spart
zwar einiges an Energie, doch mehrere Lebenszyklusanalysen regionaler Produkte, beispielsweise
von Edwards-Jones et al. (2008, S. 265–272), haben ergeben, dass einige lokale Lebensmittel
mehr Emissionen bei Herstellung, Verarbeitung und Vermarktung erzeugen, als Lebensmittel, die
zwar weit entfernt, aber dafür in Massen produziert wurden. Der kürzere Lieferweg bringt jedoch
den ökologischen Vorteil mit sich, dass das Lebensmittel weniger Verpackung benötigt, um es
frisch zu halten (Pearson et al. 2011, S. 888).
Lokale Lebensmittelsysteme ziehen den sozialen Vorteil (2) des Vertrauens mit sich. Zwischen
ErzeugerInnen und VerbraucherInnen können Verbindungen entstehen, die zur Entstehung
lokaler Gemeinschaften beitragen. Durch diese fühlen sich viele KonsumentInnen wieder enger
mit ihrem Lebensmittel verbunden und können auch zu einer bewussteren Ernährung beitragen
(Pearson et al. 2011, S. 889).
LandwirtInnen haben die Möglichkeit einen höheren Preis für ihre Produkte zu verlangen und
können so ihr Einkommen steigern. Lokale Lebensmittelsysteme fördern nicht nur lokale
ErzeugerInnen, sondern auch lokale VerarbeiterInnen und Einzelhändler. Durch ein geschicktes
local branding (siehe Kapitel 3.1.) und gezielten Einkaufsmöglichkeiten besteht die Möglichkeit
TouristInnen anzulocken. Diese erzielten lokalen Einnahmen der einzelnen AkteurInnen, bleiben
in der Regel in der regionalen Wirtschaft und erhöhen zusätzlich die ArbeiterInnenzahlen in
17weiteren Bereichen des Dienstleistungssektors (z.B. Hotellerie durch Übernächtigungen). All
diese Faktoren erbringen der Region einen wirtschaftlichen Vorteil (3) (Pearson et al. 2011, S.
889).
Zuletzt können sich für die KonsumentInnen persönliche gesundheitliche Vorteile erbringen.
Durch ein lokales Lebensmittelnetzwerk erhöht sich die Verfügbarkeit und die Auswahl an
unterschiedlichen saisonaler Nahrungsmitteln und es besteht die Möglichkeit ein frisches und
unverarbeitetes Produkt zu kaufen. Diese weisen wahrscheinlich einen höheren Nährstoffgehalt
als ein über einen längeren Zeitraum gelagertes und transportiertes Lebensmittel auf. Ein
weiteres Kriterium ist die Ernährungssicherheit. Eine Region, die in der Lage ist sich selbst zu
ernähren, muss keine Lebensmittel importieren und ist unabhängig (Pearson et al. 2011, S. 889).
183. Vermarktung regionaler Lebensmittel
Eine wichtige Rolle bei der Frage nach Regionalität eines Nahrungsmittels, spielt auch die
regionale Vermarktung. Eine Möglichkeit Regionalmarketing zu definieren, ist folgende
Formulierung:
„Regionalmarketing kann als eine Handlungsweise verstanden werden, die durch ihren
zielgerichteten Instrumenteneinsatz der lokalen Erzeugung, Verarbeitung und dem regionalen
Absatz von Lebensmitteln dient.“ (Hausladen 2001, zitiert nach Stockebrand 2012, S. 220)
Es sollte berücksichtigt werden, ob eine regional produzierte Ware über die Region hinaus
vermarktet wird, oder die Lebensmittel ganz absichtlich nur um die Region herum angeboten
werden und in der Region bleiben. Bei ersterem würde man von einer regionalen Spezialität
sprechen, welche von der EU besonders gefördert wird (Sauter und Meyer 2003, S. 26–27).
Stockebrand (2012, S. 220) spricht auch von zwei Formen von Regionalmarketing. Einerseits kann
es auf nationaler Ebene betrieben werden, um eine Region selbst zu versorgen, andererseits kann
das Produkt auch auf internationaler Ebene vermarktet werden.
Tabelle 1: Die zwei Typen von Regionalvermarktung
(Quelle: Spiller und Zühlsdorf 2006, zitiert nach Stockebrand 2012, S. 221)
19Tabelle 1 zeigt die Unterschiede dieser zwei Typen auf. Auffallend bei Typ 1 sind die häufig
verwendeten Wörter „Qualität“ und „Qualifiziert“. Um das Produkt möglichst erfolgreich als
regionale Spezialität vermarkten zu können, gibt es genaue Vorgaben, damit eine hohe Qualität
garantiert werden kann. Die Direktvermarktung ist ein kennzeichnendes Beispiel für den zweiten
Typen von Regionalvermarktung. Hier findet man keine strikten Vorgaben von Qualität und
Herkunft. Das hat ein unterschiedliches Verarbeitungsniveau des Produktes zur Folge. Dennoch
vertrauen hier die VerbraucherInnen aufgrund der Nähe zum Hersteller auf eine gute Qualität
(Stockebrand 2012, S. 221–222).
Deglobalisierung
Der Begriff wird in der Literatur Waldon Bello zugeschrieben und bezeichnet die Notwendigkeit
eines Umdenkens bezüglich der Ideologie des freien Marktes. Er beschreibt insgesamt elf
Kernelemente des Deglobalisierungsverfahrens. Unter anderem ist er der Meinung, dass sich die
Produktion eines Landes auf den heimischen Markt konzentrieren muss und nicht dem Export
dienen sollte. Zölle sollen dabei dazu dienen, um die lokale Wirtschaft vor den niedrigen Preisen
zu schützen (Bello 2009). Der Gedanke von Deglobalisierung stellt also durchaus eine Chance für
Vermarktung regionaler Lebensmittel dar.
3.1. Produkt branding
Es ergeben sich Schwierigkeiten beim Branding von regionalen Produkten, da der Begriff „Region“
nicht eindeutig definiert ist (siehe Kapitel 2.1). Ein regionales Produkt als ein solches zu
kennzeichnen, hat den Nutzen, die regionale Wirtschaft anzukurbeln und die Region zu
unterstützen. Erzeugnisse, die mit einer solchen Marke gekennzeichnet sind, haben eine
besondere Verbindung mit der Region, ihrem Charakter, ihrer Tradition, ihrer Kultur oder
Geschichte. Ein wichtiges Element bei der Vermarktung eines regionalen Lebensmittels ist, dass
die VerbraucherInnen von der „Echtheit“ und „Glaubwürdigkeit“ eines Produktes
20beziehungsweise einer Marke überzeugt sind. Produkteigenschaften müssen verlässlich und
sicher wirken (Pícha et al. 2018, S. 127–128).
Um ein erfolgreiches local branding zu schaffen, muss die Marke auf das Orts- und
Identitätsgefühl der lokalen Bevölkerung aufgebaut sein (Govers 2011, S. 230). Ein Produkt mit
einer gut geführten regionalen Marke ist somit für den Konsumenten bzw. die Konsumentin ein
nachvollziehbares und traditionelles Produkt (Pícha et al. 2018, S. 129).
3.2. Formen von regionalem Marketing
Üblicherweise werden regionale Lebensmittel über einen Hofladen oder einem Verkaufsstand an
der Straße direkt an den Konsumenten bzw. die Konsumentin vermarktet. Die VerbraucherInnen
haben somit die Möglichkeiten mit den Herstellern des Produktes zu sprechen und können ihnen
Fragen zur Herstellung stellen. Bei der Direktvermarktung kann somit eine Vertrauensbasis
entstehen (Czech et al. 2002, S. 17). Österreich ist in Europa eines der erfolgreichsten Länder, was
biologische, regionale und handwerkliche Lebensmittelproduktion betrifft. Bereits in den 1980er
Jahren entstanden Direktvertriebsprojekte und somit die ersten Bauernmärkte und Hofläden
(Schermer 2015, S. 122).
Nach Czech et al. (2002, S. 17–26) sind neben der Direktvermarktung weitere Möglichkeiten ein
regionales Nahrungsmittel erfolgreich zu vermarkten folgende:
Auf Bauernmärkten schließen sich mehrere Landwirte zusammen, um ihr Produkt zu
vermarkten. Damit können sie mehr Produkte anbieten und somit ihren Kundenkreis
vergrößern. Um das Einkaufserlebnis noch attraktiver zu gestalten, werden manchmal
verschiedenste Kultur- und Freizeitangebote mit den Märkten verknüpft.
Regionale Feste eignen sich hervorragend um ein Produkt aus der Region vorzustellen und
im Anschluss zu verkaufen. Veranstaltungen, in denen es rund um ein bestimmtes
Lebensmittel geht, können das Interesse der VerbraucherInnen wecken und Vertrauen
zwischen ErzeugerInnen und VerbraucherInnen schaffen.
21 Zur Versorgung von Haushalten kann ein Lieferdienst oder Partyservice behilflich sein. Es
besteht somit die Möglichkeit sich beispielsweise ein Buffet liefern zu lassen, welches nur
aus regionalen und saisonalen Produkte besteht.
Das Internet stellt eine bequeme und schnelle Möglichkeit dar, einzukaufen. Vor allem in
der heutigen Zeit, in der das Smartphone ein wichtiger Bestandteil unseres Lebens ist,
kann das Internet große Potentiale im regionalen Marketing aufweisen.
In der Gastronomie kann es schwierig sein, mit Lebensmitteln von einem regionalen
Landwirt zu kochen. Vor allem für größere Küchen ist es umständlich mit Anbietern zu
arbeiten, die nur wenige Produktgruppen zustellen. Sie brauchen große Mengen und eine
Vielfalt an Lebensmittel und können diese oft nicht von einem einzigen regionalen
Anbieter beziehen. Deshalb wird in der Gastronomie eher mit einem Großhändler
kooperiert, der verschiedenste Waren in einer breiteren Masse liefern kann. Pícha et al.
(2018, S. 128) beziehen sich sogar darauf, dass viele regionale Ökosysteme entweder gar
nicht in der Lage sind manche Produkte herzustellen, oder die benötigte Menge nicht
ausreicht, die gesamte Region zu versorgen.
Um einen neuen Kundenkreis zu erreichen sind auch Regionaltheken in Supermärkten
geeignet. Wegen der hohen Kundenfrequenz in solchen Geschäften kommt man an
VerbraucherInnen heran, die normalerweise nicht auf Regionalität bei ihren
Lebensmitteln setzen (Czech et al. 2002, S. 17–26).
Stockebrand (2012, S. 222) hingegen gliedert die Formen von Regionalmarketing in zwei Gruppen:
Einzelbetriebliches Engagement und Gruppenbezogene Ansätze (siehe Abbildung 2).
Einzelbetriebliches Engagement ist ihrer Meinung nach nicht nur bei der Direktvermarktung,
sondern auch auf Industrie- und Handelsebene zu finden. Der Handel versucht regionale Marken
aufzubauen, um diese dann im Einzelhandel zu verkaufen. Bei den gruppenbezogenen Formen
findet man horizontale und vertikale Arten von Zusammenschlüssen (Stockebrand 2012, S. 222).
Diese werden im nächsten Kapitel (Kapitel 3.3.) genauer besprochen.
22Abbildung 2: Formen der Regionalvermarktung
(Quelle: Stockebrand 2012, S. 222)
3.3. Kooperationen
Die bereits erwähnten horizontalen und vertikalen Kooperationen spielen auch nach Sauter und
Meyer (2003, S. 30) eine wichtige Rolle bei der regionalen Nahrungsmittelversorgung. Balling
(1994, S. 149) definiert diese Begriffe auf folgende Weise:
„Unter horizontaler Kooperation ist die Kooperation von Akteuren einer Marktstufe (z.B.
Landwirtschaftliche Erzeuger) zu verstehen. Vertikale Kooperation meint die Kooperation
von Akteuren verschiedener Marktstufen (z.B. Landwirte mit Vermarktem und/oder
Verarbeitern).“ (Balling 1994, S. 149)
Ein regionales Produkt, kann durch eine gute vertikale und horizontale Kooperation an Qualität
und Attraktivität dazugewinnen. Durch den Zusammenschluss von ErzeugerInnen (horizontale
Kooperation) können Angebote zusammengefasst werden und somit größere einheitliche
Mengen eines Produktes produziert werden (Sauter und Meyer 2003, S. 33). Die vertikale
Kooperation geht über die Erzeugerstufe hinaus und schließt Akteure mehrerer
Wertschöpfungsstufen mit ein (Stockebrand 2012, S. 222). Diese Kooperationsform ist von großer
Bedeutung, da sich die Möglichkeit ergeben hat, in regelmäßigen Abständen eine Menge einer
bestimmten Ware liefern zu können. Großverbraucher, wie die Gastronomie oder der
Lebensmittelhandel, können nun mit dem regionalen Produkt beliefert werden (Sauter und
Meyer 2003, S. 33).
233.3.1. Voraussetzungen für das Zustandekommen einer Kooperation
Balling (1994, S. 150–151) ist der Meinung, dass es vier Erfordernisse als Grundlage für eine
Kooperation benötigt:
1. Eine Kooperation macht nur Sinn, wenn der Erfolg des vereinten Teams größer ist als die
Erfolge der einzelnen Teammitglieder zusammen. Dabei müssen auch die Kosten der
Kooperation selbst (z.B. Organisation) berücksichtigt werden. Es liegt also eine
Effizienzsteigerung vor. Die Gründe für den Kooperationsvorteil können unterteilt werden
in Machtvorteile (1) und Produktivitätsvorteile (2). Bei den Machtvorteilen (1) geht es vor
allem darum, Vorteile für die Mitglieder der Kooperation zu schaffen. Dies geschieht
beispielsweise durch Umverteilung des Einkommens. Dies zieht natürlich auch Nachteile
für Nichtmitglieder mit sich. Produktivitätsvorteile (2) hingegen können die Einkünfte der
Kooperationsbeteiligten verbessern, ohne Nichtbeteiligte zu Schaden. Durch eine
organisatorische Umgestaltung wird ein Fortschritt erzielt und die Produktivität erhöht
(Grossekettler 1978, zitiert nach Balling 1994, S. 150).
2. Die Interessen der Mitglieder sind niemals absolut gleich. Deshalb können Schwierigkeiten
entstehen. Die Beteiligten verfolgen unterschiedliche Ziele, die sogar im Konflikt
zueinanderstehen können. Der zweite wichtige Punkt für eine gute Kooperation ist somit,
dass die Interessensübereinstimmungen größer als die Interessengegensätze sind.
3. Die Kooperation muss aus Sicht der einzelnen Betriebe die beste Alternative darstellen.
Das heißt, die Zusammenschließung muss für den Akteur die optimale
Handlungsmöglichkeit sein, um größtmögliche Gewinne zu erzielen.
4. Jedes Mitglied der Kooperation kann sich eine Quasirente, also einen finanziellen Profit,
aneignen (Balling 1994, S. 150–151).
3.3.2. Cummunity Supported Agriculture (CSA)
Regionales Marketing kann durch einen Verein, durch die Landwirtschaftskammer oder durch
eine Marketinggesellschaft übernommen werden. Sie vergeben regionale Herkunfts- und
24Qualitätszeichen. Mithilfe von Werbungen wird der Bekanntheitsgrad des Zeichens erhöht und
man erhofft sich einen erhöhten Absatz (Becker 2002, S. 47).
Eine etwas andere Form der Kooperation stellt die sogenannte Cummunity Supported Agriculture
(CSA) dar. Darunter sind Netzwerke zu verstehen, welche die Herstellerseite mit der
Verbraucherseite verbindet. Diese beiden Seiten arbeiten zusammen und tauschen sich aus. Die
Beziehung wird vertraglich vereinbart. VerbraucherInnen können somit direkt die Produktion
beeinflussen und ProduzenteInnen haben ein geringeres Risiko bei der Herstellung. In vielen
Ländern Europas und Nordamerikas findet man solche alternativen Lebensmittelnetzwerke.
Österreich hinkt hier ein wenig hinterher. Ein Beispiel für einen solchen Zusammenschluss findet
man an einem Hof in der Nähe von Wien (Schermer 2015, S. 121–122). Der Verein „Gemeinsam
Landwirtschaften Ochsenherz“ verwendet die Grundidee der CSA, indem sie ihre Mitglieder
wöchentlich mit Gemüse versorgen und diese sich zugleich um den Anbau, die Pflege und die
Ernte kümmern. Die jährlichen Mitgliedsbeiträge sind dabei die finanzielle Grundlage des Vereins
(Gemeinsam Landwirtschaften Ochsenherz).
254. Transnationale Zusammenarbeit innerhalb der EU
Ein wichtiges Hilfsmittel zur Förderung des Zusammenhalts innerhalb der EU ist die
Kommunikation auf transnationaler Ebene. Das Wissen über bewährte Methoden für eine
erfolgreiche territoriale Zusammenarbeit soll grenzüberschreitend ausgetauscht werden
(Knippschild und Vock 2017, S. 1737–1738).
Eine Zusammenarbeit bringt neue Sichtweisen mit sich und kann bei der Entwicklung von
Lösungen beitragen. Bei einer erfolgreichen Kooperation können die verfügbaren Ressourcen
eines Gebietes gebündelt werden und somit Entfernungen verkürzt werden. Jedoch ist ein hoher
zeitlicher und finanzieller Aufwand nötig, um eine solche Zusammenarbeit zu schaffen.
Kooperationen zwischen europäischen Gebieten wurden bereits im Jahr 1989 gebildet. Sie
stellten die Basis für die INTERREG-Initiative, welche ein wichtiges Programm der Kohäsionspolitik
der EU ist, dar (Luca et al. 2018, S. 20–21). Die Kohäsionspolitik richtet sich an alle Gebiete der EU
und dient zur Schaffung neuer Arbeitsplätze, der Unterstützung der Wettbewerbsfähigkeiten von
Unternehmen, dem Wirtschaftswachstum, der nachhaltigen Entwicklung und der Verbesserung
der Lebensqualität der EU-Bürger (Europäische Kommission 2014). Dühr und Nadin (2007, S. 375)
sehen eine transnationale Kooperation als einen „learning by doing“ - Prozess, bei dem
Erfahrungen generiert und ausgetauscht werden müssen.
Territoriale Agenda der EU
Die Territoriale Agenda der Europäischen Union (2011, S. 9) nahm sich bereits 2011 eine bessere
Integration in grenzüberschreitenden Regionen als Ziel. Folgende Punkte wurden im Schreiben
angeführt:
„(32) Wir unterstützen die über Kooperationsvorhaben hinausgehende transnationale und
grenzüberschreitende Integration und die gezielte Ausrichtung auf Entwicklungen und
Ergebnisse mit wirklich grenzüberschreitender oder transnationaler Bedeutung. […]“
(Territoriale Agenda der Europäischen Union 2011, S. 9–10)
26„(57) Wir begrüßen sämtliche Initiativen, die von staatlichen Behörden auf verschiedenen
Ebenen ausgehen und zur Entwicklung langfristiger grenzüberschreitender territorialer
Strategien beitragen, und fordern die Europäische Kommission auf, bei Bedarf
Unterstützung zu leisten.“ (Territoriale Agenda der Europäischen Union 2011, S. 15)
Geographische Gegebenheiten wie Berg- und Flussregionen sind häufig grenzüberschreitende
Gemeinsamkeiten einer Region. Diese können Nachteile, aber auch Entwicklungspotentiale
darstellen. Ein besonderes Natur-, Landschafts- oder Kulturerbe soll durch eine Zusammenarbeit
besser genutzt werden. Dabei ist es wichtig ein Vertrauen und ein soziales Kapital aufzubauen
(Territoriale Agenda der Europäischen Union 2011, S. 9). Bei einer grenzüberschreitenden
Zusammenarbeit wäre es von entscheidender Bedeutung, die gemeinsamen regionalen Nachteile
zu verringern und dabei auch die regionalen Vorteile zu erhöhen (Knippschild und Vock 2017, S.
1738).
Auch im Jahr 2020 hat die Territoriale Agenda der Europäischen Union (2020, S. 19–20) unter den
Territorialen Prioritäten für Europa angegeben, dass sich Integration über die Grenzen hinweg
vollziehen soll. Maßnahmen sollen ergriffen werden, um in Entwicklungsstrategien eine
dauerhafte grenzüberschreitende Kooperation zu errichten. Eine solche Zusammenarbeit birgt
jedoch noch zahlreiche administrative Schwierigkeiten (Territoriale Agenda der Europäischen
Union 2020, S. 19–20).
275. Methodik
Im Empirischen Teil der Arbeit, wird der Verein GlaMUR genauer analysiert und die Probleme
betrachtet, die der transnationale Vermarktungsgedanke mit sich bringt. Mithilfe von
leitfadengestützten Interviews wurden die Betrachtungsweisen verschiedener Vertreter des
Vereins und eines Vermarktungsunternehmens aufgezeichnet. Um die Sichtweise der
KonsumentInnen auch zu berücksichtigen, wurde eine Umfrage mittels eines Fragebogens
durchgeführt. Hierbei ging es einerseits um Kriterien, die ein regionales Lebensmittel aus Sicht
der VerbraucherInnen erfüllen muss, andererseits wurde auch der transnationale Gedanke in die
Fragen miteingebaut.
Im Gegensatz zu leitfadengestützten Interviews, welche zu den qualitativen Forschungsmethoden
zählen, befindet sich eine Umfrage mittels eines Fragebogens auf der Liste der quantitativen
Forschungsmethoden. Diese arbeiten mit exakt messbaren, numerischen („harten“) Daten und
versuchen mithilfe von mathematischen Verfahrensweisen, möglichst objektive und
realitätsnahe Analysen zu erstellen. Qualitative Forschungsverfahren berücksichtigen hingegen
die Subjektivität in ihren Untersuchungsgebieten und vertreten den Standpunkt, dass die
Wahrnehmung einer „objektiven Realität“ unmöglich ist, da nicht alle Informationen
wahrgenommen und berücksichtigt werden können. Eine solche Realität kann nicht untersucht
werden, weil sie von zu vielen sozialen Faktoren beeinflusst wird (Mattissek et al. 2013, S. 34–38).
5.1. Interviews
In qualitativ-interpretativen Interviews wird darauf geachtet, dass ein Umfeld für einen möglichst
informativen Dialog geschaffen wird. Anders als bei quantitativen Methoden wird auf eine
Normierung der Gegebenheiten verzichtet. Es wird versucht, sich an die Situation des
Interviewpartners anzupassen. Deshalb ist es auch möglich, wenn nicht gar erwünscht, die
Interviewleitfäden von Gespräch zu Gespräch demensprechend abzuändern (Kromrey und
Strübing 2009, S. 386).
28Sie können auch lesen