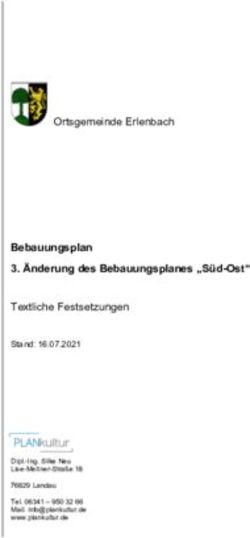Völkerrecht in der aussenpolitischen Praxis
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Völkerrecht in der aussenpolitischen Praxis
Seminar FS 2021
Prof. Dr. Anna Petrig, LL.M. & Dr. Nikolas Stürchler, LL.M., stellvertretender Missionschef,
Schweizer Botschaft in Singapur, 1 Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegen-
heiten (EDA)
Terminübersicht
Vorbesprechung Mo, 23. November 2020, 16h15 zoom - obligatorisch
Themenwahl bis So, 13. Dezember 2020, 17h00 via ADAM-Umfragetool
Themenvergabe Mo, 14. Dezember 2020 per Mail
Terminwahl Schulung bis So, 13. Dezember 2020, 17h00 via ADAM-Umfragetool
Rechercheschulung Mo, 25. Januar 2021, 13h00-14h00 zoom - freiwillig
Doppelstunde 1 Mo, 1. März 2021, 12h15-14h00 zoom - obligatorisch
Doppelstunde 2 Di, 2. März 2021, 12h15-14h00 zoom - obligatorisch
Doppelstunde 3 Mi, 3. März 2021, 12h15-14h00 zoom - obligatorisch
Abgabe Positionspapier bis So, 4. April 2021, 17h00 via ADAM-Postbox
Blockseminar Halbtag 1 Mo, 26. April 2021, 8h15-12h15 zoom - obligatorisch
Blockseminar Halbtag 2 Di, 27. April 2021, 8h15-12h15 zoom - obligatorisch
Blockseminar Halbtag 3 Mi, 28. April 2021, 8h15-12h15 zoom - obligatorisch
Abgabe Arbeit bis Fr, 11. Juni 2021, 17h00 via ADAM-Postbox
A. Thema und Ziel des Seminars
Das Völkerrecht entwickelt sich laufend fort. Neue Verträge werden geschlossen, wie in jün-
gerer Vergangenheit der Vertrag über den Waffenhandel. Ausserdem werden neue Techno-
logien entwickelt und eingesetzt, wie automatisierte und autonome Waffensysteme, was die
Frage nach deren völkerrechtlichen Normierung nach sich zieht. Weiter werden neue Institu-
tionen geschaffen oder ausgebaut, deren Wirkungsbereich und Arbeitsweise definiert wer-
den muss. So wurde z.B. das Statut des Internationalen Strafgerichtshofs vor wenigen Jahren
um den Tatbestand der Aggression erweitert.
Das Seminar «Völkerrecht in der aussenpolitischen Praxis» bietet StudentInnen die Gelegen-
heit, sich mit aktuellen Entwicklungen im Völkerrecht vertieft auseinanderzusetzen. Dabei er-
laubt die Zusammenarbeit mit Dr. Stürchler vom Eidgenössischen Departement für auswär-
tige Angelegenheiten (EDA) den StudentInnen, nicht nur mit dem law in the books sondern
auch mit dem law in action vertraut zu werden. Sie erhalten Informationen aus erster Hand
zur aussenpolitischen Praxis der Schweiz und können einen Blick hinter die Kulissen der inter-
nationalen Bühne werfen.
Dabei veranschaulichen drei Praxisbeispiele das Völkerrecht in der aussenpolitischen Praxis.
1
Bis Sommer 2018: Chef Sektion Humanitäres Völkerrecht und internationale Strafjustiz, Direktion für Völker-
recht des EDA.
1Praxisbeispiel 1: Die Aushandlung des UNO Waffenhandelsvertrages (ATT): Im Frühjahr
2013 verhandelten die UNO Mitgliedstaaten über den Abschluss eines neuen Regelwerkes für
den 60 Milliarden US-Dollar schweren internationalen Waffenhandel. Über zehn Jahre Lob-
byarbeit von Nichtregierungsorganisationen für mehr Verantwortung im Handel mit konven-
tionellen Waffen kulminierten in einer zweiwöchigen diplomatischen Konferenz, die eine Ei-
nigung sämtlicher 193 Mitgliedstaaten über das künftige Regime zum Ziel hatte. Herzstück
der Verhandlungen: Welche Form sollten die humanitären Schlüsselpassagen des Vertrages
annehmen? Wie sollten darin die Interessen waffenexportierender und -importierender Staa-
ten und Akteure, nicht zuletzt vor dem Hintergrund des Bürgerkrieges in Syrien, mit den Rufen
nach Unterbindung von Waffengewalt in Einklang gebracht werden? Wie sollten die Men-
schenrechte und das Humanitäre Völkerrecht zum Tragen kommen?
Praxisbeispiel 2: Die Aushandlung des Verbrechens der Aggression (ICC): 1998 konnten sich
die Staaten bei der Finalisierung des Römer Statuts des Internationalen Strafgerichthofs (ICC)
nicht auf ein viertes Verbrechen einigen, das durch den Gerichtshof verfolgt werden sollte:
das Verbrechen der Aggression bzw. die Ahndung von schweren Verletzungen des UNO Ge-
waltverbotes. 2010 traten die ICC-Mitgliedstaaten in Kampala (Uganda) zu einer Revisions-
konferenz zusammen, um es mit einer Einigung erneut zu versuchen. Wie sollte das Verbre-
chen inskünftig durch den Gerichtshof verfolgt werden können? Würden Aggressionsakte von
Nichtvertragsstaaten über ein individuelles Strafverfahren ebenfalls vom Gerichtshof beur-
teilt werden können? Welche Rolle sollte dem ICC gegenüber dem UNO Sicherheitsrat für die
Durchsetzung des UNO Gewaltverbotes zugesprochen werden? Im Dezember 2017 befanden
die ICC-Mitgliedstaaten abschliessend über den Straftatbestand.
Praxisbeispiel 3: Die Aushandlung eines Regelwerkes für autonome Waffensysteme (LAWS):
Die Vertragsstaaten der UNO Rahmenkonvention für konventionelle Waffen (CCW) diskutie-
ren seit Jahren über eine sinnvolle Regulierung von «Killerrobotern», die sich anschicken, in
Zukunft die Kriegsführung zu revolutionieren. Die Zivilgesellschaft verlangt ein präventives
Verbot autonomer Waffen jenseits sinnvoller menschlicher Kontrolle. Andere führen ins Feld,
dass die existierenden völkerrechtlichen Verpflichtungen genügend Auflagen bereithalten
und Kriege mit derartigen Waffen eines Tages sogar humaner geführt werden als heute. Wel-
che Verpflichtungen hält das geltende Völkerrecht für die Entwicklung und den Einsatz von
autonomen Waffensystemen bereit? Wie sollen Staaten autonome Waffen in Zukunft regu-
lieren? Wie soll menschliche Kontrolle über das Handeln autonomer Waffen ausgeübt werden?
Im November 2019 einigten sich die UNO-Mitgliedstaaten in einem ersten Schritt auf elf Leit-
prinzipien. 2021 steht die CCW Überprüfungskonferenz an.
B. Ablauf und Aufbau des Seminars
Das Seminar setzt sich aus drei Teilen zusammen, die im Folgenden beschrieben werden.
1. Teil: Theoretische Grundlegung
In drei Doppelstunden führt Frau Prof. Petrig die StudentInnen in die Themen der drei Praxis-
beispiele ein. Diese theoretische Grundlegung verschafft den StudentInnen einen schnellen
Einstieg in die Materie und situiert das Praxisbeispiel im grösseren Kontext. Dies erleichtert
2das Verfassen des Positionspapiers im ausgewählten Themenbereich und schafft die Grund-
lage, um auch die anderen beiden Praxisbeispiele zu verstehen.
Die drei Doppelstunden sind von allen StudentInnen zu besuchen; sie gelten als Teil der münd-
lichen Komponente des Seminars (Anwesenheitsliste wird geführt).
Die drei Doppelstunden finden an folgenden Daten statt:
− Doppelstunde 1: Montag, 1. März 2021, 12h15-14h00, via zoom
− Doppelstunde 2: Dienstag, 2. März 2021, 12h15-14h00, via zoom
− Doppelstunde 3: Mittwoch, 3. März 2021, 12h15-14h00, via zoom
2. Teil: Schriftliche Eigenleistung (Seminararbeit)
Die StudentInnen erbringen eine schriftliche Eigenleistung (Seminararbeit) zu einem der drei
Praxisbeispiele, d.h. Waffenhandelsvertrag, Verbrechen der Aggression oder autonome Waf-
fensysteme. Jede schriftliche Eigenleistung umfasst zwei Teile: die wissenschaftliche Arbeit
(18 Seiten) sowie das Positionspapier (1-2 Seiten).
Rechercheschulung
Damit Sie wissen, welche spezifischen Recherchemöglichkeiten im Bereich des Völkerrechts
bestehen, bieten wir eine von der Bibliothek der Juristischen Fakultät durchgeführte Schulung
an. Die Teilnahme daran ist freiwillig, wird allerdings empfohlen. Einzelheiten dazu entneh-
men Sie dem ADAM-Workspace.
Wissenschaftliche Arbeit
Jede(r) Student(in) verfasst eine wissenschaftliche Arbeit in der er/sie ein Thema aus der Liste
im Anhang 1 darstellt und kritisch würdigt.
Umfang Seminararbeit: min. 40’000 Zeichen (mit Fussnoten und Leerzeichen, ohne Verzeich-
nisse und Anhänge; entspricht ca. 18 Seiten) bis max. 46’000 Zeichen (entspricht ca. 23 Seiten).
Massgeblich ist die Zeichenzahl, da die Seitenzahl je nach Layout variiert. Das Positionspapier
(1-2 Seiten) wird der Arbeit als Anhang angefügt; somit erfüllt sie hinsichtlich der Länge die
Anforderungen an eine Seminararbeit.
Masterarbeit: Sofern Sie Ihre Masterarbeit im Rahmen des Seminars verfassen, setzen Sie sich
bitte mit Frau Prof. Petrig in Verbindung.
Sprache: Die Arbeiten werden auf Deutsch abgefasst; wer die Arbeit auf Englisch oder Fran-
zösisch verfassen möchte, soll sich bitte mit Frau Prof. Petrig in Verbindung setzen.
Abgabetermin: Freitag, 11. Juni 2021, 17h00; zu spät und ohne gültigen Entschuldigungs-
grund eingereichte Seminararbeiten werden als nicht bestanden zurückgewiesen.
Abgabeformat: via ADAM-Postbox; die Arbeit ist in Word- und PDF-Format abzugeben (je-
weils ein einziges Dokument).
3Bewertung: Die wissenschaftliche Arbeit zählt zu 75% für die Endnote; bei Masterarbeiten
wird die wissenschaftliche Arbeit höher gewichtet.
Positionspapier
Jede(r) Student(in) erarbeitet ein Positionspapier zu jenem Praxisbeispiel, dem er/sie
seine/ihre wissenschaftliche Arbeit widmet.
Ein Positionspapier ist ein kurzer Text, mit welchem eine Delegation im Hinblick auf Verhand-
lungen ihre Haltung präsentiert. Jedem Praxisbeispiel liegt ein offizieller Textentwurf zu-
grunde, der als Basis für eine anstehende Verhandlungsrunde dient (siehe dazu Anhang 1).
Die StudentInnen haben den Auftrag, im Rahmen ihres Positionspapiers auf den Textentwurf
zu reagieren und dabei zwei Ansprüchen gerecht zu werden:
- Sie formulieren eine Alternative zum offiziellen Textvorschlag entsprechend den vor-
gegeben Interessen Ihres Landes und gemäss Ihren Verhandlungsinstruktionen. Sie
weisen die nötigen Textänderungen beispielsweise in Form von track changes aus.
- Sie begründen die geforderten Änderungen zum offiziellen Textentwurf entspre-
chend den vorgegebenen Interessen Ihres Landes und gemäss Ihren Verhandlungsin-
struktionen. Sie kommentieren beispielsweise die geforderten Änderungen Wort für
Wort.
Die StudentInnen sind frei in der Art und Weise, wie sie die beiden obgenannten Elemente in
ihrem Positionspapiers verbinden. Ziel ist unabhängig von Form und Detailgrad ein möglichst
überzeugendes und rechtlich stichhaltiges Positionspapier zu erarbeiten, das geeignet ist, den
Ausgang der bevorstehenden Verhandlungen zu den eigenen Gunsten zu beeinflussen. Es sind
auch (rechts-)politische Argumente zugelassen.
Tipps für das Verfassen des Positionspapiers:
- Kommen Sie gleich zur Sache. Lassen Sie Begrüssungen und allgemeine Einleitungen
weg. Seien Sie sachlich.
- Hauptsache überzeugen: Es sind beispielsweise auch rechtspolitische Argumente er-
laubt.
- Unterlassen Sie Argumente, die nicht in den Textvorschlägen (d.h. in Änderungen bzw.
Ergänzungen des Wortlauts der unterbreiteten Entwurfsbestimmung) Niederschlag
finden. Sie werden vom Fazilitator ignoriert.
- Lösen Sie sich von bekannten Lösungen. Textvorschläge können und sollen über die in
der Realität erzielten Vertragsverhandlungen hinausgehen. Seien Sie kreativ!
- Prüfen Sie Ihre Textvorschläge. Sind sie geeignet, das vorgetragene Anliegen umzuset-
zen?
- Versetzen Sie sich in die Lage von anderen Ländervertretern: Wie kommt Ihr Argu-
mentarium wohl an? Welche Reaktionen sehen Sie voraus? Welche Kompromisse
können Sie sich vorstellen?
- Versetzen Sie sich in die Lage des Fazilitators. Was soll er oder sie konkret tun? Welche
Vorschläge sollen in welcher Form einfliessen? Schlichte Änderungsvorschläge lassen
sich leichter «verkaufen».
4Um die Verhandlung möglichst spannend zu machen, repräsentieren die StudentInnen Länder
mit sehr unterschiedlichen Interessen. Die dazu gehörenden Instruktionen werden den Stu-
dentInnen individuell übergeben und sind für sie für die Verhandlungen verbindlich. Während
die Landeszugehörigkeit bekannt gemacht wird, behält jede(r) StudentIn die Verhandlungsin-
struktionen für sich. Den konkreten Auftrag und Angaben zum Ländertyp, den Sie vertreten,
finden Sie in Anhang 1.
Die Positionspapiere der StudentInnen dienen als Grundlage für die Simulation einer Ver-
handlungssituation anlässlich der Blocktage, bei der es darum geht, sich nach Möglichkeit auf
einen gemeinsamen Beschluss aller TeilnehmerInnen zu einigen.
Umfang: Positionspapier umfasst maximal 1-2 Seiten.
Angaben: Das Positionspapier muss die Praxisbeispiel-Nummer, den vertretenen Ländertyp
sowie den Namen der Autorin bzw. des Autors ausweisen.
Abgabetermin und -format: Das Positionspapier ist bis spätestens am Sonntag, 4. April 2021,
17h00, als Word- und PDF-Dokument auf ADAM (via Postbox) hochzuladen. Die Positionspa-
piere werden allen TeilnehmerInnen über ADAM vor den Blocktagen zugänglich gemacht.
Bewertung: Das Positionspapier zählt zu 25% für die Endnote.
3. Teil: Blocktage: Blick hinter die Kulissen, Verhandlungssimulation und Diskussion
Den Abschluss des Seminars bildet das Blockseminar, das am Montag, 26. April 2021, Diens-
tag, 27. April 2021, und Mittwoch, 28. April 2021, jeweils von 8h15 – 12h30 online stattfin-
det.
Ablauf: Den drei Praxisbeispielen ist je ein halber Tag gewidmet. Dabei steht im Vordergrund,
die StudentInnen an die Perspektive des EDA und die konkrete Umsetzung in multilateralen
Verhandlungen heranzuführen und praxisnah in einem ungezwungenen Rahmen nacherleben
zu lassen. Die StudentInnen sollen erlernen, was es in der Praxis bedeutet, im EDA und an
einer diplomatischen Konferenz eine völkerrechtliche Fragestellung zu verfolgen. Ihre selbst
erarbeiteten Positionspapiere fliessen direkt in die Simulation multilateraler Verhandlungen
ein. Jeder Halbtag wird wie folgt strukturiert:
- Einführung in die Praxisbeispiele (½h)
- Verhandlungssimulation (1h)
- Pause (½h)
- Besprechung Simulation (½h)
- Erfahrungsbericht und Diskussion (1 ½h; verkürzt am letzten Halbtag für einen Aus-
tausch zum Berufsfeld Völkerrecht)
Verhandlungssimulation und Besprechung: Den StudentInnen liegen sämtliche Positionspa-
piere ihrer KollegInnen vor. Herr Dr. Stürchler waltet als Fazilitator und ist bemüht, unter den
5StudentInnen als Ländervertreter(innen) eine Einigung auf einen gemeinsamen Text herzu-
stellen. Im Rahmen der Verhandlungen können alle StudentInnen frei argumentieren im Be-
mühen, ihre Vorschläge oder Varianten dadurch zum Durchbruch zu verhelfen. StudentInnen
ohne Zuteilung zum behandelten Praxisbeispiel können sich ebenfalls einbringen. Ziel der Si-
mulation ist, ein Grundverständnis für die Verhandlungsdynamik in einer multilateralen Kon-
ferenz zu gewinnen. Die Einsichten werden diskutiert. Die Teilnahme wird nicht benotet, aber
eine aktive Rolle aller StudentInnen ist wichtig für realitätsnahe Simulationen.
Erfahrungsbericht und Diskussion: In einem anschliessenden Teil beschreibt Herr Dr. Stürchler
die Position, Herangehensweise und den Verlauf der Verhandlungen aus seiner persönlichen
Erfahrung in den Verhandlungen in New York und Genf. Die StudentInnen sollen eine Vorstel-
lung erhalten, welche Prozesse im Zusammenhang mit einer multilateralen Verhandlung zum
Tragen kommen.
Berufsfeld Völkerrecht: Zum Abschluss findet eine kurze Information und ein Austausch zum
Arbeiten beim EDA, im diplomatischen Dienst bzw. in internationalen Organisationen statt.
Anwesenheitspflicht/Bewertung: Die Blocktage gehören zur mündlichen Komponente des Se-
minars; sie müssen besucht werden (Anwesenheitsliste wird geführt).
6Anhang 1: Themen für wissenschaftliche Arbeit und Infos zu Positionspapier
Jede(r) Student(in) schreibt die wissenschaftliche Arbeit und das Positionspapier zu einem der
drei Praxisbeispiele (Waffenhandelsvertrag, Verbrechen der Aggression oder autonome Waf-
fensysteme). Wegen der Verhandlungssimulationen sollten die drei Praxisbeispiele je unge-
fähr gleich stark besetzt sein.
Wahl Praxisbeispiel und Thema für Arbeit
Bis am Sonntag, 13. Dezember 2020, 17h00 teilen Sie uns via Umfrage-Tool auf ADAM fol-
gendes mit:
- 1. Wunsch für das Praxisbeispiel (d.h. ATT, ICC oder LAWS) und das von Ihnen aus der
untenstehenden Liste gewählte Thema für die wissenschaftliche Arbeit (bei der Wahl
des Praxisbeispiels ATT z.B. das Thema «Ein Vergleich zwischen Art. 6 und 7 Waffenhan-
delsvertrag und der Schweizer Waffenexportregulierung»);
- 2. Wunsch für das Praxisbeispiel (d.h. ATT, ICC oder LAWS) und das von Ihnen aus der
untenstehenden Liste gewählte Thema für die wissenschaftliche Arbeit (bei der Wahl des
Praxisbeispiels ICC z.B. «Die Zuständigkeit des ICC in Bezug auf die Rohingyakrise in My-
anmar»).
Wir versuchen, Ihre Wünsche für das Praxisbespiel so weit wie möglich zu berücksichtigen;
allerdings müssen alle drei Gruppen ca. gleich gross sein.
Bitte beachten Sie: Das von Ihnen für das jeweilige Praxisbeispiel gewählte Thema für die wis-
senschaftliche Arbeit wird Ihnen auf jeden Fall zugeteilt (bei den Themen für die wissenschaft-
liche Arbeit ist es egal, wenn diese mehrfach vergeben werden). Kurz gesagt: Wählen Sie Ihr
Lieblingsthema für die Seminararbeit innerhalb des jeweiligen Praxisbeispiels – denn es hat
keinen Einfluss auf die Zuteilung zur Praxisbeispielgruppe.
Ihr Thema (inklusive der von Ihnen vertretene Ländertyp und die begleitenden – vertraulichen
– Instruktionen) wird Ihnen bis spätestens Montag, 14. Dezember 2020, via E-Mail mitgeteilt.
Praxisbeispiel 1: Die Aushandlung des UNO Waffenhandelsvertrages (ATT)
Themen für die wissenschaftliche Arbeit
1. Waffenhandel und staatliche Verpflichtungen gemäss Art. 1 der Genfer Konventionen
von 1949 («duty to respect and ensure respect»)
2. Waffenhandel und staatliche Verpflichtungen gemäss Art. 16 der Artikel zur Staaten-
verantwortlichkeit («Beihilfe oder Unterstützung»)
3. Ein Vergleich zwischen Art. 6 und 7 Waffenhandelsvertrag und der Schweizer Waffen-
exportregulierung
4. Art. 6 Ziff. 3 Waffenhandelsvertrag: Eine kritische Analyse des Anwendungsbereichs
im Lichte des Völkerstrafrechts und des Humanitären Völkerrechts
75. Die Schwelle für ein Exportverbot gemäss Art. 7 Ziff. 3 Waffenhandelsvertrag («over-
riding risk»): Interpretation und kritische Analyse
6. Art. 2, 3 und 4 Waffenhandelsvertrag: Eine kritische Analyse des Anwendungsbereichs
7. Der Jemenkrieg und der Waffenhandelsvertrag: Eine Untersuchung des Vorwurfs der
Vertragsverletzung am Beispiel Grossbritanniens
8. Eine kritische Würdigung des Waffenhandelsvertrags in Bezug auf Waffenlieferungen
an nichtstaatliche Akteure
Hintergrund zum Positionspapier
Es ist Frühling 2013. Die UNO Mitgliedstaaten treffen sich zu einer letzten Verhandlungsrunde
zur Aushandlung des Waffenhandelsvertrages (ATT). Die Konferenz ist nur befugt, per Kon-
sens (d.h. ohne aktive Gegenstimme eines Staates bei Verabschiedung) einen Text zu finali-
sieren. Der Präsident der Konferenz hat als Grundlage der Verhandlungen einen Vertragsent-
wurf zirkulieren lassen, der in seiner Einschätzung ein tragfähiger Kompromiss für alle Staaten
darstellen könnte. Dieser umschreibt das absolute Verbot für Waffentransfers folgendermas-
sen:
Artikel 6 - Verbotene Transfers
(...)
3. Ein Vertragsstaat darf keinerlei Transfer konventioneller Waffen im Geltungsbereich dieses
Vertrags genehmigen, um die Begehung von Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlich-
keit, Kriegsverbrechen in der Form von schweren Verletzungen gegen die Genfer Abkommen
von 1949 oder schwere Verletzungen des gemeinsamen Artikel 3 der Genfer Abkommen von
1949 zu erleichtern.
Verfassen Sie ein Positionspapier in Reaktion auf diesen offiziellen Textentwurf. Ändern bzw.
ergänzen Sie die Bestimmung so, dass sie den Interessen Ihres Ländertyps und Ihren Instruk-
tionen am besten entspricht. Schreiben Sie ein Argumentarium, in dem Sie begründen, wa-
rum die Bestimmung genau so lauten muss, wie von Ihnen vorgeschlagen.
Ausgangslage für die Verhandlungen
Praxisbeispiel 1, Ländertyp A: Sie sind eines der grössten waffenexportierenden Länder welt-
weit und in zahlreichen bewaffneten Konflikten militärisch involviert, zuweilen auch im Rah-
men humanitärer Interventionen.
Praxisbeispiel 1, Ländertyp B: Sie sind seit Jahrzenten humanitären Werten verpflichtet und
haben als Kleinstaat seit Jahren Ihre Haltung öffentlich zum Ausdruck gebracht, dass Waffen-
exporte eine der Hauptursachen für menschliches Leid in bewaffneten Konflikten darstellen.
8Praxisbeispiel 1, Ländertyp C: Sie sind ein mittelgrosses Land in einem spannungsgeladenen
regionalen Umfeld. Mangels eigener Rüstungsindustrie sind Sie auf Waffenimporte angewie-
sen, um die Armee für den Fall einer militärischen Auseinandersetzung adäquat auszurüsten.
Praxisbeispiel 2: Die Aushandlung des Verbrechens der Aggression
Themen für die wissenschaftliche Arbeit
1. Eine kritische Analyse der Definition des Verbrechens der Aggression im Römer Statut
im Lichte der humanitären Intervention
2. Die Zuständigkeit des ICC für Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und
Kriegsverbrechen gemäss Art. 12 Abs. 3 Römer Statut
3. Rechtliche Parameter für Überweisungen von Situationen an den Internationalen
Strafgerichtshof durch den UNO Sicherheitsrat: Voraussetzungen gemäss Römer Sta-
tut und Handlungsspielraum des UNO Sicherheitsrates
4. Das «Opt-out Regime» für das Verbrechen der Aggression gemäss Art. 15bis Abs. 4
Römer Statut
5. Die Regulierung von Statutenänderungen gemäss Art. 121 Römer Statut im Verhältnis
zum Verbrechen der Aggression
6. Die Zuständigkeit des ICC in Bezug auf die Rohingyakrise in Myanmar
7. Das Zuständigkeitsregime des ICC für Kriegsverbrechen im Verhältnis zu Drittstaaten
am Beispiel der USA
Hintergrund zum Positionspapier
Es ist Sommer 2010. Sie sind auf dem Weg zur ersten Revisionskonferenz der Vertragsstaaten
sieben Jahre nach in Kraft treten des Römer Statuts für den internationalen Strafgerichtshof
ICC. Auf der Agenda stehen Verhandlungen über das Verbrechen der Aggression. Gemäss Art.
5 Abs. 2 des Statuts müssen die ICC Vertragsstaaten sich auf Bedingungen einigen, unter wel-
chen Umständen der Gerichtshof für die Verfolgung des Verbrechens jenseits von Überwei-
sungen durch den UNO Sicherheitsrat zuständig sein soll. Der Entwurf des Fazilitators der Ver-
handlungen sieht folgende alternative Lösungen vor:
Nach Artikel 15 des Statuts wird folgender Text eingefügt:
Artikel 15bis - Ausübung der Gerichtsbarkeit über das Verbrechen der Aggression (Unterbrei-
tung durch einen Staat oder aus eigener Initiative)
[Alternative 1:]
Der Gerichtshof kann seine Gerichtsbarkeit über das Verbrechen der Aggression in Überein-
stimmung mit Artikel 13 Buchstaben a und c sowie in Übereinstimmung mit Artikel 12 ausü-
ben.
[Alternative 2:]
9Der Gerichtshof kann seine Gerichtsbarkeit über das Verbrechen der Aggression in Überein-
stimmung mit Artikel 13 Buchstaben a und c sowie in Übereinstimmung mit Artikel 12 ausü-
ben, sofern es sich aus einer Angriffshandlung eines Vertragsstaats ergibt.
[Alternative 3:]
Der Gerichtshof kann seine Gerichtsbarkeit über das Verbrechen der Aggression in Überein-
stimmung mit Artikel 13 Buchstaben a und c sowie in Übereinstimmung mit Artikel 12 ausü-
ben, sofern es sich aus einer Angriffshandlung eines Vertragsstaats ergibt, der die Änderun-
gen der Straftat der Aggression ratifiziert hat.
Verfassen Sie ein Positionspapier in Reaktion auf diesen offiziellen Textentwurf. Identifizieren
Sie eine bevorzugte Variante. Ändern bzw. ergänzen Sie nötigenfalls diese Vorzugsvariante so,
dass sie den Interessen Ihres Ländertyps und Ihren Instruktionen am besten entspricht.
Schreiben Sie ein Argumentarium, in dem Sie begründen, warum die Bestimmung genau so
lauten muss, wie von Ihnen vorgeschlagen.
Ausgangslage für die Verhandlungen
Praxisbeispiel 1, Ländertyp A: Sie sind ein permanentes Mitglied des UNO Sicherheitsrates
und spielen eine tragende Rolle in militärischen Interventionen weltweit, namentlich zur Be-
kämpfung des Terrorismus oder in der Vergangenheit auch für die Vernichtung von vermute-
ten Massenvernichtungswaffen im Irak.
Praxisbeispiel 1, Ländertyp B: Sie sind ein kleineres Land mit wenig bis keinem militärischen
Engagement im Ausland, das sich seit den 1990er Jahren für den ICC und im Kampf der Straf-
losigkeit eingesetzt hat.
Praxisbeispiel 1, Ländertyp C: Sie sind ein mittelgrosses Land mit gewichtigen wirtschaftlichen
und politischen Beziehungen zum Ländertyp A. Gleichzeitig blicken Sie auf eine lange Tradi-
tion des Einsatzes für die Menschenrechte zurück.
Praxisbeispiel 3: Die Aushandlung eines Regelwerkes für autonome Waffensysteme
Themen für die wissenschaftliche Arbeit
1. Autonome Waffensysteme: Eine Analyse der im Rahmen der UNO Rahmenkonvention
für konventionelle Waffen vorgeschlagenen Definitionen
2. Das Unterscheidungsprinzip gemäss Zusatzprotokoll I zu den Genfer Abkommen von
1949 und autonome Waffensysteme
3. Das Vorsichtsprinzip bei der Planung, dem Beschluss und der Durchführung eines An-
griffs gemäss Zusatzprotokoll I zu den Genfer Abkommen von 1949 und autonome
Waffensysteme
104. Das Perfidieverbot, die Vermutung des zivilen Status und das Verbot der Kampffüh-
rung ohne Pardon und autonome Waffensysteme: Einordnung und Würdigung
5. Das Kriegsverbrechen des Angriffs auf die Zivilbevölkerung (Art. 8(2)(b)(i) Römer Sta-
tut) und der Einsatz autonomer Waffensysteme im Lichte der Vorgesetztenverant-
wortlichkeit
6. Das Kriegsverbrechen des Angriffs auf die Zivilbevölkerung (Art. 8(2)(b)(i) Römer Sta-
tut) und der Einsatz autonomer Waffensysteme im Lichte der individuellen Verant-
wortlichkeit
Hintergrund zum Positionspapier
Eine neue Arbeitsgruppe zum Thema «lethal autonomous weapon systems» (LAWS) der UN
Rahmenkonvention zu konventionellen Waffen (CCW) beschäftigt sich seit der CCW Überprü-
fungskonferenz aus dem Jahr 2021 mit einem Entwurf für eine neue Konvention zur Regulie-
rung von autonomen Waffensystemen. Der Entwurf soll als Basis für eine von der CCW ein-
berufenen diplomatischen Konferenz dienen, welche den Text 2022 finalisieren und verab-
schieden soll. Für die nächste Sitzung der Gruppe hat der Vorsitzende einen Vorschlag für
einen gemeinsamen Text erarbeitet, der die ersten Kernpassagen des neuen Vertrages bilden
könnte. Die anvisierten Artikel sollen nach den Vorstellungen des Vorsitzenden namentlich
aufgrund der im November 2019 adoptieren CCW Leitprinzipien das gemeinsame Verständnis
der Staaten widerspiegeln, welche autonomen Waffensysteme erfasst werden sollen und
welches Mass an menschlicher Kontrolle für den Einsatz von autonomen Waffensystemen
Vorschrift werden soll. Die Formulierung lautet wie folgt:
Artikel 1 – Definition
Autonome Waffensysteme im Sinne dieses Vertrages sind Waffensysteme, die in der Lage
sind, Aufgaben auszuführen, die dem humanitären Völkerrecht unterliegen, unter teilweisem
oder vollständigem Ersatz eines Menschen bei der Anwendung von Gewalt, insbesondere in
Bezug auf die Initiierung und Durchführung eines Angriffes.
Artikel 2 – Menschliche Kontrolle
Jeder Vertragsstaat gewährleistet bei der Entwicklung, dem Einsatz und der Nutzung autono-
mer Waffensysteme jene verantwortungsvolle Kette menschlicher Führung und Kontrolle ,
die geeignet ist, eine Verletzung des humanitären Völkerrechts vorzubeugen sowie erlaubt,
schwere Verletzungen strafrechtlich zuzurechnen, unter gesamthafter Berücksichtigung des
operationellen Kontextes sowie der Charakteristika und Fähigkeiten solcher Waffensysteme.
Verfassen Sie ein Positionspapier in Reaktion auf diesen offiziellen Textentwurf. Ändern bzw.
ergänzen Sie die Bestimmung so, dass sie den Interessen Ihres Ländertyps und Ihren Instruk-
tionen am besten entspricht. Schreiben Sie ein Argumentarium, in dem Sie begründen, wa-
rum die Bestimmung genau so lauten muss, wie von Ihnen vorgeschlagen.
11Ausgangslage für die Verhandlungen
Praxisbeispiel 1, Ländertyp A: Sie sind ein grösseres Land mit einer beachtlichen Rüstungsin-
dustrie, das im Rahmen von militärischen Operationen stark auf die Vorteile modernerer Waf-
fentechnologien wie zum Beispiel den Einsatz von bewaffneten Drohnen setzt.
Praxisbeispiel 1, Ländertyp B: Sie sind ein mittelgrosses Land mit kleinem Budget für Militär-
ausgaben und einer seit Jahren progressiven linken Regierung. Ihr Aussenminister hat von der
Kampagne gegen Killerroboter gehört und befürwortete kürzlich in den Medien ein zügiges
Verbot oder zumindest ein Moratorium dieser neuen Waffensysteme in der Überzeugung,
dass das Leid im Krieg durch derartige Waffen nur erhöht werden wird.
Praxisbeispiel 1, Ländertyp C: Sie sind ein kleines, wirtschaftlich aufstrebendes Land in einem
volatilen regionalen Umfeld, wo nach Einschätzung von Experten der Einsatz autonomer Waf-
fensysteme dereinst den entscheidenden Unterschied in einer militärischen Auseinanderset-
zung machen könnte.
12Sie können auch lesen