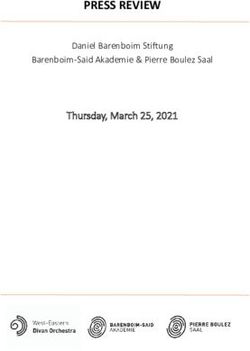Vortrag Netzwerk 19. Oktober 2016 Kinder begegnen Krankheit, Sterben und Tod
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Peter Trocha Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut
Psychotherapie – Psychoanalyse
Kunst- und Gestaltungstherapeut
Fortbildung – Supervision
Diplom-S ozialpädagoge FH
Praxis: Adelheidstraße 11, 80798 München
Tel.: 089 / 13 94 72 88
Vortrag
Netzwerk 19. Oktober 2016
Kinder begegnen Krankheit, Sterben und TodLiebe NetzwerkerInnen,
dies ist die schriftliche Form des Vortrags, den Sie am 19.10.2016 in der Heckscher Klinik gehört
haben. Ich habe die Bilder entfernt, da mir diese zu sensibel erschienen, um im Internet veröffent-
licht zu werden. Ich habe aber viele davon beschrieben, dies wird bei den Zuhörern des Vortrags
Erinnerungen wecken.
Wie bereits im Vortrag erwähnt, gibt es zu diesem Thema so viel mehr zu besprechen und zu teilen,
dass wir uns diesem an einem Fachtag 2017 zuwenden wollen.
Einleitung
Dass wir alle, die wir uns hier im Hörsaal befinden, eines Tages sterben werden, wissen wir. Wir
können davon ausgehen, dass wir morgen oder in vielen Jahren, entweder alleine oder im Beisein
unserer Familien oder Freunde, den letzten Atemzug nehmen. Wir, die wir hier sitzen und stehen,
sind auch nicht vor Krankheit gefeit. Statistisch gesehen werden 47 % von uns an Krebs erkranken,
26 % daran sterben, 1,7 % werden bei Unfällen ums Leben kommen und 1,2 % werden sich mglw.
selbst umbringen. (Statistisches Bundesamt 2014)
Dass wir dennoch die Tage genießen, uns vernetzen und fortbilden können, liegt daran, dass unsere
psychische Abwehr gute Arbeit leistet. Deshalb sei dieser überaus wichtigen Funktion an dieser Stelle
gedankt.
Wir werden heute Abend sehen, dass es viele Familien und auch Kinder gibt, denen Krankheit und
Tod sehr nahe kommen und die einerseits dringend ihre Abwehr benötigen, um im Kampf gegen
Krebs, gegen HIV, gegen chronische Krankheiten und für das Ertragen der Trauer die nötigen psy-
chischen und physischen Ressourcen zu aktivieren, die lebenserhaltend sind. Wir werden auch sehen,
dass die Abwehr zum Problem werden kann, dann wenn sie übermäßig groß ist oder übermäßig lang
aufrecht erhalten wird.
Es wird heute Abend zudem deutlich werden, dass die Kunsttherapie für die Arbeit mit der Abwehr
sehr gut geeignet ist.
Bei diesem schwierigen Thema kommen wir darüber hinaus nicht umhin, uns mit unserer – nennen
wir sie – professionellen Abwehr auseinander zu setzen, denn gerade den uns so tief bewegenden
Themen wie „Kinder, die trauern“, „Kinder, die sterben müssen“ würden auch wir als professionelle
Helfer gerne ausweichen, um uns selbst zu schützen. Deshalb suchen wir oftmals Hilfen in der The-
orie in Form von Phasentheorien, Statistiken etc., da wir primär annehmen, dass uns diese vor dem
großen Schmerz, vor der Überforderung und den massiven Unsicherheiten schützen, die die Arbeit
mit diesem Personenkreis begleiten.
Ich versuche im Folgenden, die Theorie etwas in den Hintergrund zu rücken und stattdessen die Kin-
der mit ihren Aussagen und Gestaltungen in den Fokus zu nehmen.
Das Thema dieses Abends ist hinsichtlich seines Umfangs im Grunde nicht in 60 M inuten differen-
ziert darstellbar.
Deshalb ist der Anspruch dieses Vortrags auch nicht, eine lückenlose Darstellung über Trauer- und
Verarbeitungsprozesse zu geben, sondern vielmehr uns alle ins Überlegen und später in einen ge-
meinsamen Austausch über unsere Gedanken zu bringen. Eine schriftliche Form dieses Vortrags er-
halten Sie über unsere Homepage.
M an könnte auch darüber nachdenken, ob wir uns diesem Thema einmal in einem ganztägigen Fach-
tag zuwenden wollen.
M ein persönliches Ziel für diesen Abend ist es, uns allen etwas die Angst zu nehmen vor diesen
schweren Themen und uns M ut zu machen, uns den Betroffenen persönlich wie fachlich mehr zuzu-
wenden und darüber auch in einen Austausch und in eine gegenseitige fachliche Unterstützung zu
kommen.
S.2Verarbeitung von Trauer in Phasen oder in einem Oszillieren der Zustände.
Sucht man nach Theorien zu Trauer und Trauerarbeit, trifft man schnell auf Phasenmodelle, die einem
erklären, in welchen Schritten die Trauer verläuft (von Leugnen bis Neubeginn). Zudem stoßen wir
auf Begrifflichkeiten wie „bewältigen“, integrieren“ etc. Doch was heißt dies denn genau?
Kann man einen großen Verlust wie den Verlust eines Elternteils als Kind wirklich bewälti-
gen?
Kann man den Verlust eines Geschwisters integrieren?
Kann sich die Lücke und Wunde jemals schließen, wenn sich jemand aus der Familie um-
bringt?
Und was geschieht mit den Bindungen und den Bindungserfahrungen, die Kinder mit den
verstorbenen Personen unterhalten haben. Lösen diese sich auf?
Kann ein Kind die eigene Krankheit, die Nähe zum Tod in sich so verarbeiten, dass sie keinen
Einfluss mehr auf sein zukünftiges Leben hat?
Wohl nicht.
Betrachten wir die S orge oder die Trauer um einen geliebten Menschen und den S chmerz, der
damit in Verbindung steht.
In der psychoanalytischen Theorie, genauer bei der Objektbeziehungstheorie von Kernberg, entwi-
ckelt sich die Psyche des M enschen durch die Verinnerlichung von Beziehungen, die ich als Kind
mit anderen M enschen eingehe. Diese werden Teil meines Selbst.
In uns finden sich Erfahrungen mit M ama und Papa, Oma und Opa, den Geschwistern, den Kindern
auf der Straße, den Erziehern und Lehrern etc. Und keine diese Erfahrungen, die unsere innere Struk-
tur gebildet haben, geht je verloren, auch wenn der Kontakt zu diesen Personen nicht mehr bestehen
sollte.
Aus diesem Grund kann diese innere Beziehungserfahrung auch nicht durch den Tod der Person be-
endet werden.
Und wenn der Verstorbene immer ein Teil von uns bleibt, dann wird auch die Trauer um den Verlust
dieser Person ein Teil von uns sein.
Somit sind über den Tod hinaus fortbestehende innere Bindungen sowie lebenslange Trauer sogar ein
wichtiger Teil einer gesunden Entwicklung und nicht Ausdruck eines missglückten Trauerprozesses.
Phasenmodelle suggerieren, dass der Trauerprozess ein schrittweises Voranschreiten im Abschied
sei, an dessen Ende eine „Bewältigung“, die „Integration des Verlustes“ stattgefunden hat. Trauernde
M enschen, die diesem Denken anheimfallen, kommen dann zu der Überzeugung: „Langsam sollte
ich darüber hinweg sein“ oder „Es sollte langsam weniger weh tun“. Dadurch tritt neben die Trauer
noch ein Scham- oder Schuldgefühl, die Bewältigung nicht ausreichend gut zu schaffen. Aus Sicht
vieler aktueller Autoren und auch vor dem Hintergrund meiner Erfahrungen mit trauernden Familien
ist es an der Zeit, das Denken in Trauerphasen zurückzustellen. Es gibt Schwerpunkte im Trauerpro-
zess – wie die Zeit des Leugnens und die der Annahme –, dies ist unbestritten, doch sie werden nicht
in einer Richtung durchlaufen. Sie wechseln sich vielmehr ab.
Diese Gedanken zur Trauer gelten auch für die Verarbeitung der eigenen Erkrankung. Oft sind noch
Jahre nach einer schweren Erkrankung und nach komplizierten Operationen die Gefühle dazu extrem
stark. Auch dem Kind sind sie unter Umständen erst lange Zeit später zugänglich und somit darstell-
bar. D. h. die Gefühle schwächen sich nicht automatisch mit der Zeit ab.
S.3Die Kunsttherapie bietet in diesem Prozess für mich herausragende M öglichkeiten. Tiefe Eindrücke
werden an der bewussten Ichkontrolle vorbeigeführt. Oftmals bringt ein Bild eine Wahrheit konkreter
zur Darstellung, als es die Sprache kann.
Alexander beispielsweise kann Gefühlszustände bildnerisch leichter zum Ausdruck bringen als über
die Sprache. Er ist mittlerweile 12 Jahre alt, vor 3 Jahren erhielt er die Diagnose eines gutartigen
Tumors, der an der Hypophyse sitzt. Bereits drei Tage nach der Diagnose wurde eine Punktierung
der Zyste vorgenommen (Donnerstag), am darauffolgenden M ontag erfolgte die Operation. Für den
Patienten ging dies seiner Darstellung nach zu schnell, er hat die Operationen und die Zeit im
Krankenhause in traumatischer Erinnerung. Vieles ist ihm unklar und unverständlich. Viele Fragen
hat er sich jahrelang nicht getraut zu stellen. In seiner 40. Therapiestunde sprechen wir – wie fast jede
Stunde – über die zurückliegende Erkrankung. Doch erstmalig wendet er sich von sich aus sehr klar
den damals vorherrschenden Gefühle zu. Nach dem M alprozess beschreibt er, dass er sich damals,
bei der Diagnose und zu Beginn der Krankheit, wütend (er nennt es sauer) und traurig gefühlt hat.
M it rotem Filzstift hat er das Gefühl der Wut dargestellt und für die Traurigkeit die Farbe Blau
gewählt. Er setzt anfangs in die M itte des Blattes einen kleinen Kreis, den er mittig teilt, einen Teil
davon malt er rot, den anderen blau aus. Definiert man den Kreis als Symbol des Ichs, dann wäre dies
ganz ausgefüllt von Wut und Traurigkeit.
Dann beginnt er sehr vorsichtig, vom Kreis heraus Linien anzusetzen, im Wechsel Blau und Rot.
Diese weiten sich immer mehr aus, bis sie schließlich das ganze Blatt bedecken. Er arbeitet dabei sehr
ruhig und in sich gekehrt, wirkt ernst und bei sich. M an kann sehen, wie seine Gefühle den Ichraum
verlassen, sich zeigen und alles ausfüllen.
Auf Nachfrage berichtet er mir dann, dass ganz zu Beginn der Behandlung die Angst vor der
Operation im M ittelpunkt stand. (Nun wird die zunächst benannte Traurigkeit in seiner Darstellung
zur Angst.) Das Selbst ist also ganz bestimmt von Wut und Angst.
Die anfängliche Angst vor der Operation habe sich dann in die Angst, bei der Operation zu sterben,
verwandelt. Dazu sei die Wut gekommen, denn er „wollte nicht ins Krankenhaus, war da ja auch zum
ersten M al“.
Ich frage ihn, ob ihm damals irgendwas geholfen hat, diese Gefühle auszuhalten, und er verneint.
Nun bemerkt er, dass das Gefühl der Traurigkeit in seinem Bild fehlt. Er ergänzt es als grüne Punkte,
die das gesamte Blatt überziehen. Zudem bessert er auch manche blaue Linien nach, da ihm diese zu
dünn erscheinen. Er benennt und markiert also noch einmal klar seine Gefühle.
Wir sprechen noch weiter darüber, wie er seine Eltern damals erlebt hat. Er schildert, dass diese gesagt
haben: „Das schaffen wir“. Dieser Satz gab ihm zwar Kraft, so erinnert er sich, aber es habe nie ein
Gespräch zwischen ihm und seinen Eltern darüber gegeben, wie es ihm geht. Seine Gefühle, die
Traurigkeit, die Angst und die Wut, konnte er damals niemandem zeigen und blieb lange Zeit damit
allein.
Nun kann er sie äußern, mit jemandem teilen und über das Bild auch immer wieder zur Hand nehmen.
Kommen wir zurück zu dem Trauern in Phasen:
Würden Kinder in Phasen trauern, dann ließe sich dies nicht mit den Anforderungen, die die Entwick-
lung an sie stellt, kombinieren, denn die kindliche Entwicklung fordert eine dauerhafte Auseinander-
setzung mit der Umwelt. Zu lange Trauerphasen wären unter diesem Blickwinkel entwicklungs- und
somit in gewisser Weise auch lebensbedrohlich.
Ähnlich verhält es sich mit dem Umgang von Krankheit bei einem Elternteil. Ein Junge, dessen Vater
über Jahre hinweg mit Krebs zu kämpfen hatte, musste seine M utter der Pflege des Vaters überlassen.
Die Sorge über und der Abschied vom geliebten M ann nahm sie ganz in Anspruch, sodass der Junge
eigentlich zuerst die M utter und dann den Vater verlor. In vielen Stunden nahm er sich Zeit für die
Trauer und die Angst.
S.4Der Junge sagte in der später folgenden palliativen Phase seines Vaters, unter größten Schuldgefüh-
len: „M anchmal wünsche ich mir, dass mein Papa stirbt, damit wir wieder ein normales Leben ha-
ben“.
Hilfreich, um langfristige Trauerprozesse zu verstehen, ist meines Erachtens das duale Prozessmodell
(DPM ) der Trauerbewältigung nach Stroebe und Schut, 1999 (aus: Röseberg Franziska/M üller M o-
nika (Hrsg.): Handbuch Kindertrauer. Die Begleitung von Kindern, Jugendlichen und Familien.
Vandenhoeck & Ruprecht. Göttingen 2014).
Dieses M odell beschreibt universelle Aspekte der Trauer. Dabei orientiert sich der Trauernde einmal
auf den Verlust und einmal auf die Wiederherstellung.
Die Verlustorientierung beschreibt die Hinwendung des M enschen an das Verlorene und das Zulassen
aller Trauer, aller Hilflosigkeit etc.
Die Wiederherstellungsorientierung beschreibt die Wendung des Subjekts an die Umwelt, das Um-
gehen mit den Veränderungen, die Auseinandersetzungmit den neuen Erfahrungen, die gemacht wer-
den müssen.
Etwas plastischer drückt dies Elias (4 Jahre) aus, dessen geliebter kleiner Hund eingeschläfert werden
muss. Das Kind selbst weiß nur, dass das Tier bald zu sterben hat. Während die Eltern weinend auf
dem Sofa sitzen und den Hund streicheln, um sich vor dem Gang zum Tierarzt von ihm zu verab-
schieden, ist der Umgang des Jungens mit der Trauer anders. Zunächst sitzt er dabei und streichelt
seinen Hund und sagt ihm, wie traurig er ist. Dann steht er auf und sagt: Ich geh mal spielen. Nach 5
M inuten schaut er ums Eck und fragt: Ist er schon tot? Er tritt erneut heran, weint und geht wieder.
Nach zirka wieder 5 M inuten fragt er erneut: Ist er schon platt? Und wieder treten heftige Tränen
hervor.
Später malt er ein Bild, auf dem er seinen Hund im Himmel besucht, beobachtet von einem Engel.
S.5Erkennbar wird sein Oszillieren zwischen der Verlustorientierung in Form der Trauer und der Wie-
derherstellungsorientierung, die er durch die Hinwendung an sein Spiel zeigt.
Kinder werden hierbei oft missverstanden. Sie werden als zu wenig empathisch oder als emotional
wankelmütig angesehen, aber all dies ist nicht der Fall. Das Kind begeht vielmehr eine für seine
Entwicklung notwendige und deshalb richtige Trauerarbeit.
Das duale Prozessmodell ist meiner M einung nach auch auf die Verarbeitung eigener Krankheit und
die Annahme des mglw. bevorstehenden eigenen Todes anwendbar. Auch hier ist dieses Oszillieren
erkennbar. M eine Patienten zeigen mir beispielsweise sehr deutlich, dass sie in den Akutphasen ihrer
Erkrankung nicht über diese nachdenken und sprechen wollen. (Ursprünglich hatte ich angenommen,
dass hier das Sprechen am notwendigsten sei, da der Druck am stärksten ist.)
Es wirkt so, als ob die Kinder mit aller Kraft an der Progression, ihrer Heilung und somit an der
Wiederherstellung ihrer Gesundheit arbeiten. Die Arbeit an der Trauer, am drohenden Verlust von
Gesundheit kann wohl erst wieder stattfinden, wenn das Individuum genügend Kraft gesammelt hat.
Wenn wir uns nun theoretisch vom Konzept des Trauerns in Phasen lösen und feststellen, dass jeder
Trauernde seinen Prozess des Oszillierens gestaltetet, stellt sich die Frage, ob es eigentlich auch etwas
Gemeinsames gibt, das sich beschreiben lässt. Dies kann man bejahen, denn die Trauer, die Kinder
erleben, erleben sie vor dem Hintergrund ihres Entwicklungsalters, also einer Entwicklungsphasen-
zugehörigkeit, die mit jeweils spezifischen Entwicklungsaufgaben einhergeht, und diese korrelieren
mit dem Trauerereignis. Deshalb ist es notwendig, die Trauer in den verschiedenen Entwicklungs-
phasen zu betrachten.
Verarbeitung von Trauer in den verschiedenen Altersgruppen:
Jede/r von uns greift bei der Verarbeitung von einschneidenden Erlebnissen auf Bewältigungsmecha-
nismen und -strategien zurück, die er oder sie im Rahmen der Entwicklung und der Anpassung an
spezifische Lebensumstände erworben hat. Diese spezifizieren sich mit dem Alter.
Und eine weitere Besonderheit: Der Umgang mit der Anspannung, der Trauer und der Bedrohung
orientiert sich an Ihrem Entwicklungstand bzw. der jeweiligen Entwicklungsphase, in der Sie sich
befinden.
Dadurch kommt es in Familien, die Krisen und Trauer zu bewältigen haben, oft zu großen M issver-
ständnissen, da jeder aufgrund seiner Stellung und Aufgabe in der Familie und vor dem Hintergrund
seines jeweiligen Alters und der bereits gemachten Erfahrungen den Schmerz, die Angst und die
Trauer auf verschiedene Weise verarbeitet. Oftmals sind diese Verarbeitungsweisen sogar stark ge-
genläufig.
Da die Verarbeitung der tiefen Erlebnisse vor dem Hintergrund phasenspezifischer Entwicklungsauf-
gaben (wie Aufbau von Urvertrauen, Etablierung stabiler Beziehungen, schrittweiser Ablösung von
den Primärpersonen M utter und Vater, Selbstständigkeitswerdung etc). Stattfindet, beeinflussen sich
diese eben auch gegenseitig.
Sie führen oftmals zu einer komplexen M ixtur, die zu Problemen, Fixierungen und auch zu massiven
Entwicklungsblockaden führen kann.
Sich nun allen Entwicklungsphasen in dieser Tiefe zuzuwenden, würde uns alle überfordern und des-
halb habe ich meinen Fokus auf die Arbeit mit sehr kleinen Kinder gesetzt, da diese in den theoreti-
schen Abhandlungen meist nur schwach beleuchtet werden.
Es ist auch genau diese Zielgruppe, die über die Kunsttherapie gut erreichbar ist, da Kinder in diesem
Alter die Gestaltung und das Spiel dem Sprechen vorziehen.
S.6Grundsätzlich sind es aber auch die schwierigeren Patienten/Klienten, da wir als Therapeuten eine
weit größere Übersetzungsarbeit zu leisten haben.
S äuglingsalter, Kleinkind bis 2 Jahre:
Ob und wie Kleinkinder bis 2 Jahre einen Verlust verarbeiten, war lange Zeit über strittig. Dies mag
damit zusammenhängen, dass unser Gedächtnisspeicher Erlebnisse dieser Zeit nicht sprachlich-kog-
nitiv kodiert, sondern Erfahrungen über den Körpergedächtnisspeicher abgelegt werden. Deshalb
können wir uns auch nicht kognitiv an Ereignisse zurückerinnern, die vor dem 2. Lebensjahr auftra-
ten.
M an sprach Kindern in diesem Alter auch lange Zeit ein konkretes Leiden ab, da man davon ausging,
dass sie den Verlust gar nicht verstehen. M an hat hier aber den Fehler begangen (siehe Senf und
Eggert), „ein Nichtbegreifen (ein Nichtaussprechen oder Nichtdenken) des Todes (…) mit dem Nicht-
vorhandensein einer emotionalen Wahrnehmung (einem Nichtfühlen) eines Verlustes“ gleichzuset-
zen.
Es mag sein, dass der Tod einer nahestehenden Person in diesem Alter zwar nicht kognitiv verstanden
wird, aber – vielleicht gerade deshalb – das Verlusterleben ein weitaus größeres ist, da es sich mit
den Gefühlen des Verlassenwerdens und Verlassenseins kombiniert. Und gerade diese Gefühle sind
für den Säugling und das Kleinkind nur schwer auszuhalten.
Wenn ein Säugling, ein Kleinkind im Alter bis zu 2 Jahren mit dem Tod eines Elternteils konfrontiert
wird, dann erlebt es, dass ein überaus wichtiger M ensch, und zwar der, der für die Sicherheit im
Leben, für das Regulieren jeder seiner Spannungszustände verantwortlich war, plötzlich nicht mehr
da ist.
Dass jemand weggeht, dann aber auch wiederkommt, das lernt schon der Einjährige: Geht die M ama
aus der Tür, dann kommt sie, meist durch dieselbe Tür, auch wieder zurück. M an muss nur manchmal
ganz lange draufstarren. Aber nun, in diesen tragischen Fällen, kommt die M ama eben nicht mehr
zurück. Sie bleibt verschwunden.
Dadurch werden die Präkonzepte, die das Kind gerade über die Verlässlichkeit von Beziehungen etc.
entwickelt, massiv erschüttert.
Im Alter von 2 Jahren lernen die Kinder zudem die eigene Wirkmächtigkeit kennen. Die Kinder
erleben, dass sie mit ihrem Tun, ihrem Schreien oder Weinen, andere M enschen herbeirufen und
verfügbar halten können. Und das Kind nimmt an, dass es dies vor allem mit seiner Hinwendung, mit
seiner Zuneigung zu der Person erreicht. Erlebt das Kind nun, dass Schreckliches passiert, z.B. eine
Erkrankung, viele Operationen, der Verlust von M ama etc., ohne dass es darauf Einfluss hat, kann
dies zu einer großen Resignation führen und eine massive Verunsicherung im Erleben der eigenen
Wirkmächtigkeit nach sich ziehen.
Ist das Kind selbst in diesen frühen Jahren einer bedrohlichen Erkrankung ausgesetzt, durchlebt es
selbst intensivmedizinische M aßnahmen, dann bleiben auch diese Erfahrungen im Kind gespeichert
– allerdings nicht sprachlich kodiert, sondern auf einer körperlichen Ebene. Das Kind kann diese
Erlebnisse später nicht kognitiv abrufen, sie wirken aber dennoch nach.
Ist das Kind irgendwann erneut mit den Gefühlen von Alleinsein oder großer Angst konfrontiert, so
kann sich die früh erlebte Panik des Säuglings im Kind reaktivieren und eine Angstreaktion massiv
verstärken.
Betrachten wir hier nun die Ängste von Kindern, können wir feststellen: Wenn ein Kind in diesem
frühen Alter eine Bezugsperson verliert, kann sich diese tiefe Angst generalisieren. Wenn einer plötz-
lich verloren geht, kann das Kind aus dem Verlust ableiten, dass auch jeder andere plötzlich ver-
schwinden kann.
S.7M it Anklammerung, Ängsten und stark regressiven Verhaltensweisen kann das Kind darauf reagieren
und darlegen, dass das noch unausgereifte Ich auf einer unbewussten Ebene versucht, einem erneuten
Verlust vorzubeugen.
Bei Eingriffen in die Körperintegrität und Selbstbestimmung zeigen sich vergleichbare Wirkungen.
Erleben kleine Kinder diese Schicksalsschläge, ergeben sich für Eltern, aber auch für alle begleiten-
den Therapeuten im Wesentlichen 2 Schwierigkeiten.
Da Kinder in diesem frühen Alter ihre Emotionen nicht formulieren können, gilt es diese aus
Erscheinungsbildern wie Schreien, starke Unruhe, verändertes Schlaf- und Essverhalten (etc.)
herauszulesen.
Und da das Kind jenseits seiner Kognition leidet, darf auch die Beantwortung des Kindes nicht die
Kognition fokussieren. Dies bedeutet, dass
die starken emotionalen Reaktionen des Kindes vom jeweiligen Gegenüber gemeinsam mit
dem Kind ausgehalten werden müssen. Im Denkmodell von Bion (dies würde am Fachtag
genauer erklärt werden) bekommt der Erwachsene sogar die Aufgabe, diese Gefühle, die dem
Kind so unaushaltbar sind, stellvertretend zu containen und somit für das Kind zu verarbeiten.
(Welch eine Herausforderung und eben auch Überforderung dies für eine verwitwete M ama
oder einen Papa darstellt, die selbst gerade in tiefster Trauer und vielleicht sogar zudem in
existentieller Not sind, muss nicht näher dargelegt werden.)
Kleinkind 2 bis 4 Jahre:
Etwas ältere Kinder (2 – 4 Jahre) wissen schon mehr über den Tod, sie haben schon einmal tote Tiere
gesehen und können das Belebte vom Unbelebten kognitiv unterscheiden. Der Begriff von „Tod“
oder von „tot sein“ formt sich nun etwas.
In diesem Alter glaubt man jedoch noch immer an die Reversibilität des Todes. M an hält das Weg-
gehen für umkehrbar. Das magische Denken dieser Phase lässt viele Kinder glauben, dass sie sich
eine Wiederkehr des Verstorbenen oder dessen Gesundheit oder die eigene Gesundheit nur stark wün-
schen müssten und dann brächte der liebe Gott oder das Leben, wie ein magisches Christkind, den
Verstorbenen oder die eigene Gesundheit zurück.
„Tot sein“ heißt für Kinder in diesem Alter vor dem Hintergrund ihrer Erfahrungen „weg sein“. Und
wer weg ist, kann auch wiederkommen, das haben sie mittlerweile in ihrem Leben gelernt. So besu-
chen sie nun den Kindergarten und können aushalten, dass sie eine Zeit ohne M ama verbringen, aber
dieses Aushalten gelingt nur, da sie in sich die Sicherheit tragen, dass die M ama wiederkommt.
Dieses Denken wird nun auch auf den Tod übertragen. Deshalb können Kinder in diesem Alter z.B.
nach der Beerdigung des Onkels fragen: „Und wann kommt uns der Onkel Hans wieder besuchen?“
Da die Kinder den Tod in diesem Alter noch reversibel, also nicht als endgültig begreifen, fürchten
sie ihn in der Regel auch nicht, weder bei sich noch bei den anderen.
Kinder von 4 bis 6 Jahren
Der zunehmend wache und explorierende Geist dieser Altersgruppe will nun zunehmend die Dinge
und somit auch den Tod verstehen.
Das Kind denkt nun über den Tod mit all seinem kindlichen Wissen und seinen intuitiven Denkweisen
nach. So beschäftigt einen fünfjährigen Jungen die Frage, wie die Oma denn im Himmel weiterleben
S.8soll, da sie doch vorhat, sich nach ihrem Tod verbrennen zu lassen. „Das ist doch Quatsch“, sagt er,
„das geht ja dann gar nicht mehr, da hat sie ja dann gar keinen Körper mehr, da ist sie ja dann nur
noch Rauch.“
In diesem Alter wird zudem angenommen, dass die Bedürfnisse eines Lebewesens auch nach seinem
Tod fortbestehen. So soll ein Tierchen zugedeckt werden, damit es nicht friert, und natürlich wird
dem Hamster auch Futter und Heu mit ins Grab gelegt, weil Hungern soll er ja nicht. (Diese Zuwen-
dungen stellen darüber hinaus wichtige Rituale des Abschiednehmens dar und sind auch noch in er-
wachsenen Handlungen vorhanden, z.B. in der Innendekoration des Sargs oder der Auswahl des Lieb-
lingsgewands, das der Tote tragen soll.)
In diesem Alter steigen durch die Ichreifung die Konflikte mit der Umwelt, mit den Bezugs- und
Erziehungspersonen. Dies führt dazu, dass sich im inneren Konzept des Kinds langsam das Wissen
um Zusammenhänge von sozialen Interaktionen und somit auch von Schuld niederschlägt. Da Kinder
dieses Wissen wiederum verallgemeinern, nehmen sie in diesem Alter schnell an, sie könnten schuld
an allem und somit auch am Tod des anderen sein.
Dadurch kombiniert sich in diesem Alter der Schmerz oft mit der Schuld! Auch die eigene Erkran-
kung wird oft eigenschuldhaft erlebt. So äußert sich ein M ädchen im Spiel als Ärztin zu der Puppe,
die sie untersucht: „Schäm dich, dass du so hohes Fieber hast!“
Die stark egozentrische Weltsicht dieses Alters und die noch magischen Vorstellungen von den Din-
gen führen im Kind auch dazu, dass es glaubt, die Dinge wieder in Ordnung bringen zu können, wenn
es dies nur genügend möchte.
Für Krankheit heißt dies aus kindlicher Sicht: Wer nur stark genug will, wird wieder gesund.
Für den anstehenden Abschied von einer wichtigen Person bedeutet dies: Wenn ich eine Tren-
nung nicht will, dann kann ich diese mit meinem Wollen auch verhindert.
Welche Realitätsferne diese Gedanken haben, zeigt ein sechsjähriger Junge, wenn er bezogen auf die
anstehende und unausweichliche Trennung/Scheidung seiner Eltern sagte: „Ich bringe das alles wie-
der in Ordnung.“ Als ich ihn frage, wie er das erreichen wolle, antwortet er: „Ich mache dann halt
so Sachen, so lustige Sachen, damit mein Papa und meine Mama lachen müssen und dann, dann
kommt das alles wieder in Ordnung.“
M eine Erwiderung, dass es ein Kind, so lieb es beide Eltern auch hat und sosehr es sich auch an-
strengt, nicht schaffen kann, dass die Eltern zusammenbleiben, übergeht er und betont nochmals:
„Wenn ich mich nur genug anstrenge, kann ich das alles wieder in Ordnung bringen.“
Diese Art des Denkens führt dazu, dass Schuld- und Schamgefühle entstehen, wenn eine Krankheit
nicht aufgehalten werden kann. Sogar ein Todesfall in der Familie wird als eigenes Versagen defi-
niert.
Hatte man mit jemandem gestritten oder etwas Schlechtes über jemanden gedacht bzw. gesagt und
dieser stirbt dann, fühlen sich Kinder noch schuldiger.
Da diese Prozesse sehr schamhaft verlaufen, erfahren wir Erwachsenen davon oft nichts.
Beispiel Niklas:
Ein 5-Jähriger Junge hatte zeitlebens zu seinem Vater eine schwierige Beziehung. Der Junge war der
M utter sehr nahe und stand zu dem Vater immer schon in einer massiven Konkurrenz.
Der Vater erkrankte an Krebs und dem Jungen war es nicht möglich, ihn zu besuchen. Als der Vater
im Sterben lag, wollte er seine beiden Söhne ein letztes M al sehen. Als der Junge den Vater, der durch
den Leberkrebs deutlich gezeichnet war, seine Haut hatte sich leicht verfärbt, nun im Krankenhaus
S.9sah, rannte er schreiend aus dem Zimmer mit dem Satz, dass der Vater sich in ein M onster verwandelt
habe, welches ihn fressen wolle.
In der Therapie durfte man kein einziges Wort über den Vater verlieren und auch nicht die veränder-
ten Lebensverhältnisse der Familie ansprechen. Der Junge verleugnete seine Affekte und spaltete
diese kontinuierlich ab. Bei leichtem Drängen legte er gewöhnlich die Hände auf die Ohren und fing
an, laut zu singen. Dabei wirkte er verloren und unglücklich.
Auf einem Familienbild tritt er selbst als gefährliches Krokodil auf, das im Bildgeschehen die M utter,
dargestellt als Fisch, dominiert und unter sich drückt. Den Bruder gestaltet er als Paradiesvogel, den
Vater als Biene. Beide männlichen Familienmitglieder frisst der Junge in seiner Fantasie mehrfach
auf. Den Bruder zweimal, den Vater neunmal. Dabei kommt er in einen fast manischen Rausch, der
aus meiner Sicht alle Trauer, Schuld und Vergeltungsangst verdeckt. M an sieht bei ihm deutlich, wie
sich die Trauer mit der ödipalen/der narzisstischen Angst vermischt und man erfährt, wie groß die
Ängste in der Vorlatenz sein können, wenn sich die Realitätswahrnehmung mit dem magischen Den-
ken und der regen Fantasie des Alters mischt.
S chulkinder 6 bis 9 Jahre:
M it 6 Jahren, im Alter des Schulkindes, wird der Tod deutlicher und sicherer konzipiert. Das vom
Tod weder Familienmitglieder noch man selbst verschont wird, ist den Kindern dieses Alters nun klar
denkbar.
In dieser Zeit – nicht umsonst beginnt hier die Schullaufbahn – entwickeln die Kinder ein gesteigertes
Interesse an der Welt, den Dingen und daran, wie diese funktionieren. Er wird experimentiert, gebas-
telt und vor allem gefragt. So haben die Kinder in diesem Alter ein recht nüchternes Interesse am
Tod. Sie wollen möglichst viel über Gräber, Friedhöfe, Beerdigungen und Tote wissen, wie diese
aussehen, wie wie daliegen etc.
Dadurch entstehen für uns Erwachsene oft sehr unbequeme Fragen .
Die Kinder wirken auf uns nüchtern, nahezu emotions- und eben auch pietätlos, doch dies muss vor
dem Hintergrund des extremen Wissendrangs dieser Entwicklungsstufe verstanden werden.
Beispiel:
Ein 8-jähriger Junge antwortet auf die Frage, was denn mit den Sterbenden im Tod passiert, sehr
überlegt: „Sie gehen in einen Himmel. Die Leiche, die bleibt da (er überlegt), und ja, die Seele wird
an ein anderes Baby weitergeleitet und das Baby ist dann im Bauch drin und die Leiche legt man ins
Grab und die wird dann aufgelöst und geht in den Himmel.“
M it dem Wissen, dass der Tod jeden erreichen kann, nimmt nun aber auch die Angst vor dem eigenen
Tod zu sowie davor, wichtige Bezugspersonen zu verlieren.
Dabei dominieren als mögliche Todesursachen vor allem Gewalteinwirkung und Unfälle. (M glw.
spiegeln diese Ängste auch fantasierte Strafen für ihre expansiven Bestrebungen wider.)
Taucht der Tod oder die Bedrohung durch den Tod in diesem Alter in Bildern auf, wird er meist in
symbolischer Form dargestellt. Der Tod wird hier oft personifiziert, er ist der Böse, der Skelettmann,
der Teufel etc. Diese treten meist in Szenen auf, die einen Schrecken beinhalten. (In der Phase vorher,
der magischen Zeit, der Zeit der Kopffüßler, wird meist die Angst selbst gemalt, als Fratze oder als
Schrei o. Ä.)
S.10S chulkinder 9 bis 12 Jahre:
Ab ca, 9 Jahre ist den Kindern klar, dass der Tod endgültig ist, dass niemand die M acht hat, den Toten
zurückzuholen. Kinder können nun denken und verstehen, was mit dem toten Körper passiert. Dies
kann neue Ängste und Sorgen entstehen lassen. Denn nun ist klar, dass die verstorbene M ama in
ihrem Sarg in der Erde nicht schläft, sondern dass ihr Körper sich auflöst, zum Skelett wird und dass
sogar dieses sich mit der Zeit ganz in Erde verwandelt.
In diesem Alter steigt der Wunsch an der sachlichen und eben auch nüchternen Auseinandersetzung
mit der Welt noch einmal. Die Welt soll über den Verstand begriffen werden.
Es geht den Kindern in diesem Alter beim Sprechen und Denken über den Tod auch um die biologi-
schen Hintergründe: Wie verändert sich der Körper eines Toten? Was passiert bei der Verwesung?
Warum bleiben die Knochen übrig? etc.
Kinder wollen nun genau hinsehen, wollen einen Toten sehen, tote Tiere anfassen und am liebsten
untersuchen.
Sie machen sich auch Gedanken über die Dualität von Körper und Seele, was geht in den Himmel
und wie?
Da der Tod auch als sehr unterschiedlich zum Leben erkannt wird, ist er den Kindern bei allem sach-
lichen Interesse auch unheimlich. Dieser Spannung wenden sie sich zu, wenn sie Gruselgeschichten
lesen und hören. Kinderbücher wie „Harry Potter“ bedienen diese Lust, indem sie eine geeignet e
Kombination aus Schauer und Angst hervorrufen.
Dass sie selbst sterben könnten und auch einmal werden, „aber erst wenn ich ganz alt bin“, ist für sie
denkbar.
Beispiel:
Dass das eigene Schicksal den Tod betreffend schwer zu ertragen ist, zeigt uns M ., ein Junge im Alter
von 10,5 Jahren, der mit 6 Jahren an Krebs erkrankt war. Er sagt: „Wenn man stirbt, ist man tot.“ Er
erschrickt über seinen eigenen Satz und ergänzt sehr betroffen: „M anchmal finde ich es schade, dass
ich nicht gläubig bin.“ Denn wäre er es, so ergänzt er, könnte er sich einen schönen Ort wie einen
Himmel fantasieren und dies würde ihm sicherlich die Angst nehmen.
Jugendliche
Jugendliche habe nun langsam dasselbe Wissen und Denken über den Tod wie die Erwachsenen er-
langt.
Der Tod als trennendes Ereignis ist für die Jugendlichen ein wichtiges Thema. Sie beschäftigen sich
mit der Frage: Was kommt danach? Sie suchen nach Antworten in den verschiedenen Religionen
oder Heilslehren und stellen eigene Jenseitsgebilde und Sinnkonstruktionen auf. Im jugendlichen
Denken, im Sinnieren und im philosophischen Grübeln findet auch der Tod einen Platz in der inneren
Gedankenwelt.
Trauererlebnisse triggern in diesem Alter die der Entwicklung immanente Trennung, Loslösung und
das Abschiednehmen von den idealisierten Eltern und der Kindheit an sich.
Da die Pubertät als Entwicklungsphase an sich eine große Traurigkeit enthält, wird erlebte Trauer oft
noch potenziert. So erklären sich auch die teilweise hysterisch anmutenden Reaktionen Jugendlicher
bei gemeinsamer Trauer nach Katastrophen oder dem Tod eines Popstars.
In Trauerwachen und Andachten wird in der Peergroup getrauert, geweint und gesungen. M it Er-
wachsenen wird dieser Schmerz nicht geteilt, da wohl nur Gleichaltrige den Urschmerz mitempfinden
können, auf den sich noch die reale Trauer setzt.
S.11Vorwiegend bei den männlichen Jugendlichen herrscht die Tendenz vor, nach außen möglichst cool
zu wirken. Gerade die angehenden M änner setzen Trauer mit Schwäche und Verletzbarkeit gleich.
Dies sind Gefühle, die sie kennen, aber nicht gern bei sich haben möchten.
In de Arbeit mit den Jugendlichen, meist sehr ungern auch malen lässt sich gut mit den Träumen
arbeiten und mglw. lassen sich diese Traumbilder auch konkret bildnerisch darstellen.
Beispiel Daniel: Daniel hat seine M utter vor einigen Jahren durch einen Unfall verloren. Da er jüngere
Geschwister hat, denkt er, dass er das Leid mit ganz viel Kraft tragen muss, um den anderen ein
Vorbild und eine Hoffnung zu sein. Er hat deshalb den Tod der M utter für sich allein zu bewältigen
versucht und darüber depressive Züge entwickelt. In Träumen tritt er als Kämpfer auf, der sich durch
wüstenartige Einöden schlagen muss „und dann sind wir so durch einen Gang gekrochen, der führte
durch so einen Berg, also nicht durch einen so hohen, und dann kam man raus und da war nur so ein
kurzer Bereich (zeigt mit den Armen einen halben M eter) und dann war der Abgrund und ich bin
dann wieder in den Tunnel rein und die anderen waren alle weg und dann bin ich aufgewacht."
Dieser Traum zeigt für mich die große Bedrängnis des grüblerischen, eher depressiv gestimmten Jun-
gen. Die Trauer über den Tod der M utter konnte er nicht leiten, da er sich als Vorbild für seine jün-
geren Geschwister sah. Wie sollten diese mit dem Verlust klarkommen, wenn er daran zerbräche. Für
seine Geschwister spiele er den Starken, vielleicht auch den unbesiegbaren Kämpfer des Traums. Die
Gefahr, die auf ihn wartet, wenn er aus seinem Tunnel herausgeht, wenn er sich aufrichtet und sich
dem Leben und somit auch der Trauer stellt, ist für mich im Traumbild beinhaltet.
Wenden wir uns nun zwei Besonderheiten im Trauerprozess von Kindern zu: dem S uizid eines
Familienmitglieds und dem Tod eines Geschwisters.
S uizid eines Familienmitglieds:
Wird eine Familie vom Suizid eines Familienmitglieds oder einer nahestehenden Person getroffen,
wird die Bewältigung zusätzlich herausgefordert.
Wie bei einem Unfalltod werden die Hinterbliebenen der Chance zur inneren und äußeren Vorberei-
tung beraubt. Die Plötzlichkeit und die fehlende Vorbereitung lösen bei den Hinterbliebenen oft stär-
kere emotionale Reaktionen aus. Zur Trauer kommen noch massive Selbstzweifel wie: „Habe ich
etwas übersehen?“
Handelt es sich bei dem Suizid um eine Aktion nach langem Leiden, wird die Trauer dadurch er-
schwert, dass die Zeit im Vorfeld meist sehr angespannt war. Denn wie bei einer körperlichen Er-
krankung zieht auch das psychisch kranke oder psychisch belastete Familienmitglied viel Aufmerk-
samkeit auf sich.
Die „gesunden“ Erwachsenen, Kinder oder Jugendlichen erhalten dadurch weniger Aufmerksamkeit,
was die Trauer dann mit anderen Gefühlen durchmischt (schlechtes Gewissen, da man oft böse Ge-
danken dem anderen gegenüber hatte; Schuldgefühl, weil man das Leiden des anderen nicht ernst
genug genommen hat etc.).
Kinder kommen zudem häufig in eine Stützfunktion den anderen Familienmitgliedern gegenüber.
Ältere Geschwister stützen die kleineren und wollen deshalb auch ihre Trauer nicht offen leben, um
die anderen nicht zusätzlich zu belasten.
Grundsätzlich lässt sich sagen: „Das Grundvertrauen in die Zuverlässigkeit einzelner M enschen und
sogar in die Gerechtigkeit des Lebens überhaupt wird durch eine Selbsttötung erschüttert.“ (Chris
Paul: Kinder und Jugendliche als Trauernde nach einem Suizid, in: Kinder trauern, S. 195)
S.12Der Verlust durch suizidalen Tod geht meist auch noch mit zusätzlichen Unannehmlichkeiten
einher:
M eist wird die Nachricht des Todes von uniformierten Polizisten überbracht, die unter Um-
ständen auch nachts kommen. (So hat ein Junge im frühen Schulalter gehört, wie die Polizis-
ten nachts kamen und der M utter vom Tod des im Ausland lebenden Vaters erzählt haben.
Der Junge hörte dies alles mit, die M utter versuchte ihn aber zu schützen, indem sie ihm den
Tod zunächst verschwieg. Sie wollte es ihm erst am Wochenende mit Zeit und Ruhe mitteilen,
zudem hatte der Junge 2 Tage später Geburtstagund auch dieser sollte frei von diesem Ereig-
nis gehalten werden. So lebte die Familie noch Tage im Wissen um den Verlust zusammen,
ohne miteinander zu reden. Am darauf folgenden Wochenende spielte der Junge den Über-
raschten, damit nicht klar wurde, dass er nachts gelauscht hatte.
In der Regel folgen auf die polizeiliche M itteilung des Suizids Vernehmungen und Untersu-
chungen, um die Eigentötung abzusichern und einen evtl. vertuschten M ord auszuschließen.
Hierbei kann es sogar dazu kommen, dass die Hinterbliebenen getrennt voneinander befragt
werden und auch lange isoliert warten müssen.
Es kann zu Beschlagnahmungen von persönlichem M aterial kommen.
Die Beisetzung wird oft hinausgeschoben, bis der Freitod auch rechtsmedizinisch eindeutig
abgesichert ist.
Beim Verlust durch Suizid tauchen zudem viele Fragen auf, da das Geschehen meist zurückgezogen
stattfindet und in der Regel keine Zeugen anwesend sind.
Wie waren die letzten M inuten für den Vater, für die M utter?
War er/sie traurig?
Fühlte er/sie sich allein?
Hat er/sie an mich gedacht? und letztlich:
Warum hat er/sie das getan?
Diese Fragen, die sich nicht beantworten lassen, bekommen oftmals eine so hohe Bedeutung, dass
die Trauer über den Verlust dadurch aufgeschoben wird.
Für die hinterbliebenen Kinder ist noch einmal wichtig, dass man ihnen klar vermittelt, dass sie kei-
nerlei Schuld am Suizid tragen.
Gerade dann, wenn sie noch im Vorschulalter sind, treibt das magische und egozentrische Denken
sie in Verantwortlichkeiten und Schuldgefühle.
Deshalb ist gerade beim Suizid die Klärung von Verantwortlichkeiten in der Trauerarbeit bedeutsam.
Es muss dem Kind in geeigneter Weise die Ursache für den Suizid und die Verantwortlichkeit des
Erwachsenen dargelegt werden.
„Suizide sind von denen, die sie begehen, vermutlich eine Aussage über sich selbst. Aber ihre Ange-
hörigen und Freunde lesen sie als Aussagen über die Beziehungen zu ihnen. Selbsttötungen werden
von den Zurückbleibenden als grundlegende Zurückweisungen erlebt.“ (Chris Paul: Kinder und Ju-
gendliche als Trauernde nach einem Suizid, in: Kinder trauern, S. 194)
Nicht selten erzeugt der Suizid aus Sehnsucht nach dem Verstorbenen, aus Überforderung, M utlosig-
keit und aus dem Wunsch einer Klärung sowie der Befreiung aus Schuldgefühlen einen Nach-Sterbe-
Wunsch aus, der eine große Gefahr mit sich bringt.
S.13Tod eines Geschwisterkinds
Der Tod eines Geschwisters entlässt die Hinterbliebenen in eine sehr schwere Zeit und fordert eine
Verarbeitung, die sich aus folgenden Gründen noch komplizierter gestaltet:
Geschwister haben untereinander – auch wenn es oft zu Streitereien kommt – eine sehr intensive
Beziehung. Sie sind miteinander groß geworden und es gibt häufig niemanden, der so viel von
ihnen weiß und sie so versteht wie Bruder oder Schwester. Der Tod schafft hier eine Lücke, die
niemand schließen kann.
Beim Tod eines Kinds nach langer Krankheit war die Aufmerksamkeit der Eltern stark auf das
kranke Kind fixiert. M eist verbringt ein Elternteil, in der Regel die M utter, die meiste Zeit im
Krankenhaus. Das Geschwister ist beim Vater, bei Großeltern, bei Freunden untergebracht. Zeit-
lich und emotional sind die Eltern für die gesunden und überlebenden Kinder nur schwer erreich-
bar. Aus ihrer Sicht dreht sich alles um das andere, das kranke Kind und sie nehmen an, dass auch
alle Liebe der Eltern diesem Kind gilt. Das überlebende Kind fühlt sich unwichtig.
In den Familien kommt es hier zu ein Konfusion der Gefühle und Szenen.
Beispiel:. Eine M utter berichtete sehr offen und auch sehr schuldvoll, dass ihr das kranke Kind
früher eher immer ferner war als das gesunde. Durch die intensive Zeit der Krankheit sind M utter
und Tochter sich aber nähergekommen und am Ende hatte die M utter das Gefühl, dass eigentlich
das „falsche Kind“ sterben muss.
Dauert das Leid in den Familien sehr lange an, kann das überlebende Kind den Tod des Geschwis-
ters auch mit Erleichterung aufnehmen, was wiederum starke Schuld- und Schamgefühle auslöst.
Beispiel: Ein 15-Jähriger spricht über die Situation nach dem Tod seiner Schwester, der nun über
ein Jahr zurückliegt. Er formuliert seinen größten Wunsch: „dass meine Schwester wieder da ist“,
dann rutscht ihm noch ein Nachsatz heraus: „Aber es hat auch Vorteile.“ Er erschrickt,
entschuldigt sich und schämt sich sichtlich für diese Aussage und stellt dann richtig: „Wäre sie
noch da, dann wäre sie verkrüppelt“. Später fügt er noch an: „Der Tod war Erlösung.“ Weiter sagt
er, mehr an sich als an mich gerichtet: „M eine Schwester hat sich auch den Tod gewünscht, wie
ich.“
Das Leid in der Familie ist groß, die Stimmung gedrückt, aber die Kinder haben auch den Wunsch,
ihre Fröhlichkeit wiederzuerlangen – meist schneller als die Erwachsenen. Die Kinder fühlen sich
wegen ihres Wunschs nach Unbeschwertheit schuldig, v.a. dann, wenn dies von den Eltern als
mangelnde Empathie, fehlende Liebe oder mangelnde Trauer für bzw. um das verstorbene Kind
verstanden wird.
Da eine Geschwisterbeziehung nicht nur aus Nähe und Liebe, sondern auch aus Streit, M issgunst,
Neid und Rivalität besteht, lässt die Verarbeitung des Tods des Geschwisters und die Erinnerung
daran oft auch Schuldgefühle darüber entstehen, zu dem Geschwister nicht netter gewesen zu sein
etc.
Der Tod des Geschwisters erschüttert den Glauben an die eigene Unverletzlichkeit, an die Vor-
stellung, dass der Tod nur fremde Erwachsene oder alte M enschen ereilt. Es kann nun eine über-
steigerte Angst auftreten, ebenfalls zu sterben. Bei Verlust des Geschwisters durch Krankheit
kommt es oft zur Angst, genau an der gleichen Krankheit zu sterben.
S.14 Die Trauer der Eltern ist für die hinterbliebenen Kinder nur schwer auszuhalten, sie möchten die
Eltern trösten, aber das gelingt ihnen natürlich nicht. Deshalb fühlen sie sich wiederum mangel-
haft und ungenügend. Kinder beginnen dann häufig, das verstorbene Kind nachzuahmen, um es
den Eltern zu ersetzen.
Ferner entwickelt sich oft die Haltung „Ich muss jetzt ganz lieb sein“, dadurch wird aber alle
Aggression, die zum Trauerprozess gehört, unterdrückt.
Es kann auch die Frage auftauchen, ob es besser und für die Eltern weniger schlimm gewesen
wäre, wenn man selbst gestorben wäre.
Vor der jeweils spezifischen M ixtur dieser Gefühlsanteile muss das Kind trauern und von der
Schwester/vom Bruder Abschied nehmen.
Wie erleben Kinder das Auftreten einer eigener Erkrankung oder die eines Familienmitglieds?
Die Diagnose einer unheilbaren oder nur schwer heilbaren Erkrankung eines Kinds oder Familien-
mitglieds fordert von der gesamten Familie größte Kraft.
Durch nur eine Untersuchung kann sich der gesamte Blick auf die Welt und darauf, was wichtig ist,
verändern. Immer wieder berichten Eltern von Kindern mit Leukämie, dass sie zum Kinderarzt gin-
gen, da das Kind sich schlapp fühlte und plötzlich blaue Flecken auftraten. Bereits abends fanden sich
dann viele Familie auf den Krebsstationen der M ünchner Kinderkliniken wider.
Rasch gilt es nun, Entscheidungen über die Behandlungsform zu finden. Von den Eltern werden Ent-
scheidungen und dann die M itarbeit, die Compliance, erwartet. Die eigenen Gefühle und die Verar-
beitung der Vorkommnisse müssen darüber oft zurückstehen.
Dies ist mit ein Grund, weshalb die Schwere und die Ernsthaftigkeit der Erkrankung gegenüber den
betroffenen Kindern meist nicht thematisiert werden. Eltern wie auch Ärzte und Pflegepersonal ver-
suchen, das Kind vor den oft schwierigen Wahrheiten zu schützen, wohl auch, um sich selbst zu
schützen.
Deshalb wird oft die Schwere von Untersuchungen und Behandlungen abgeschwächt. Spritzen und
Infusionen „pieksen“ dann nur ein bisschen.
Für die gezeigte Tapferkeit wird man als Kind belohnt, die nicht gezeigte Angst, der verschwiegene
Schmerz und auch die immanente Aggression werden meist übersehen.
Nochmals sei betont, dass Eltern, Ärzte und Pflegepersonal hier nicht unempathisch agieren, sondern
ganz im Bestreben handeln, es dem Kind – und darüber sich selbst – zu erleichtern.
Ohne dass es jemand beabsichtigt, ganz unbemerkt, baut sich so ein Konstrukt auf, das die Kinder
stark verunsichert.
Sie empfinden natürlich Schmerzen, werden aber für ihre Tapferkeit, also für die Unter-
drückung ihres Schmerzes gelobt.
Sie haben Angst und zeigen diese nicht.
Sie haben Fragen, die sie nicht stellen und die dadurch in ihnen unbeantwortet bleiben.
Und:
Sie finden kein Gegenüber, niemanden, der ihre Wut und all ihre schier unerträglichen
Affekte aufnimmt.
S.15Letztlich bleiben sie mit ihren Sorgen und Gedanken allein und diese können nicht sichtbar werden.
In der kunsttherapeutischen Arbeit dürfen diese verdeckten Gefühle jedoch sichtbar werden. Sie se-
hen hierzu ein Beispiel von M ax, einem siebenjährigen Jungen, der im Gespräch darstellt, dass es
ihm in der Ambulanz, die er monatlich besucht und in der er untersucht und behandelt wird, „natür-
lich“ sehr gut gefällt.
Im Gegensatz hierzu steht der von ihm im Anschluss gezeichnete Junge. „Der hat sich über das
Krankenhaus geärgert. Über Verband, Spritze. Der schimpft, weil das wehtut! Ist wütend!“
Die von ihm gezeichnete Figur zeigt neben ihrer Wut, die vor allem im Kopfbereich ausgedrückt
wird, auch ihre Hilflosigkeit. Die Arme und Beine sind dünn, der Körper ist transparent und der Hals
so schmal, dass er den Kopf kaum zu tragen imstande ist. Hinter dem dargestellten Protest scheint für
mich auch das verborgene Leid der Einsamkeit durch.
Verwirrung und „kognitive Dissonanz“ n. Festinger
Wie Frau Weibel von Kona in ihrem Vortragsteil dargestellt hat, werden Kinder in den Diagnosege-
sprächen und den Behandlungen mit verschiedenen, sich teilweise widersprechenden Aussagen kon-
frontiert. Dies bleibt nicht ohne Auswirkung auf ihr psychisches Erleben. Verschiedene Einstellungs-
theorien (Heider, Osgood/Tannenbaum, Festinger) belegen, dass der M ensch ein Gleichgewicht sei-
ner Kognitionen anstrebt. Er ist bestrebt, Harmonie und Konsistenz in seinen Kenntnissen über sich
selbst, sein Verhalten und seine Umwelt zu erreichen. Disharmonische Informationen, wie hier
„krank und gesund“, führen hingegen zu einer psychischen Spannung, Festinger nennt diese kognitive
Dissonanz.
Der M ensch ist nun bestrebt, diesen unangenehmen Zustand zu beenden und wieder eine Harmonie
der Kognitionen herzustellen. Das Kind muss mit seinen dissonanten Wahrnehmungen wie „Ich bin
krank – ich bin gesund“ und „Alle sagen, es geht gut voran, schauen aber immer so besorgt“ umzu-
gehen lernen.
Festinger führt verschiedene Strategien auf, die der M ensch anwendet, um die Dissonanz zu reduzie-
ren. Diese sind jedoch davon abhängig, ob der M ensch sich nach seinem freien Willen verhalten
kann und ob andere Verhaltensweisen und Kognitionen, die ordnend und erklärend wirken können,
für ihn anwendbar sind.
Diese Freiheiten sind Kindern in Akutphasen ihrer Erkrankung und auch chronisch kranken Kindern
jedoch nicht gegeben. Die herrschende Atmosphäre macht es den Kindern meist unmöglich, sich
Eltern und Ärzte vertrauensvoll und fragend zuzuwenden. Auch die Erwachsenen führen diese Ge-
spräch nicht aktiv herbei. So werden die Kinder unbeabsichtigt dauerhaft in dieser psychischen Span-
nung belassen.
Therapeutische Ziele
Die therapeutischen Prozesse mit Kindern, die selbst erkrankt sind oder die Krankheit in der Familie
zu verarbeiten haben, laufen auf verschiedenen Ebenen. Genannt werden hier einige Aspekte, die je
nach Fall und je nachdem, was ein Kind braucht, in verschiedener Intensität auftreten:
Zunächst brauchen die Kinder ein Gegenüber, das eine Sicherheit und einen Schutzraum kre-
ieren kann, in dem die Auseinandersetzung mit den so schwierigen Themen möglich ist/wird,
und dem sie sich mit allen Gefühlen und Fragen zumuten können.
S.16 Sie brauchen ein Gegenüber, das in der Lage ist, die tiefen Ängste, die Traurigkeit, das Leid
und die Wut anzunehmen, und dabei spürbar und authentisch bleibt. („Kinder orientieren sich
stark an uns Erwachsenen. Haben sie das Gefühl, wir können mir ihren Fragen mitgehen,
neigen sie dazu, ganz offen und unkompliziert ihre Fragen zu stellen. Je direkter und natürli-
cher wir bereit sind, uns mit Kindern und Jugendlichen über die Themen Krankheit – Ab-
schied – Veränderung – Sterben – Tod auseinander zu setzen, desto heilsamer ist das für ihre
Entwicklung.“ (Kraft in: Kinder trauern, S. 335)
Die Kinder profitieren von der Stärkung der Eigenwahrnehmung. Hier gilt es, die zuvor be-
schriebene Dissonanz aufzuheben. Ziel ist es, das Vertrauen der Kinder in ihre eigene Wahr-
nehmungen und ihre Gefühle zu stärken bzw. ihnen zu helfen, dies wiederzuerlangen. Dies
beinhaltet auch eine Arbeit an und mit den für sie unangenehmen Gefühlen wie Ärger und
Wut, Angst und Verzweiflung, die abgespalten sind.
Durch die Arbeit mit den Kindern zeigt sich, dass gerade die Arbeit an/mit der Wut unver-
zichtbar ist. Die Intention ist hierbei, die Aggressionen, die Wutgefühle, die in den Kindern
ob der Erkrankung, der Behandlung, der Reaktionen der Umwelt aufkommen, zu legitimieren.
In dem beschriebenen System der intensiven Zusammenarbeit, der notwenigen Compliance
zwischen Klinikbetrieb, Eltern und Kind, hat dies oft keinen Platz. Die Wut in sich selbst zu
spüren, muss dabei nicht zu negativen Konsequenzen führen.
Haben wir uns bisher dem Verstehen der verschiedenen Reaktionsweisen auf die Bedrohung und dem
Verlust zugewandt und daraus abgeleitet, was die Kinder benötigen, so fehlt noch ein wesentlicher
Punkt in der Reflexion. Die eigene Eignung!
Damit ist man spätestens dann konfrontiert, wenn ein Junge, hier der 12-jährige M ., ohne Bezug zu
den bisherigen Inhalten der Therapiestunde, beim Herausnehmen eines M ensch-ärgere-dich-nicht -
Spiels aus dem Regal fragt: „Wärst du eigentlich sehr traurig, wenn ich sterben würde?“ Dabei schaut
er mich mit durchdringendem Blick an, der aber auch von einer großen Unsicherheit durchzogen ist.
M ein Inneres reagiert hier spontan mit einer Vielfalt von Assoziationen und Gefühlen:
Ich bin schockiert, wie offen er die Frage stellt.
Ich bin unsicher, weil mir so schnell keine gute Antwort einfällt.
Der Analytiker in mir würde gern zurückfragen: Was denkst du denn, wie es mir gehen
würde?
Ich würde gerne ablenken und das Thema ändern!
Und ich bin auch irgendwie ärgerlich darüber, dass er mich so unvorbereitet mit etwas so
Existenziellem konfrontiert.
Erwähnt sei hierbei, dass der Junge selbst ebenso spontan mit seiner Krankheit konfrontiert wurde.
Er war beim Zahnarzt, der eine Zyste diagnostizierte, die sich schließlich als Tumor herausstellte. Er
selbst konnte noch beschreiben, dass es kurz vor Nikolaus war und er damals mit ganz anderen inne-
ren Themen beschäftigt war.
S.17Was müssen wir selbst leisten, um den Kindern das zuvor skizzierte Gegenüber zu werden:
Auf therapeutischer Seite bedarf es hierzu der Auseinandersetzung mit:
- meinen eigenen Ängsten vor Krankheit, Sterben und Tod
- all meinem tiefen Leid und allen schmerzhaften Abschieden in meiner gesamten Bio-
grafie
- meinen Gefühlen bzgl. Hilflosigkeit, fehlender Wirkmächtigkeit.
Wie bereits öfter in diesem Vortrag aufgezeigt, zeigen die Kinder uns, dass sie Themen wie
Traurigkeit, Angst und Wut von sich aus nur schwer in den Dialog bringen können. Sie
brauchen deshalb oft unser Entgegenkommen, indem wir als fachliche Helfer auch das Un-
aussprechbare formulieren.
Als Therapeuten haben wir Angst vor manchen Fragen, weil wir meinen, dass wir gute Ant-
worten auf diese Fragen haben müssten. Aber es gibt auf viele Fragen keine guten Antworten:
„Warum habe ich Krebs bekommen und nicht mein Bruder?“ oder „Warum musste mein Papa
sterben?“ sind Fragen, auf die wir keine für das Kind erleichternde Antwort finden werden.
Wir müssen uns an dieser Stelle wohl von dem Gedanken frei machen, dass derartige Fragen
eine Antwort brauchen.
Sie brauchen vielmehr ein Gegenüber, das die Frage aufnimmt, nicht zurückweicht und letzt-
lich – zusammen mit dem Kind – die Schwere der Frage erträgt.
Fr. Finger bringt dies mit einem einfachen Satz zum Ausdruck: „Fragen sollen gehört, nicht
beantwortet werden.“ (S. 100)
(Ein Beispiel aus der Erwachsenenwelt kann uns dies vielleicht noch einmal deutlicher ma-
chen. In einer ARD-Reportage über Traumafolgestörungen amerikanischer GIs, die in den
letzten beiden Irakkriegen gekämpft haben, wurden Personen porträtiert, die nicht mit den
inneren Bildern der Kriege fertig wurden und seither unter Ängsten, Schlafstörungen und Pa-
nikattacken leiden. Die befragten Exsoldaten schilderten dabei gar nicht ihre Symptome, ob-
wohl die oft sehr stark waren, als das Schlimmste, sondern die Tatsache, dass sie damit von
niemandem ernst genommen werden.
Eine junge Frau sagt hier bezugnehmend auf die M ilitärärzte: „Ich will ja gar nicht, dass die
mir erklären, warum ich das alles habe, sondern nur, dass sie mir glauben, dass es wahr ist.
Ich komme mir so gedemütigt vor, weil die immer so tun, als würde ich mir das alles einbil-
den.”)
Das Wichtigste sind also nicht Erklärungen, sondern die Herstellung einer tragfähigen Bezie-
hung, die Nähe vermittelt. Durch zu schnelle Antworten wird die kindliche Verarbeitung, die
im Fragen beinhaltet ist, sogar unterbrochen.
Aus meiner Sicht kann das Kind ruhig unsere Anstrengung oder Ratlosigkeit spüren (sofern
wir dabei nicht aus der Beziehung gehen), denn es merkt dann auch, dass die Fragen nicht
leicht zu beantworten sind und dass es eben nicht allein an diesen Überlegungen scheitert.
Ein weitere kindspezifische Folge des Nichtmiteinander-Sprechens ist, dass Kinder ihre Wis-
senslücken durch eigene Fantasien darüber füllen, was mit der geliebten verstorbenen Person
passiert oder wie sie wohl aussehen mag. „Diese inneren Bilder sind meistens viel schlimmer
und bedrohlicher als die Bilder in der Realität.“ (Susanne Kraft in: Kinder trauern, S. 335)
Beispiel: So schildert ein mittlerweile 13-jähriger Junge, dass er, als er 6 Jahre alt war, seinen
Vater verloren hat. Es hat damals niemand mit ihm über das Ganze gesprochen. Er durfte nicht
S.18Sie können auch lesen