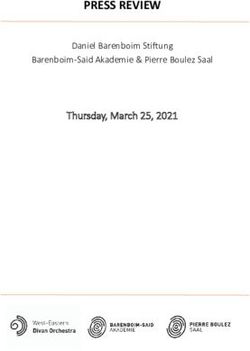Musik und Bühne am Bauhaus
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Musik und Bühne am Bauhaus
(veröffentlicht in: Günter Eisenhardt [Hrsg.]: Musikstadt Dessau.
Altenburg 2006: Verlag Klaus-Jürgen Kamprad)
Vulkanisches Gelände im Meer des Spießbürgertums:
Musik und Bühne am Bauhaus
1. BAUHAUS ALS LEBENSKONZEPT
Die Bauhaus-Gemeinschaft wurde einmal als „eine kleine abgeschlossene Insel im Meere des […]
Spießbürgertums“ bezeichnet. In den schweren Jahren nach dem Ende des Ersten Weltkrieges, einer
Zeit zwischen höchsten Idealen und Schlangen hungernder Erwerbsloser, stürzte sie sich in „geistige
Abenteuer“, beseelt von politischen Hoffnungen, sozialen Utopien, Ehrfurcht vor der Natur und den
Menschen. Unterschiedliche Weltanschauungen trafen im Bauhaus aufeinander. Theosophen,
Anthroposophen, Katholizisten, Spiritisten, Wanderapostel, sektiererische Propheten, Anhänger der
Mazdaznanlehre, Sozialisten, Kommunisten und viele andere schufen ein Spannungsfeld, das
außergewöhnliche schöpferische Potentiale freisetzte, aber auch spaltete und dabei Konflikte
heraufbeschwor, die bis zum Siedepunkt ausgetragen wurden. Bisweilen waren diese von derart
grundsätzlicher Natur, dass sie sich nur durch personelle Konsequenzen lösen ließen.
„Glauben Sie ja nicht, daß das Leben am Bauhaus einfach oder unkompliziert gewesen wäre! Man
fühlte sich vielmehr wie auf einem vulkanischen Gelände, und man mußte sehr aufpassen, nicht allzu
sehr hin und her gerissen zu werden von all dem, was auf uns einstürmte“, resümiert Tut Schlemmer.
„Man war ja andauernden Wandlungen preisgegeben: Wir fingen ja fast mittelalterlich an mit unseren
Satzungen von Formmeistern, Handwerksmeistern und Lehrlingen und endeten doch am Schluß
(1933) mit einer Avantgarde auf allen Gebieten. Was sich auch ereignete in Kultur und politischem
Geschehen, es spiegelte sich bei uns.“1 Damit sei angedeutet, dass die Bauhaus-Idee nicht in sich
ruhte, sondern fortwährenden Veränderungen unterworfen war, beeinflusst durch Persönlichkeiten,
die an der Institution wirkten, durch praktische Bedingungen, die der Lebensalltag bestimmte und
durch politische Vorgänge. Bauhaus-Angehöriger zu sein, kam einer „neuen Lebensform“2 gleich.
Diese prägte das Denken, Fühlen und Tun im Verhältnis zur modernen Zivilisation und spiegelte sich
in unterschiedlichsten Lebensäußerungen: vom Bauhaus-Pfiff über die Bauhaus-Kleidung bis hin zu
den legendären Bauhaus-Festen. Dabei galt es, einer bürgerlichen Gesellschaft zu trotzen, die in ihrer
Verbundenheit zu den Werten einer vermeintlich „guten alten Zeit“ dem Bauhaus-Konzept nachhaltig
misstraute, „Bauhäusler“ mit „Zuchthäuslern“ verglich und den Kindern die Einrichtung als Gespenst
einbläute: „Wenn ihr euch nicht benehmt, dann stecken wir euch ins Bauhaus!“3
Die allgemeine Chronologie der Bauhaus-Entwicklung ist bekannt, deshalb seien nur elementare
Eckdaten in Erinnerung gerufen: Eröffnet wurde das Bauhaus als staatliche Einrichtung 1919 in
Weimar nach Vereinigung der ehemaligen Großherzoglich Sächsischen Hochschule für bildende
Kunst und der ehemaligen Großherzoglich Sächsischen Kunstgewerbeschule unter Neuangliederung
einer Abteilung für Baukunst. 1925 löste sich die Institution selbst auf, ein Jahr später beschloss der
Dessauer Gemeinderat – gegen die Stimmen der rechts orientierten Parteien – die Übernahme des
Bauhauses. In Dessau existierte die Einrichtung bis 1932. Direktoren waren Walter Gropius (bis
1928), Hannes Meyer (1928–1930) und Mies van der Rohe (ab 1930). Mies van der Rohe versuchte,
das Bauhaus ab 1932 als private Institution in Berlin fortzuführen. Im August 1933 wurde das Bauhaus
aufgelöst. Im Folgenden soll die Rolle der Musik am Bauhaus diskutiert werden. Um bestimmte
Entwicklungsmomente zu verstehen, beschränken sich die Gedanken nicht nur auf die Dessauer
Periode.
2. AUF DEM WEG ZU NEUEN UFERN (1): BAUHAUS UND „NEUE MUSIK“
Musik bildete am Bauhaus keine eigenständige Disziplin. Weder boten die Lehrkräfte (die Meister,
später Professoren) Kompositions- oder Musiktheorie als Fach an, noch wurde Instrumental- oder
Gesangsunterricht gegeben. Jedoch nahmen viele Bauhausangehörige jede Möglichkeit wahr,
Strömungen zeitgenössischer Musik zwischen Erik Satie, Arnold Schönberg, George Gershwin, Henry
1
Tut Schlemmer: … vom lebendigen Bauhaus und seiner Bühne. In: Eckhard Neumann (Hrsg.): Bauhaus und
Bauhäusler. Erinnerungen und Bekenntnisse. Köln 1985: DuMont, S. 226
2
Bruno Adler. In: Neumann: Bauhaus und Bauhäusler, S. 22
3
mündliche ÜberlieferungCowell und Kurt Schwitters kennen zu lernen. Außerdem spielte die Musik in den Diskussionen am
Bauhauses und zahlreichen kunsttheoretischen Schriften der damaligen Zeit eine entscheidende
Rolle.
Musiker und das Bauhaus
Welche Bedeutung zeitgenössische Musik am Bauhaus und in dessen Umfeld erlangte, dokumentierte
bereits die Weimarer Bauhaus-Woche von 1923. Dieses Ereignis, das der Rückschau, kritischen
Selbstbefragung und Orientierung nach vier Jahren Bauhaus-Entwicklung diente, wurde von einem
„Fest neuer Musik“ begleitet. Komponisten und Interpreten unterschiedlicher Generationen, die die
Musikentwicklung des jungen 20. Jahrhunderts maßgebend geprägt hatten oder als junge Talente zu
Hoffnungen Anlass gaben, trafen sich in der thüringischen Stadt. So reiste aus Paris Igor Strawinsky
an, um die Aufführung seiner Geschichte vom Soldaten zu erleben. Hermann Scherchen – ein
Interpret, der sich leidenschaftlich für die Musik des 20. Jahrhunderts einsetzte – war der Dirigent. Aus
Berlin kam, neben Scherchen, Ferruccio Busoni, Komponist und Professor. Er brachte einige seiner
Schüler mit, unter ihnen Wladimir Vogel und Kurt Weill. Auch Paul Hindemith war zugegen, dessen
Marienleben (Sololieder mit Klavier) uraufgeführt wurde. Nicht zu vergessen ist Stefan Wolpe.
Waren sie vorrangig wegen der Aufführungsmöglichkeiten nach Weimar gekommen? Standen sie in
geistiger Beziehung zum Bauhaus? Unterhielten sie persönliche Kontakte zu Bauhauslehrern oder -
schülern? Diese und ähnliche Fragen sind bei den erwähnten Musikern sehr unterschiedlich zu
beantworten, bisweilen auch nur zu mutmaßen.
Paul Hindemith (1895–1962) war schon seit einiger Zeit mit dem Bauhaus-Meister Oskar Schlemmer
(1888–1943) bekannt. Schlemmer hatte die Bühnenbilder für Aufführungen zweier Einakter
Hindemiths 1921 in Stuttgart geschaffen: für Mörder, Hoffnung der Frauen sowie Das Nusch-Nuschi.
Stefan Wolpe (1902–1972), einer der interessantesten Komponisten des 20. Jahrhunderts, besuchte
das Bauhaus sogar einige Zeit als Schüler. „Ich wuchs in Berlin heran, doch Weimar liegt nicht sehr
weit von Berlin, und wir alle fuhren nach Weimar, wie Pilger nach Jerusalem oder Mekka“, schrieb er
später. „Das Bauhaus war der Ort, wo moderne Kunst gelehrt wurde, wo man sie auch ausprobierte.
Wo Gropius lehrte, wo Klee lehrte, wo Kandinsky lehrte, wo van Doesburg und Mondrian zu
Vorlesungen kamen, selbst ich, junger Dachs, sprach über ziemlich abstruse Dinge, zum Beispiel die
übernatürlichen Proportionen und so Sachen. Wir lernten dann (und ich glaube, daß Klee uns das
lehrte, alles mit allem in Beziehung zu setzen).“ Allerdings war nicht Paul Klee (1879–1940) Wolpes
Lehrer, sondern Johannes Itten, eine der charaktervollsten wie streitbarsten Persönlichkeiten der
frühen Bauhaus-Epoche. Namentlich Wolpes Beschäftigung mit „übernatürlichen“ Proportionen dürfte
zutiefst von Ittens Ideen geprägt sein. Weiter im Erinnerungstext Wolpes: „Ich bin kein Maler (ich bin
Komponist), ich nahm jedoch an den Kursen von Paul Klee [Klee oder nicht vielmehr Itten? T. S.] teil.
Er ließ uns auf der Straße Gegenstände suchen. Wir gingen alle raus mit einem kleinen Koffer und
sammelten alles, was wir fanden – von Zigarettenkippen bis zu kleinen Feilen, kleinen Schrauben,
Briefschnipseln, Brotkrümeln, toten Vögeln, Federn, Milchflaschen … winzig kleine Gegenstände,
große Gegenstände, zerschundene Gegenstände, die keinen Nutzen mehr haben … – und mußten
diese Dinge unabhängig von ihrer subjektiven Bedeutung verwenden. Wir mußten sie wie formale
Elemente verwenden, und als formale Elemente wurden sie neutralisiert, so existierte ein toter Vogel
nur in seiner formalem strukturellen Beziehung …“4
Diese Beschreibungen legen starke Beziehungen zum Dadaismus nahe, jener Generalverweigerung
gegenüber der normierten Gesellschaft. Schon vor seiner Bauhaus-Zeit war Wolpe in Berlin mit den
Dadaisten in Berührung gekommen. Als 1922 in Weimar ein internationaler Kongress der
Konstruktivisten und Dadaisten stattfand, trat er gemeinsam mit Kurt Schwitter auf. Der „Merz“-
Künstler, der sich selbst nie als Dadaist verstand, blieb nicht ohne Einfluss auf Wolpe. 1929 vertonte
der Komponist Schwitters unsterbliches Gedicht Anna Blume. Das Werk für Klavier und Musical-
Clown verstand er als produktive Fortführung künstlerischer Konzepte der frühen zwanziger Jahre, die
für ihn „befriedigende Racheakte“ gegen den „grassierenden Schwindel der Kunst“ bedeutet hatten.
„Vollständig disparate Dinge“ fügte er zu einer Form zusammen, „so wie man einen Affen neben eine
Uhr stellen kann“. Mehrere Kompositionen Wolpes wurden Bauhaus-Angehörigen zugeeignet,
darunter Friedl Dicker, „seine erste große Liebe“, die „jedoch unerwidert“ blieb.5 Diese begabte
4
Zit. nach: Steffen Schleiermacher: Musik am Bauhaus. Einführung zur CD-Einspielung „music at the bauhaus“
(MDG 613 0878-2), S. 26 f.
5
Elena Makarova: Friedl-Dicker Brandeis. Ein Leben für Kunst und Lehre. Wien/München 2000: Christian
Brandstätter Verlag, S. 15.Bauhaus-Schülerin (geb. 1898) wurde 1942 mit ihrem Mann Pavel Brandeis nach Theresienstadt
deportiert, wo sie Kindern Zeichenunterricht erteilte, und 1944 im KZ Auschwitz umgebracht.6
1923 kam ein 21jähriger Mann ans Bauhaus, dem der Ruf vorauseilte, einer der besten Kenner
zeitgenössischer Musik zu sein: Hans Heinz Stuckenschmidt (1901–1988). Trotz seiner Jugend
konnte er bereits beachtenswerte Erfolge als Musikkritiker und Konzertorganisator vorweisen. Auch
komponierte er. Zuletzt hatte er in Berlin gelebt und gewirkt. Ans Bauhaus war er auf Anregung von
László Moholy-Nagy (1895–1946) gelangt, um an experimentellen Projekten der Bühnenwerkstatt
mitzuwirken, die zur erwähnten Bauhauswoche 1923 vorgestellt werden sollten. Für viele Angehörige
der Einrichtung wurde Stuckenschmidt ein interessanter Gesprächspartner, hatte er doch zahlreiche
Uraufführungen erlebt und wichtige Komponisten und Interpreten persönlich kennen gelernt. Zu ihnen
gehörte George Antheil, der in einem der letzten Konzerte der Berliner Novembergruppe aufgetreten
war. Dieser junge amerikanische Pianist und Komponist stand mit seiner vitalen Musik Ideen nahe, die
am Bauhaus kursierten. So markieren seine Kompositionen einen Gegenpol zu bekenntnishafter
Ausdruckskunst. Motorik bestimmt den Charakter seiner Musik. Oftmals gleicht sie einem
maschinellen Prozess. Die Dynamik des Technischen herrscht vor. Elementare rhythmische
Ereignisse treten in den Vordergrund. Sie werden häufig von Takt- und Schwerpunktwechseln
durchsetzt, die nicht selten beunruhigend wirken, als wollten sie neben der Faszination des
Maschinellen auch dessen Bedrohlichkeit vermitteln. Damit verband er eine tiefere Absicht: Er suchte
„dem Zeitalter“, in welchem er lebte, „sowohl die Schönheit als auch die Gefahr seiner unbewussten
mechanistischen Philosophie und Ästhetik klarzumachen“.7 In der Reihe der Bauhaus-Schriften wurde
sogar ein Buch von Antheil über „musico mechanico“ angekündigt. Dieses Buch ist jedoch nie
erschienen.
Besonders leidenschaftlich diskutiert wurden unter vielen Bauhaus-Angehörigen die neu gerade
aufgekommenen Zwölftonmethoden. Dabei bildeten sich sogar zwei konträre Lager heraus: Das eine,
namentlich von Erwin Ratz beeinflusste, vertrat die Auffassungen von Arnold Schönberg, das andere
– vor allem aus dem Umfeld von Johannes Itten geprägte – fühlte sich den Werken und der
Philosophie von Josef Matthias Hauer verbunden.
Das Interesse vieler Bauhaus-Angehöriger für neue Musik beschränkte sich keineswegs auf den Reiz
des Modernen oder das Bedürfnis, sich „auf der Höhe der Zeit“ zu bewegen. Sie berührte mit den
Musikern vielmehr eine gemeinsame Gretchenfrage, nämlich die nach dem Zweck der Musik. Die
junge Musikergeneration nahm Abschied von dem fossilen Verständnis der Musik als Tonkunst. Eine
vorrangig sich selbst dienende Kunst erschien vielen als nutzlos. Einen Nutzen sahen sie, wie
Eberhardt Klemm schreibt, nur in einer „Musik, die ihre Aufgaben kennt und benennt. Eine Musik, die
die Wirklichkeit auf die Opernbühne bringt, die die unheimliche Stummheit der realistischen Bilder auf
der Leinwand begleitet und damit erträglich macht, eine Musik, die den frühen Rundfunk bedient, die
mit den Massen aus dem Konzertsaal zieht“. Die Fragen nach dem Zusammenhang von Nutzen, Idee,
Material und Herstellungsprozess verbündete und sorgte für wechselseitige Anregungen.
Die Faszination der Medien
Die zahllosen Bildbände über das Bauhaus vermitteln anhand von Fotografien faszinierende
Einsichten in das Leben des Bauhauses. Neben Schnappschüssen vom Alltag, finden sich
komponierte Fotografien, die die Perspektive des bloßen Abbildes mittels Spiegelung,
Mehrfachbeleuchtung und Fragmentierung sprengen. Sie interpretieren, akzentuieren, verzerren,
inszenieren. Namentlich zahlreiche Selbstporträts werden zur Pose, zur Selbstdarstellung mit oft
magischer Wirkung. Es scheint, als wollen sie der inspirierenden Kraft der Bauhaus-Idee, der „Utopie
vom neuen Menschen“, durch eine neue Art des Sehens Ausdruck verleihen. Sie vermitteln dem
Betrachter nicht die sichtbare Welt, sondern bestimmte Botschaften. Prinzipien moderner Medien, die
Wirklichkeit zugunsten bestimmter Wirkungen und Sichtweisen zu verändern, stehen sie bereits
bemerkenswert nahe. Zugleich liefert die expandierende Medienwelt in ihrer Doppelbödigkeit
Requisiten und Themen für komponierte fotografische Arbeiten. Eine besondere Rolle spielt dabei die
Aura der technisch reproduzierbaren Musik, die eng mit der rapiden Entwicklung von Grammophon
und Schallplatte verbunden ist: Wurden 1906 in Deutschland rund 1,5 Millionen Tonträger verkauft,
betrug der Umsatz 1930 bereits ca. 30 Millionen Exemplare.
6
Vgl. die in Fußnote 5 genannte Publikation von Elena Makarova sowie: Kinderzeichnungen aus dem
Konzentrationslager Theresienstadt. Augsburg 1990: Berufsverband Bildender Künstler Schwaben-Nord und
Augsburg e. V., S. 23–25. Auch Wolpes Lebensschicksal verlief tragisch, allerdings gelang es ihm, vor den
Nazis zu fliehen. Über Österreich, Rumänien und die Sowjetunion gelangte er nach Palästina. 1938 ging er
schließlich in die USA, wo er, wo er u. a. Lehrer von David Tudor und Morton Feldman wurde. In den fünfziger
und sechziger Jahren war er wiederholt Gast bei den Darmstädter Ferienkursen.
7
George Antheil: Enfant terrible der Musik. Berlin/Darmstadt/Wien 1960: Deutsche Buch-Gemeinschaft, S. 153Drei Beispiele mögen die vielfältigen Möglichkeiten fotografischer Sicht auf das klingende Medium
andeuten: Etwas unbequem mutet die Haltung des jungen Mannes auf einer Fotografie von 1927/30
an. Jedoch scheint ihm der Teller unter der rechten Ohrmuschel einen zusätzlichen Resonanzraum zu
schaffen und damit ein besseres Hörerlebnis zu schaffen. Darüber mögen wir heute schmunzeln:
Indes strahlen die historischen Apparaturen und manche knisternde Platte ein Atmosphäre aus, die
die Perfektion hochmoderner Aufnahmen bisweilen vermissen lassen. Interessante Reflexionen
gestattet ein Foto aus den Jahren 1927/28, das durch Doppelbelichtung entstanden ist: Heinz Loew
(1903–1981) setzt Schallplatte und Übertragungsgerät überdimensional in Szene, während dem
Schlagzeuger nur noch eine Nebenrolle vorbehalten zu sein scheint. Ist er nebensächlich geworden
im Zeitalter der Medien, die Musik jederzeit verfügbar und wiederholbar machen? Von 1925 stammt
das dritte Foto: Das Grammophon wird zum Schnittpunkt von technisch reproduzierter Musik und
original produzierten Tönen. Während das Grammophon eine Platte abspielt, dient der Schalltrichter
als Musikinstrument.
Mag diese Aufnahme zunächst als Spaß in geselliger Runde entstanden sein, so wurde das
Experimentieren mit den Medien für einige Bauhaus-Angehörige zur künstlerischen Herausforderung.
So nahm der Ungar László Moholy-Nagy begeistert wahr, welche ungewohnten Effekte entstehen,
wenn Schallplatten rückwärts gespielt oder vor dem Auflegen in der Mitte exzentrisch angebohrt
werden. Darüber hinaus erfand er um 1923 durch manuelle Veränderung von Schallplatten eine
spezielle Grammophon-Musik. Er arbeitete mittels Linolschnittmessern und -nadeln Strukturen in die
Schelllackscheiben ein. Beim Abspielen entstanden Verfremdungseffekte, die den Sinn der
eingespielten Musik brachen. Das Nebeneinander von Melodiefetzen, rhythmisierten Geräuschen,
Verzerrungen, Rausch- und Kratzwirkungen, Glissandi und ähnlichen Elementen erweiterte in ähnlich
grundsätzlicher Weise den Musikbegriff wie die Futuristen, denen Moholy-Nagy auch mit seinen
fotografischen und filmischen Arbeiten nahe stand. Dadurch stellte der konventionslose Künstler nicht
zuletzt das Streben nach lupenreinen Tönen in Frage, jenes künstlerische Ideal, das Virtuosen immer
stärker zu verfeinern suchten, herausgefordert von einem verzückten, nach Sensationen heischenden
Publikum. Aber auch die Schallplatte löste er aus ihrem Kontext, indem er das Massenprodukt durch
individuelle manuelle Eingriffe wiederum in ein originäres Kunstwerk verwandelte. Er erschloss
Grenzbereiche zwischen musikalischer Reproduktion und Live-Vorgängen, wie sie erst Jahrzehnte
später größere Verbreitung fanden, etwa in der DJ-Bewegung des Scratchings, des spontanen
Manipulierens laufender Schallplatten. Moholy-Nagy war überzeugt von den vielfältigen Möglichkeiten,
eine originäre Schallplatten-Musik zu schaffen.8
3. „Wir überleben alle Stürme“: Die Bauhauskapelle
Bereits in Weimar schlossen sich Bauhaus-Angehörige zu einem Ensemble zusammen, das unter
dem Namen Bauhauskapelle in kurzer Zeit zu einem Geheimtipp wurde. Es entwickelte sich zu einem
begehrten Unterhaltungsorchester und gastierte auch in anderen Städten. Dadurch konnten sich die
Mitglieder nicht zuletzt die Mittel für das Studium aufbessern.9 Welche Resonanz die Auftritte
auslösten, mag ein Artikel aus dem Berliner 8 Uhr-Abendblatt von 1924 belegen. Kole Kokk schrieb
begeistert: „Sie sind die beste Jazzband, die ich je toben hörte, bis in die Fingerspitzen musikalisch.
Niemals ist der Bananenshimmy besser gespielt worden, nirgends legt man die Mädchen von Jawa
schmissiger hin …“10 Für ihre Auftritte warben die Mitglieder selbst wie folgt: „wie sie sehen: wir
8
Die Beziehungen zwischen Musik und Technik erwiesen sich seinerzeit für viele Künstler als ein weites
Experimentierfeld und als ein hochbrisantes Thema mit heftigem Für und Wider. Hans Heinz Stuckenschmidt
gab 1926 ein Sonderheft der Zeitschrift Anbruch zum Thema Musik und Maschine heraus.
9
Stefan Kraus schreibt über die Zusammensetzung der Bauhauskapelle, die sich im Laufe der Jahre
zwangsläufig verändert hat: „Zur Gründungsgruppe in Weimar gehörten Andor Weiniger (Piano und
Falsettotenor), temperamentvoller Ungar und beherrschender Kopf der Gruppe, auch in Dessau für seinen
Charme berühmt, neben ihm Hans Hoffmann, Rudolf Paris und Heinrich Koch. In den Dessauer Jahren wurde
die Gruppe vergrößert: Jackson Jacobson (Schlagzeug), Clemens Röseler (zweites Piano, Posaune, Banjo), Fritz
Kuhr (zweiter Bumbaß, Banjo), Lux Feininger (Klarinette, Banjo), Xanti Schawinski (Sopran- und Altsaxophon,
Flexaton, Cello und Lotosflöte) und als gelegentlicher Gast Jura Fulda (Banjo und Solostimme). In: Wulf
Herzogenrath (Hrsg.), Mitarbeit Stefan Kraus: bauhaus utopien. Stuttgart 1988: Cantz, S. 216. Hans M. Wingler
nennt in den Anmerkungen zu Hans Heinz Stuckenschmidts Aufsatz Musik am Bauhaus als Mitglieder der
Bauhauskapelle außerdem Clemens, Egeler, Strenger, Collein, Takayer u. a.; in: Karin von Maur (Hrsg.): Vom
Klang der Bilder, S. 413, Anm. 13. Vgl. außerdem Xanti Schawinsky: metamorphose bauhaus, in: Neumann
(Hrsg.): Bauhaus und Bauhäusler, S. 216
10
Kole Kokk: Das Bauhaus tanzt. 8 Uhr-Abendblatt Berlin vom 18. Februar 1924. Zit. nach: Hans W. Wingler:
Das Bauhaus 1919–1933. Weimar Dessau Berlin und die Nachfolge in Chicago seit 1937. Bramsche ³/1975:
Begr. Rasch & Co., S. 99. Vgl. zur Bauhaus-Kapelle auch: Christoph Metzger: Musik am laufenden Band – eineüberleben alles stürme. wir spielen unsere musik, einen hei-in-die-knochenfahrenden rhythmus! der schlägt ein! sie müssen uns hören – sie denken an uns.“11 Die wichtigsten Aufgabe des Ensembles bildeten aber nicht die Reisen, sondern die regelmäßigen Tanzveranstaltungen des Bauhauses und die legendären Bauhausfeste, zu denen zahllose Gäste strömten, auch aus anderen Städten wie Berlin und Leipzig. Diese Feiern waren mit bestimmten Zeiten des Jahres verbunden, darunter das Laternen-, Sonnenwend-, Drachen- und „Julklapp“fest (Weihnachten). Später standen sie meist unter einem konkreten Leitthema, das die Idee lieferte für die Ausstattung, beispielsweise „Metallisches Fest“, „Weißes Fest“ oder „Indisches Fest“. Jede Feier für sich bildete, Überlieferungen zufolge, ein besonderes Ereignis im Leben des Bauhauses. Schier unbegrenzt schien die Phantasie, mit der sich die Feiernden – auf das jeweilige Thema bezogen – kostümierten und den Saal ausstatteten. Charleston wurde getanzt und der eigens entwickelte Bauhaustanz zelebriert. Marionettenspiele und Sketche waren zu erleben. Manches Bauhaus- Geheimnis wurde gelüftet. Und die Lehrkräfte, die bei den Feiern keineswegs abseits standen, forderten immer wieder parodistische Anspielungen heraus. So außergewöhnlich wie die Feste müssen auch die Darbietungen der Bauhauskapelle gewesen sein. Bedauerlicherweise konnte bislang keine Tonaufnahme der Vereinigung ausfindig gemacht werden. Möglicherweise hat nie eine existiert. Deshalb müssen wir den Erinnerungen von Zeitzeugen vertrauen, die eine charaktervolle Mischung aus Jazz, Folklore und Eigenkomposition schildern, stundenlang und garantiert tanzbar, durchsetzt mit vielerlei Alltagsgeräuschen. Entsprechend vielfältig war das Instrumentarium. Klarinette, Saxophon, Banjo und Posaune gehörten wohl noch zum gewöhnlichsten. Hinzu kamen selbstgebaute oder veränderte Streich-, Blas- und Schlaginstrumente, ein Flexaton (eine Mischung von Streichinstrument und Schellentrommel), Revolver, Klingeln, riesige Stimmgabeln, Sirenen.12 Der Mitwirkende Alexander (Xanti) Schawinsky (1904–1979) berichtet von einem „phantastisch-rhythmischen und durchdringenden lärm“. Wenn der Höhepunkt überschritten schien, habe sich das „getöse in tiefste stille“ gewandelt. Dann hätten sich alle „sitzend auf dem boden vor dem bühnenpodium“ gruppiert und auf den Bauhaus-Studierenden Andor Weininger (1899–1986) gewartet. Seine Auftritte seien stets ein ganz besonderes Ereignis gewesen. „Andy“, wie er genannt wurde, habe mit abstrakten Liedern und kabarettistischer Begabung die Herzen derart gerührt, dass manche Tränen und Schweißperlen vom Tanzen zusammengeflossen seien. In solchen Momenten kreativen Innehaltens hätten die Mitglieder der Bauhaus-Bühne gern „ihre oft noch im entstehen begriffenen theaterexperimente zum besten“ gegeben, „oskar schlemmer etwa als musikalischer clown, siedhoff in einem reifen-, kasten- oder treppentanz, joost schmidt im ringkampf mit sich selbst, kurt schmidts mechanisches ballet mit bogler und teltscher, schawinskys jazz- und steppmaschine, teils des triadischen balletts und mechanischen kabaretts, gruppenarbeiten wie ‚der mann am schaltbrett’, die gestentänze, proklamationen wie ‚quadrat & blume – eine neue einheit’, sketches […] all das war angetan, das tanzgelage in eine atemlose zuschauerschaft zu verwandeln.“ Kapelle und Bühne hätten sich „bei solchen anlässen […] am nächsten“ gestanden.13 Nicht zufällig enthält der 1925 erschienene Band Die Bühne am Bauhaus aus der Reihe der Bauhausbücher auch eine Abbildung des Ensembles. Beständig in stimulierenden Grenzbereichen agierend, war die Bauhauskapelle vielen professionellen Vereinigungen seinerzeit – allerdings auch heute – um einiges voraus. Niemand dachte daran, in „höhere“ und „niedere Musik“, „E“ und „U“, „Volksmusik“ und „Kunstmusik“ zu klittern. Stattdessen herrschte ein ursprünglicher, vitalisierender Geist von Musik. Die Mitglieder – und offenbar auch ihr Publikum – waren offen für jede Art von Musik: für Gassenhauer und Jazztitel ebenso wie für Kompositionen von Strawinsky und Antheil. Selbstverständlich blieb im Repertoire auch Platz für Werke Johann Sebastian Bachs, Georg Friedrich Händels und Wolfgang Amadeus Mozarts, gespielt mit dem modernen, außergewöhnlichen Instrumentarium. Einige Apologeten der Komponisten würden in diesem Moment vermutlich den Atem anhalten und mit erhobenem Zeigefinger Grundsätze historischer Aufführungspraxis referieren. Jedoch ignoriert dogmatisches Authentizitätsverständnis gemeinhin ein elementares musikalisches Gesetz: Musik vergeht wie Zeit. Sie ersteht und verklingt mit jeder Aufführung aufs Neue, jedes Mal ein wenig anders. So wird „neueste“ Musik gleichermaßen von der Vergangenheit eingeholt wie „älteste“ den Kein zur Gegenwart ins sich trägt. Der Organist Gerd Zacher hat einmal sehr treffend geschrieben, dass der „wesentlichere Aspekt eines wertvollen Kunstwerkes […] seit jeher die Tatsache gewesen“ sei, „daß es Horizonte öffnet und in die Zukunft weist“. Man fragt „nicht mehr, ob kleine Musikgeschichte des Bauhauses. In: Jeannine Fiedler / Peter Feierabend (Hrsg.): Bauhaus. Köln 1999: Könemann Verlagsgesellschaft, bes. S. 145–147 11 Eine Werbeklappkarte der Bauhauskapelle ist abgedruckt in: Jeannine Fiedler / Peter Feierabend: Bauhaus, S. 148 12 Xanti Schawinsky: metamorphose bauhaus, in: Neumann (Hrsg.): Bauhaus und Bauhäusler, S. 216 13 Schawinsky: metamorphose bauhaus, S. 217 f.
eine Darstellung historisch vertretbar, sondern ob sie gegenwärtig notwendig ist“.14 Diese kreative
Haltung, Kunst gleich welcher Epoche als lebendigen Organismus zu begreifen, hat die
Bauhausangehörigen in ihren oft aufmüpfigen Aktionen immer wieder herausgefordert, bei allen
unerfüllten – unerfüllbaren – Visionen.
4. AUF DEM WEG ZU NEUEN UFERN (2): BAUHAUS UND „ALTE MUSIK“
Es mag zunächst verblüffen, dass die avantgardistischen Maler Lyonel Feininger (1871–1956) und
Paul Klee als ausübende Musiker dem Vokabular ihrer Zeit offenbar fern gestanden haben. Feininger,
der ursprünglich Musiker werden wollte, doch schließlich Malerei studierte, spielte auf dem Klavier
oder Harmonium in seinem Atelier am liebsten Werke von Johann Sebastian Bach. Das
Wohltemperierte Klavier beherrschte er auswendig. 1921 begann er, beeindruckt von Bachs
musikalischer Sprache, Fugen zu komponieren. Klee, der ob seiner ausgezeichneten Fähigkeiten im
Violinspiel schon als Gymnasiast außerordentliches Mitglied in den Konzerten der Bernischen
Musikgesellschaft wurde, sah seine Ideale von Musik im Schaffen von Bach und vor allem von Mozart
verwirklicht. Er war überzeugt davon, dass nach dem Tode Mozarts die Blütezeit musikalischer
Entwicklung überschritten sei. Die Musik der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts glich für ihn einem
Abstieg; mit Anton Bruckner, Richard Wagner, Gustav Mahler und besonders Richard Strauss mochte
er sich nicht anfreunden. Besonders distanziert verhielt er sich, trotz seines aufgeschlossenen
Kontaktes zu Hindemith, gegenüber der zeitgenössischen Musik, die ihm als zu „gezwungen“, zu
„konstruiert“ erschien. Seine Ansichten über „Neue Musik“ bekundete er in sarkastischen
Zeichnungen. 1909 karikierte er einen Pianisten in Not: angekettet an sein Instrument, auf einem
Nachttopf sitzend, „dabei ‚durchschaubar’ bis auf die Knochen (in seiner Innovationssucht) und
‚bedürftig’ in einem ganz elementaren Sinne“. Fünf Jahre später entwarf er ein abstruses Instrument
für die neue Musik.
Vergleichbare Ansichten waren unter den avantgardistischen bildenden Künstlern nach der
Jahrhundertwende keineswegs außergewöhnlich. Sie beruhen aber nicht, wie voreilig vermutet
werden könnte, auf berühmten Irrtümern oder gar Ignoranz; sie erklären sich vielmehr aus der
Sichtweise auf die Situation der Bildenden Künste zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Für Feininger und
Klee wie für viele seiner avantgardistischen Zeitgefährten standen die bildnerischen Künste,
namentlich die malerischen, vor grundsätzlichen Entscheidungen. Sie hielten das Metier für prinzipiell
„unzeitgemäß“ und die überlieferten Darstellungsweisen für kaum mehr reformierbar. Schmerzlich
empfanden sie die Grenzen der dreidimensionalen Räumlichkeit sowie der Gegenständlichkeit, die
zeitliche Vorgänge auf Zustandsbeschreibungen und Momentaufnahmen reduzieren. Deutlich regte
sich das Bedürfnis nach neuen geistigen Grundlagen der Kunst: „Die Illusion einer sich hinter der
Leinwand fortsetzenden Realität gilt es zu zerstören, um neue Wirklichkeitsdimensionen zu eröffnen.
Die Aufgabe der Malerei kann nicht mehr in der Nachahmung der äußeren Wirklichkeit bestehen,
sondern das Kunstwerk soll die hinter den sichtbaren Erscheinungen verborgene, d. h. die unsichtbare
und eigentliche Wirklichkeit – als deren Inbegriffe man Zeit und Raum, Bewegung und Rhythmus
versteht – darstellen, um somit selbst Realität zu werden.“15
Auf der Suche nach Anknüpfungspunkten, die den Weg zur „unsichtbaren und eigentlichen
Wirklichkeit“ ebneten, gelangte für viele Künstler die Musik in den Mittelpunkt, denn diese schien
Perspektiven zu eröffnen, die das eigene Metier nicht mehr zu bieten schien. Die Fähigkeit der Musik,
vielfältige zeitliche Vorgänge im Raum zu entfalten, schätzten sie als faszinierende Quelle.
Beeindruckt zeigten sie sich namentlich von den Möglichkeiten polyphoner Mehrstimmigkeit,
vielschichtige zeitliche Vorgänge simultan zu erfassen. Diese Möglichkeiten für die Bildenden Künste
zu erschließen, betrachteten sie als wesentliche Aufgabe für die Zukunft. „Die einfache Bewegung
kommt uns banal vor“, notierte Paul Klee ins Tagebuch. „Das zeitliche Element ist zu eliminieren.
Gestern und morgen als Gleichzeitiges.“ Nicht wenige Bildende Künstler verliehen ihrer Sehnsucht
Ausdruck, indem sie als Werktitel Begriffe aus der Musik aufgriffen. Sie malten Fugen, Kontrapunkte,
Präludien und Fugen, Endlose Rhythmen, Polyphonien und immer wieder Fugen. Häufig ergänzten
sie ihre Arbeiten durch programmatische Erklärungen, mit denen sie – bezeichnend für die damalige
Situation – einen oft allzu dogmatischen Zusammenhang zwischen Musik und Bildenden Künsten
14
Gerd Zacher in: Orgel und Orgelmusik heute. Versuche einer Analyse. Bericht über das erste Colloquium der
Walcker-Stiftung für orgelwissenschaftliche Forschung 25.–27. Januar 1968 auf dem Thurner im Schwarzwald.
Hrsg. von Hans Heinrich Eggebrecht unter Mitarbeit von Klaus-Jürgen Sachs und Christoph Stroux. Stuttgart
1968: Musikwissenschaftliche Verlags-Gesellschaft mbH., S. 93
15
Susanne Ulbricht: Die Polyphonie in den Bildern Paul Klees. In: Tatjana Böhme/Klaus Mehner (Hrsg.): Zeit
und Raum in Musik und Bildender Kunst. Köln etc. 2000: Böhlau, S. 151konstruierten. Bisweilen suchten sie ihre Ansichten durch Anleihen aus wissenschaftlichen Disziplinen
zu stützen.
Titel und Wortäußerungen prägten auch das Rezeptionsverhalten: Viele Betrachter nahmen Farben,
Formen und Linien als musikalische Motive und Themen wahr, die sich entwickeln, miteinander
konzertieren, klangliche Gegensätze bilden und sich im Raum ausbreiten: vorwärts und rückwärts,
diagonal und kreisförmig, dynamisch und zyklisch. Doch wer die Fugen von Paul Klee, Josef Albers
(1888–1976) und anderen allein musikalisch deutet oder gar versucht, die Bilder von Feininger aus
seinen (musikalischen) Kompositionen heraus zu erklären, übersieht Entscheidendes: Nicht die
Übernahme musikalischer Prinzipien, sondern die grundlegende Erneuerung des bildkünstlerischen
Metiers bildete das Ziel vieler Avantgardisten. Wenn Paul Klee begeistert schrieb, welches
anziehende Schicksal es sei, „heute die Malerei zu beherrschen“, so warnte er zugleich vor einer
willkürlichen Übertragung von Mitteln der einen in die andere Kunst. Ihm lag nicht an einer
Vermischung der Mittel. Er wollte für die Bildenden Künste ein Fundament schaffen, wie er es auf
musikalischem Gebiet bereits mit „Ablauf des 18. Jahrhunderts“ realisiert und zum nie wieder
erreichten Höhepunkt geführt sah. Daraus erklärt sich Klees große Wertschätzung für das Schaffens
Bachs und – besonders – Mozarts. Das Ideal der Erneuerung, das er mit beiden Komponisten
verband, konnte ihm die zeitgenössische Musik, namentlich die damals junge Zwölftonmethode, nicht
bieten. Denn „das 12-Ton-System von Schönberg und seinen Schülern hatte vorsätzlich nichts
anderes im Sinn“, begründet Hans Grüß, „als die herkömmlichen klassischen Formen der Komposition
… neu zu konstituieren“, nicht aber, wie Klee, aus einem neuen Ansatz heraus auch „neue Formen
künstlerischer Äußerung“ zu entwickeln.16
5. „DIE BLUME IM KNOPFLOCH“: THEATERLABORATORIUM BAUHAUS-BÜHNE
Kunst kommt von Künden. Suche nach Horizonten
Oskar Schlemmer äußerte einmal, die Bühnenarbeit sei die „Blume im Knopfloch des Bauhauses“.
Und er fügte hinzu: „wozu Blume? Knopfloch allein genügt“.17 Kaum treffender als mit diesem Bild
lässt sich die herausragende Stellung der Bauhaus-Bühne kennzeichnen. Die Bühnenarbeit bündelte
wie in einem Brennpunkt die unterschiedlichsten Kräfte des Bauhauses. Sie bot ein kreatives Podium
für die übergreifende Syntheseidee, die schon im Gründungsmanifest der Einrichtung ausgewiesen
wurde.
Wie die Entwicklung der Bauhaus-Idee im allgemeinen war die Bühnenarbeit im besonderen
mannigfachen Wandlungen unterworfen. Persönlichkeiten mit unterschiedlichen Wurzeln und
Auffassungen bestimmten deren Weg. Dieser Weg wurde begleitet von grundlegenden Disputen um
neue Grundlagen und Konzepte der Theaterkunst, wie sie für die damalige Zeit charakteristisch
waren.
Während er ersten beiden Jahre, von 1921 bis 1923, wurde die Bauhaus-Bühne von Lothar Schreyer
(1886–1966) geführt. Schreyer war ein erfahrener Theatermann. Vor seiner Bauhaus-Zeit hatte er die
Sturm-Bühne in Berlin und die Kampfbühne in Hamburg gegründet und geleitet. Am Bauhaus suchte
er an Projekte dieser Zeit anzuknüpfen. Seine Konzepte waren stark expressionistisch beeinflusst. Sie
beruhten auf elementaren Formen, Farben, Bewegungen und Tönen. Es wurden, wie in dem Spiel Die
Geburt, Marionetten eingesetzt. Oder die Spieler erhielten aus Grundformen und Grundfarben
gebildete Ganzmasken („Tanzschilde“), mit denen sie sich auf der Bühne bewegten. Das Publikum
nahm nicht die Akteure, sondern die erzeugten farbigen Gesten wahr. Die wörtliche Sprache wurde in
ihrer Syntax gebrochen und somit zum klanglichen Ausdruck; das „Klangsprechen“ bedurfte eines
intensiven Trainings.
Schreyer betonte gegenüber seinen Mitstreitern immer wieder die symbolische Bedeutung des
Bühnenspiels. Er wies darauf hin, dass im „Wort Kunst, das vom althochdeutschen ‚kunnan’ kommt,
[…] nicht nur das Können, sondern auch das Künden, geistiges Innehaben“ steckt.18 Hans
16
Eine differenzierte Auseinandersetzung mit den inneren Zusammenhängen von Musik und Bildenden Künsten,
an die in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts „geradezu dogmatisch geglaubt wurde“ (Karl Schawelka),
bieten u. a. die folgenden Arbeiten: Karl Schawelka: Johannes Itten und die Musik. In: Christa
Lichtenstern/Christoph Wagner (Hrsg.): Johannes Itten und die Moderne. Ostfildern-Ruit: Hatje Cantz Verlag, S.
157–175. Karl Schawelka: Quasi una musica. Untersuchungen zum Ideal des „Musikalischen“ in der Malerei ab
1800. München 1993: Mäander Verlag
17
Tut Schlemmer: … vom lebendigen Bauhaus und seiner Bühne. In: Neumann (Hrsg.): Bauhaus und
Bauhäusler, S. 230
18
Hans Haffenrichter: Lothar Schreyer und die Bauhaus-Bühne. In: Neumann (Hrsg.): Bauhaus und Bauhäusler,
S. 120 f.Haffenrichter (1897–1981), Bauhaus-Schüler und einer der engsten Mitstreiter Schreyers, bekennt,
dass ihn dieser Kunstbegriff zeitlebend begleitet habe und kommentiert: „Der Künstler ist nicht nur
Gestalter und Interpret seiner Zeit, sondern er muß sich seiner Verantwortung bewußt werden, neue
Wege zu suchen, die den Menschen weiterbringen, zu einer höheren geistigen Stufe, zu neuen
Horizonten.“19 Die Harmonisierungsübungen von Gertrud Grunow sah er dabei als wichtige Brücke.20
Worin die „höhere geistige Stufe“, die „neuen Horizonte“ bestehen sollten, darüber entbrannten
allerdings heftige Dispute. Im Vorfeld einer Aufführung im Jahre 1923 (Mondspiel) eskalierten sie
sogar derart, dass Schreyer aufgab und das Bauhaus verließ. Widerstand erzeugten vor allem die
mystischen Tendenzen, die Schreyer mit seinen Theaterkonzepten verband. In Weihebotschaften,
Erlösungsvisionen und der Idee „kultischer Gemeinschaftshandlungen“ sahen viele keine
Perspektiven, sondern eine Sackgasse der Bühnenarbeit. Zu dieser Zeit, kurz vor der Übersiedlung
des Bauhauses nach Dessau, wurde zugleich ein Richtungswandel am Bauhaus spürbar, begleitet
von heftigem Für und Wider: Das war, wie Hans Haffenrichter schreibt, „die Richtungswende von
Expressionismus und Kubismus hin zu Konstruktivismus und Funktionalismus“, verbunden mit der
„Umstellung vom Handwerk auf Maschine und Industrie“.21
Bekenntnis zum Mensch: Oskar Schlemmer
Sofort nach dem Weggang Schreyers wurde die Bühnenarbeit Oskar Schlemmer übertragen.
Schlemmer war Leiter der Werkstatt für Holz- und Steinbildhauerei. Ihn beschäftigten schon geraume
Zeit Möglichkeiten alternativer Bühnenkunst. So hatte er als Tänzer und als Clown mit einem großen
Ausdrucksspektrum Bewunderung gefunden und seit 1914 an seinem choreographischen Hauptwerk
gearbeitet, dem Triadischen Ballett. Dieses Werk wurde 1923, ein Jahr nach der Stuttgarter Premiere,
während der Bauhaus-Woche in Weimar aufgeführt. Die Erfahrungen, die Schlemmer mit diesem
„Fest in Form und Farbe“22 gesammelt hatte, boten wichtige Anknüpfungspunkte für kunsttheoretische
Untersuchungen in der folgenden Zeit. Diese fanden Niederschlag in einem umfangreichen
Vortragsmanuskript von Oskar Schlemmer über Bühnenelemente (1929). Sie beeinflussten aber auch
maßgebend den Kurs Der Mensch, mit dem Schlemmer im Frühjahr 1928, anderthalb Jahre vor
seinem Weggang vom Bauhaus, beauftragt wurde.23
Damit sei auf einen wesentlichen Schwerpunkt im Schaffen des vielseitig tätigen Künstlers
hingewiesen: Schlemmer betrachtete die Bauhaus-Bühne nicht nur als ein ideales „chemisch-
physikalisches Laboratorium“24, um die Wirkung von Farben zu untersuchen. Im Mittelpunkt seiner
Bemühungen stand stets der Mensch, den er als „Mechanismus aus Zahl und Maß“ und als
„Organismus aus Fleisch und Blut“ begriff. Erst in der Balance von Zahl/Maß und Fleisch/Blut sah er
die Voraussetzungen für eine „vollkommene Bewegung von Mensch und Raum“ gegeben, so wie er
sie in seinen Tanzspielen erprobte.25 Dabei stand nicht die Individualisierung, sondern die Typisierung
des Ausdrucks im Vordergrund. Bewusst wurde der Akteur der Bühne „durch Trikots und Masken
vereinheitlicht“, denn er sollte „als Prototyp eines bestimmten Verhaltens gegenüber den formalen
Bühnenelementen“26 erscheinen, „als Synthese von Mensch und Marionette, von Natur- und
Kunstfigur“.27 In seiner starken Fixierung auf den Mensch unterschied sich Schlemmer von
Zeitgefährten, die sich vorrangig Fragen der Abstraktion der Bühnenmittel widmeten, beispielsweise
19
Ebenda, S. 121
20
Gertrud Grunow unterrichtete, vorliegenden Quellen zufolge, ab Ende 1919 am Bauhaus. Sie verließ die
Einrichtung, nach fortwährenden Angriffen gegen ihre Lehre, vor allem aus der Öffentlichkeit, 1924. Die
Harmonisierungsübungen waren fester Bestandteil des Vorkurses und begleiteten darüber hinaus die gesamte
Ausbildung. In praktischen Einzelstunden sollte jeder Schüler auf individuelle Weise Zusammenhänge von
Klang und Farbe erleben und diese in „ganz bestimmte Bewegungssequenzen“ umsetzen. „Das Erlebnis von
Klang und Farbe sollte wieder Zugang zu den unbewußten, schöpferischen Kräften schaffen und auf eine
unmittelbare Weise einen geistig-körperlichen Gleichgewichtszustand herstellen, damit im Einklang mit dieser
neuen Balance der Gestaltungsprozeß quasi ‚von innen her’ verstanden und in Gang gesetzt werden konnte.“
Hajo Düchting: Farbe am Bauhaus. Synthese und Synästhesie. Berlin 1996: Gebr. Mann Verlag, S. 42
21
Hans Haffenrichter, S. 120
22
Düchting: Farbe am Bauhaus, S. 150
23
Vgl. Oskar Schlemmer: Der Mensch. Unterricht am Bauhaus. Nachgelassene Aufzeichnungen. Redigiert,
eingeleitet und kommentiert von Heimo Kuchling. Neue Bauhausbücher. Mainz 1969: Florian Kupferberg
24
Oskar Schlemmer: Bühne. In: bauhaus 3. Dessau 1927. Zit. nach: Düchting: Farbe am Bauhaus, S. 151
25
Ebenda
26
Dirk Scheper: Die Bauhausbühne. In: Experiment Bauhaus. Das Bauhaus-Archiv, Berlin (West) zu Gast im
Bauhaus Dessau. Ausstellungskatalog Bauhaus-Archiv. Berlin 1988, S. 256. Zit. nach. Magdalena Droste:
bauhaus 1919–1933. Köln 1988: Benedikt Taschen Verlag, S. 158
27
Karin v. Maur: In: Oskar Schlemmer. Ausstellungskatalog Staatsgalerie 1977, S. 200Kurt Schmidt (1901–1991) mit der Mechanischen Szene, dem Abstrakten Bühnenspiel und vor allem
dem Mechanischen Ballett, das wie Schlemmers Triadisches Ballett 1923 zur Bauhaus-Woche gezeigt
wurde.
Am Rande der Existenz und das Theater der Totalität
Bühne und Bühnenwerkstatt mussten stärker als andere Abteilungen des Bauhauses komplizierten
materiellen Bedingungen trotzen. Wiederholt stand die Existenz in Frage. Bereits Lothar Schreyer
hatte ein großes Bild von Fernand Léger, das sich in seinem Besitz befand, verkauft, um die
Weiterarbeit zu ermöglichen. Walter Gropius erwog zum Zeitpunkt des Umzugs nach Dessau sogar,
den ohnehin bescheidenen Etat für die Bühne komplett zu streichen, da diese nicht wie andere
Bauhaus-Werkstätten finanziellen Ertrag einbrachte. Diese Tatsache, ausbleibende Ausnahmen,
machte er den Bühnen-Mitarbeitern keineswegs zum Vorwurf, hatte er doch von Beginn an ein
Experimentiertheater favorisiert und nicht ein traditionelles Repräsentations- und Geschäftstheater.
Aber er konnte die Realität ökonomischer Zwänge nicht ignorieren, zumal in der damaligen Zeit.
So fehlte die Bühnenarbeit zunächst in den Ankündigungen des Bauhauses Dessau und im ersten
Verzeichnis nach der Übersiedlung. Erst im Lehrplan 1927 wurde sie wieder aufgeführt. Gleichwohl
ließ Gropius im Dessauer Bauhausgebäude eine Bühne einrichten. Zwischen Aula und Mensa
platziert, konnte sie nach zwei Seiten hin geöffnet werden. Gegenüber Weimar bildete sie einen
Fortschritt, denn dort hatten die Bühnenkünstler meist das von Gropius umgebaute Theater in Jena
nutzen müssen. In Dessau nun stand eine Spielstätte im eigenen Haus zur Verfügung. Allerdings war
die Ausstattung sehr schlicht, ja geradezu anspruchslos. Mitte der zwanziger Jahre mussten sich die
Bühnenakteure mit 100 RM pro Semester begnügen. Deshalb konnten viele Ideen für die
Bühnenkonstruktion nicht realisiert werden. Dazu gehörte das Projekt einer mechanischen
Mehrzweckbühne, wie sie Joost Schmidt 1925/26 für Dessau entworfen hatte.
Die vergleichsweise schwierigen Ausgangsbedingungen wurden jedoch nicht als Mangel empfunden.
Sie stellten immer wieder eine besondere Herausforderung für die Künstler dar, sich nicht auf
Selbstmitleid und Mittelmaß einzulassen. Visionen wurden keineswegs resigniert aufgegeben. So
entstanden zahlreiche Skizzen, Beschreibungen und Modelle neuer Bühnenkonzepte. Dabei wurde
immer wieder die Notwendigkeit betont, von der konventionellen „Guckkastenbühne“ Abschied zu
nehmen, die der Theater-Sehnsucht nach neuen Ufern ebenso wenig Zeit und Raum bieten konnte
wie die dreidimensionale Bilderperspektive den Malern.
Schon 1925, noch vor der Eröffnung der Dessauer Bauhausbühne, war die Zukunft des Theaters zum
Thema eines eigenständigen Bandes der Bauhausbücher geworden. Ließen sich die Ideen schon
nicht in der Realität praktizieren, sollten sie wenigstens für alle Zeit festgehalten werden: als
Bestandsaufnahme, Diskussionsstoff und Selbstermunterung. Oskar Schlemmer steuerte einen
Aufsatz mit dem Titel Mensch und Kunstfigur bei. Darin fasste er seine langjährigen praktischen und
theoretischen Erfahrungen zusammen. László Moholy-Nagy setzte sich mit dem geschichtlichen,
gegenwärtigen und zukünftigen Theater auseinander. Als eigenes Beispiel für Versuche heutiger
Theatergestaltung veröffentlichte er die Partiturskizze zu einer mechanischen Exzentrik „für ein
Varieté“. Mit dieser verband er die „Forderung einer bis ins Letzte beherrschbaren, exakten Form- und
Bewegungsorganisation, welche die Synthese der dynamischen kontrastierenden Erscheinungen (von
Raum, Form, Bewegung, Ton und Licht) sein sollte“.28
Diese Konzeption verstand er zugleich als logische Reaktion auf das „dadaistische und futuristische
‚Theater der Überraschungen’“. Moholy-Nagys Bühne ist in drei Ebenen gegliedert: Die untere Ebene
dient „größeren“, die untere „kleineren Formen und Bewegungen“. Letztere verfügt über eine
aufklappbare Glasplatte als „präparierte Projektionswand für von der Rückseite der Bühne projizierte
Filmvorführungen“. Die mittlere Ebene, eine Zwischenbühne, nimmt mechanische Musikapparate auf,
„meist ohne Resonanzkasten, nur mit Schalltrichtern (Schlag-, Geräusch- und Blas-Instrumente)“.
Einzelne mit weißer Leinwand doppelt bespannte Wände der Bühne sollen „farbige Lichter aus
Scheinwerfern und Lichtbäumen durchlassen und zerstreuen“. Als kommendes Theater schwebte
Moholy-Nagy ein „Theater der Totalität“ vor, das einen Organismus aus „mannigfaltigen
Beziehungskomplexen von Licht, Raum, Fläche, Form, Bewegung, Ton, Mensch“ bildet.29
Anknüpfungsmöglichkeiten sah der experimentierfreudige Meister in unterschiedlichen Bereichen
zeitgenössischer künstlerischer Aktion. In seinem Beitrag nennt er Zirkus, Operette und Varieté, die
Clownerie von Chaplin und Fratellini. Darüber hinaus griff er Erfahrungen aus Experimenten mit
reflektorischen Farblichtspielen (Ludwig Hirschfeld-Mack, Alexander Lászlo) sowie mit abstrakten
28
Laszlo Moholy-Nagy: Theater, Zirkus, Varieté. In: Oskar Schlemmer/Laszlo Moholy-Nagy/Farkas Molnar:
Die Bühne am Bauhaus. Neue Bauhausbücher. Mainz ³/1985, S. 44 und S. 47 f.
29
Ebenda, S. 44Filmen auf. Licht galt als dynamische Alternative zum statischen Farbpigment, der Film als Ausdruck
realer – und nicht nur simulierter – Bewegung. Außerdem fühlte er sich einem Musikbegriff
verpflichtet, der Geräusche eine gleichrangige ästhetische Bedeutung beimaß wie dem tradierten
System an Tonhöhen und Tondauern.
Im Anschluss an Moholy-Nagys Beitrag stellte Farkas Molnár (1897–1945) den Entwurf eines U-
Theaters für vier Bühnenebenen vor, so benannt nach der u-förmigen Anordnung der verstell- und
drehbaren Sitze. Gropius griff Elemente dieses Konzeptes auf und wandelte sie ab, als er für Erwin
Piscator ein Totaltheater entwarf.
Auch nach Erscheinen des Buches riss die Suche nach neuen Ideen nicht ab. Andor Weininger, der
legendäre Sänger der Bauhausfeste, entwarf beispielsweise das Projekt eines Kugeltheaters (1926),
und Xanti Schawinsky, Mitglied der Bauhauskapelle, entwickelte ein Raumtheater (1926/27). Mit allen
diesen Konzepten verband sich die Sehnsucht nach Entgrenzung von Zeit und Raum. Sie schloss ein,
Abschied zu nehmen von gemalten Bühnenbildern, denn trotz abstrakter Gestaltungselemente
erkannten viele Künstler noch immer deutliche Grenzen: Die tradierte räumliche Begrenzung wurde
nicht grundsätzlich erschüttert. Gesucht wurde nach neuen Möglichkeiten. Einige Künstler
experimentierten anstellte tradierter Bühnenausstattungen mit farbigen Lichtprojektoren. Sie schätzten
Licht als Medium, das die Grenzen traditioneller Ausdrucksmittel aufbricht: Es schien die Statik von
Farben, die in herkömmlicher Weise mit Pinsel oder Spachtel auf Leinwände oder Papiere
aufgetragen wurden, zu überwinden und – mit „Lichtgeschwindigkeit“ – in unendliche Räume
vorzudringen. Und es ließ sich in vielfacher Weise zu komplexen visuellen Erscheinungen brechen.
Industriegesellschaft und Utopie
Das Theater blieb nicht unbeeinflusst von Ausdrucksformen und Wertmaßstäben der modernen
Industriegesellschaft. Zugleich warnten Künstler vor den Gefahren eines Wertesystems, das vorrangig
auf wirtschaftliche Leistungen und praktischen Nutzen ausgerichtet ist und zu wenig Raum bietet für
Utopien und Wunder, die schon immer mit dem Theater verknüpft waren. „Utopie? – Es bleibt in der
Tat verwunderlich wie wenig bis heute nach dieser Seite hin verwirklicht wurde. Die materialistisch-
praktische Zeit hat in Wahrheit den echten Sinn für das Spiel und das Wunder verloren. Der
Nützlichkeitssinn ist auf dem besten Weg sie zu töten. Voll Erstaunen über die sich überstürzenden
technischen Ereignisse nimmt sie diese Wunder des Zwecks als schon vollendete Kunstgestalt,
während sie tatsächlich nur die Voraussetzungen zu ihrer Bildung sind. ‚Kunst ist zwecklos’ insofern
die imaginären Bedürfnisse des Seelischen zwecklos zu nennen sind.“30
Die meisten alternativen Konzepte des Theaters, die am Bauhaus entwickelt wurden, zerbrachen an
den Bedingungen des Alltags. Einige Mitstreiter und Sympathisanten der Bauhaus-Bühne suchten, mit
der Realität konfrontiert, ihre Ideen an anderen Spielstätten oder in anderen künstlerischen Bereichen
zu erproben. Moholy-Nagy beispielsweise wandte sich verstärkt der Fotografie und dem abstrakten
Film zu, Metiers, die ihn bereits seit einiger Zeit – auch publizistisch – beschäftigt hatten. 1029 verließ
er das Bauhaus und zog als Bühnenbildner von Erwin Piscator nach Berlin. Dort entwarf er u. a.
Bühnenbauten nebst Lichtprojektionen für Jacques Offenbachs Hoffmanns Erzählungen, außerdem
wirkte er an einer Inszenierung von Franz Mehrings Der Kaufmann von Berlin mit (beide 1929). Oskar
Schlemmer übernahm Bühnenausstattungen für Breslau, wo er ab 1929 als Professor an der
Akademie für Kunst und Kunstgewerbe wirkte. Wassily Kandinsky (1866–1944) erhielt 1928 die
einmalige Gelegenheit, im Dessauer Friedrich-Theater ein Stück eigener Wahl nach eigenen
Vorstellungen zu inszenieren: Er entschied sich für die Bilder einer Ausstellung von Modest
Mussorgski (1839–1881). Den Maler reizte an in diesem Zyklus wohl vor allem, dass Beziehungen
zwischen Musik und Bildenden Künsten geknüpft werden, die weit über illustrative Momente
hinausreichen.
Bilder einer Ausstellung
Mussorgski war zu seiner Komposition 1874 in St. Petersburg durch eine Gedenkausstellung mit
Aquarellen, Zeichnungen, Architekturstudien und kunsthandwerklichen Arbeiten des Freundes Victor
Alexandrowitsch Hartmann (1834–1873) angeregt worden. Noch im gleichen Jahr begann er mit der
Komposition. Im Unterschied zu vielen programmatischen Werken der Zeit begnügte er sich nicht
damit, Objekte der Exposition lediglich in musikalische Bilder und Stimmungen zu übersetzen.
Stattdessen suchte er vor allem die zeitlich gegliederte Aktion des Ausstellungsbesuches mit einer
Vielzahl an simultanen Vorgängen zu erfassen. Im Grunde schrieb er ein szenisches
Instrumentalwerk: Ein Besucher – ein imaginärer oder der Komponist selbst – schreitet von Objekt zu
Objekt. Er verharrt, dringt in die Strukturen des jeweiligen Exponates ein und geht weiter. Dabei
30
Oskar Schlemmer: Mensch und Kunstfigur. In: Schlemmer/Moholy-Nagy/Molnar: Die Bühne am Bauhaus, S.
19 f.Sie können auch lesen