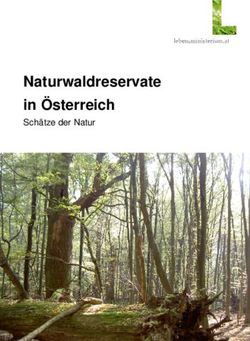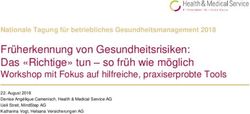Working Poor und Prekarisierung als neue Armutsphänomene - Rettet uns die Bildung? - überregionale Vernetzungstagung Initiative ...
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Working Poor und Prekarisierung als neue
Armutsphänomene – Rettet uns die Bildung?
19. überregionale Vernetzungstagung
Initiative Bildungsberatung Österreich
21.–22. Oktober, in SalzburgStruktur des Vortrags 1.) Einkommensarmut, Working Poor und Prekarisierung 2.) Rettet uns die Bildung? Das Leitbild des Sozialinvestitions-Staats 3.) Ein ressourcen-orientiertes Verständnis von Armut und seine Bedeutung für die Praxis der Beratung
EU-Definitionen von Armut Armutsgefährdung Als „armutsgefährdet“ gelten Menschen, die in Haushalten leben, deren Einkommen unter dem Schwellenwert von 60% des mittleren, an die Haushaltsgröße angepassten (= äquivalisierten) Einkommens liegt. Haushaltsbezug (arm oder nicht-arm ist immer der gesamte Haushalt Bezug auf eine „mittlere“ Person (bzw. Haushalt), die die obere von der unten Einkommenshälfte trennt. Schwellenwert von 60%
EU-Definitionen von Working Poor Working Poor sind … … Personen im Erwerbsalter (18–64 Jahre), die im Verlauf des Referenzjahres mehr als sechs Monate (Vollzeit oder Teilzeit) erwerbstätig waren und armutsgefährdet sind (= in einem armutsgefährdeten Haushalt leben).
Working Poor (18-64-Jährige, im Vorjahr mehr als 6 Monate erwerbstätig)
Gruppe Working Poor Anzahl Working-Poor Working-Poor
(als Anteil der Anteil von allen Anteil von allen
18 bis 64-J- Frauen Männer
Bevölkerung
Gesamtbevölkerung 7% 289.000 6% 8%
Nach Bürgerstatus
- ÖsterreicherInnen 5% 172.000 5% 5%
- Nicht-Ö.Innen 17% 118.000 12% 22%
Nach Bildungsstand
- max. Pflichtschule 17% 60.000 12% 22%
- Lehre 5% 108.000 6% 5%
Nach Haushalts-Konstellation
- Ein-Eltern-HH 22% 16.000 23% 11%
- Mehrpersonen-HH + 1 Kind 6% 48.000 6% 7%
- Mehrpersonen-HH + 3 u. m. K. 17% 37.000 10% 21%
Nach Bundesland
Wien / andere 11% / 6%-8% 95.000 13% 10%Working Poor: Situation der Frauen – jenseits der Betrachtung als Haushalt
Knittler / Heuberger 2018rWodurch entstehen Working Poor? Prekarität- und Niedriglohn 1.) Niedriglohn (= 2/3 des mittleren Lohns = 10,06 Euro / Stunde). 14,7% aller Beschäftigten erhalten Niedriglohn. (Jedoch wenig Veränderung innerhalb der letzten 10 Jahre.) 2.) Prekarität / atypische Beschäftigung
Veränderung der Arbeitsverhältnisse in Österreich
2005 2010 2015 2018 2020
Arbeitsverhältnisse 3.262.000 3.435.000 3.609.000 3.800.000 3.772.000
(unselbständig)
insgesamt
Normalarbeitsverhältnis 2.376.000 2.404.000 2.398.000 2.494.300 2.398.400
Andere
– Teilzeit (12 < AZ < 36 527.000 637.000 747.000 809.400 835.500
Wochenstd.)
– unter 12. Wochenstd. 126.000 163.000 189.000 189.700 163.900
(geringfügig)
– Befristung (ohne Lehre) 171.000 192.000 209.000 236.400 195.600
– Leih- und Zeitarbeit 53.000 68.000 78.000 90.000 78.800
– Freier Dienstvertrag 50.000 55.000 34.000 32.800 27.000
– Werkvertragsnehmer- ca. 45.000
Innen (= neue Selbst-
ständige)Teilzeit und Geschlecht
Angabe in 1.000 x 1.000
Daten: Statistik Austria 2021Leiharbeit / Arbeitskräfteüberlassung: Die Fakten Leiharbeit wurde in den letzten 20 Jahren in Österreich ausgeweitet. Weisen die Analysen für 1997 noch lediglich etwas mehr als 14.000 LeiharbeiterInnen aus, so sind im Jahresdurchschnitt 2016 bereits gut 63.400 Personen als LeiharbeiterInnen mit Einkommen oberhalb der Geringfügigkeitsgrenze tätig. LeiharbeiterInnen üben zunehmend sogenannte „höhere Tätigkeiten“ aus. Aktuell beträgt der Anteil der Leiharbeit an der Gesamtheit unselbst- ständiger Beschäftigung oberhalb der Geringfügigkeitsgrenze 1,8%. Auflösungen in der Probezeit – vor Anfall der Auflösungsabgabe (ab sechs Monaten) – sind sehr häufig der Fall (2016: 38%). Riesenfelder, Danzer, Wetzel (2017)
Leiharbeit / Arbeitskräfteüberlassung aus Sicht der Betroffenen
Fast ein Drittel der LeiharbeiterInnen (31%) äußert, dass es für die gleiche
Tätigkeit schlechter entlohnt wird als MitarbeiterInnen aus der
Stammbelegschaft.
Fast jede/r Fünfte ist unzufrieden mit dem eigenen Einkommen.
Rund 36% der LeiharbeiterInnen meinen, dass überlassene Arbeitskräfte
immer die schlechtesten Arbeiten machen müssen.
55% der LeiharbeitInnen sind gesundheitlich belastenden Arbeits-
situationen ausgesetzt.
Fast drei Viertel (73%) der LeiharbeiterInnen finden keine beruflichen
Entwicklungsmöglichkeiten vor.
In der Folge würde mehr als die Hälfte aller LeiharbeiterInnen ein Standard-
beschäftigungsverhältnis sehr stark bevorzugen (54%), weitere 15%
immerhin teilweise.
Riesenfelder, Danzer, Wetzel (2017)Fazit: Working Poor
Von 3,7 Millionen existierenden Arbeitsverhältnissen sind 1,3 Millionen (ca.
34%) keine Normalarbeitsverhältnisse.
Working Poor entsteht durch Niedriglöhne und prekäre Arbeitsverhältnisse
Während die Niedriglohnquote über die letzten Jahre stabil blieb, nahmen
die prekären Arbeitsverhältnisse zu.
Insbesondere Teilzeitarbeit, Befristungen und Leiharbeit nehmen zu.
Viele Menschen mit einem geringen Lohn werden durch Partner / andere
Haushaltsangehörige „querfinanziert“.
Was bedeutet Prekarität für die betroffenen Menschen?Veronika Bohrn Mena: Die neue ArbeiterInnenklasse. Menschen in prekären Verhältnissen [in Österreich]
Zonen-Modell der Prekarität nach Robert Castel
Zone des (stabilen)
Wohlstandes
Zone
der Prekarität
Zone
der AbgekoppeltenVerbreitung der drei Zonen in Österreich (Zandonella 2017)
Atypische Beschäftigung in den drei Zonen in Österreich (Zandonella 2017)
?
?
?
?Definition von Prekarität Dimensionen nach Keller und Seifert (2013, erweitert): Beschäftigungs(in)stabilität Geringere Einkommen Geringe Entwicklung der Beschäftigungsfähigkeit / berufliche Weiterbildung Geringere soziale Sicherung (z.B. Rentenprobleme im Alter). Beeinträchtigung der sozialen Netzwerke Definition nach Dörre (2014): „Ein Erwerbsverhältnis gilt dann als prekär, wenn es nicht dauerhaft oberhalb eines von der Gesell- schaft definierten kulturellen Minimums existenzsichernd ist und deshalb bei der Entfaltung in der Arbeitstätigkeit, gesellschaft- licher Wertschätzung und Anerkennung, der Integration in soziale Netzwerke, den politischen Partizipationschancen und der Mög- lichkeit zu längerfristiger Lebensplanung dauerhaft diskriminiert.“
Folgen von P.: Politische Kultur in den Zonen in Österreich (Zandonella 2017)
Santa Precaria by Andrea Messerschmid
Schwenk von einer keynesianischen Politik (Problem der fehlende Arbeits- plätze) zum Neoliberalismus (Problem zu hoher Lohnforderungen) Umdeutung von Arbeitslosigkeit und Sozialhilfe-Empfang als selbstverschuldet. Damit einhergehend Verschiebung der Verantwortung zu den ArbeitnehmerInnen. Veränderung der Wohlfahrtsstaats (Sozialstaatsabbau und Akti- vierung) sind Teil einer prekarisierenden Politik: Niedriglohntätigkeit erscheint zumutbarer und wird stärker erzwungen, z. B. durch zunehmende Sanktionierung am AMS (+45% seit 2017). Geringere Leistungen für Bedürftige In der Variante interventionsfreundlicher Länder: Stärkere Mittelschichtsorientierung von Leistungen (z.B. 1,6 Mrd. für Familienbonus plus bei Kürzung der Mindestsicherung / Sozialhilfe)
Schwenk von einer keynesianischen Politik (Problem der fehlende Arbeits- plätze) zum Neoliberalismus (Problem zu hoher Lohnforderungen) Es müssen neue / zusätzliche „Bewährungsproben“ in „neuen Wettkampfsystemen“ bestanden werden: An der Schwelle zwischen flexibler und fester Anstellung, beim AMS an der Schwelle zwischen Erwerbslosigkeit und Erwerbstätigkeit. Gleichzeitig werden einigen Bevölkerungsgruppen Rechte vorenthalten und sie dadurch in armen oder prekarisierten Verhältnissen gebracht: 24-Stunden-PflegerInnen AsylwerberInnen (während des Verfahrens nur Arbeit als ErntehelferIn oder SaisonarbeiterIn erlaubt). Rot-Weiß-Rot-Karten-InhaberInnen Vorläufig anerkannte Asylsuchende („Asyl auf Zeit“) und Geduldete
Produktion einer „prekarisierten Klasse“ (u.a. Roland Atzmüller) Prekarisierung muss daher als neue Organisationsform von Herrschaft und dem Verhältnisses von Staat zu BürgerInnen oder BewohnerInnen aufgefasst werden. Entsoldiarisierung (z.B. durch geteilte Belegschaften) als Teil einer wirtschaftspolitischen Strategie, die darin besteht Sphären zu bilden mit unterschiedlich umfassenden (sozialen und betriebli- chen) Rechten. Die reduzierten Rechte von Befristeten, Teilzeit- kräften – das sind oft Frauen, Mütter, MigrantInnen – sind das Ergebnis einer solchen Strategie. Prekarisierung muss als internationaler/transnationaler Prozess aufgefasst werden, da die Mobilität von Menschen Erscheinungs- form von Prekarisierung ist, jedoch Prekarisierung auch voranzu- treiben. Prekarisierung wird exportiert und die (Mehrheits-) Gesellschaft und reicheren Länder stabilisiert.
Flexibel statt prekär ? WKO: „Flexible Beschäftigungsformen sind keines- wegs ‚prekär‘, sondern ein Gewinn für Beschäftigte, Unternehmen und den Standort. Gerade jetzt sind sie gezielt zu nützen. Zu denken ist etwa an den verstärkten Einsatz von Betriebspraktika für Arbeitslose, v.a. auch für Flüchtlinge.“ Es besteht dabei die Gefahr einer weiteren Verbreitung von Prekarisierung! https://news.wko.at/news/oesterreich/position_neue_beschaeftigungsformen.html
Teil 2:
Rettet uns die Bildung? Das Leitbild des
Sozialinvestitions-StaatsLeitbild: Sozialinvestitionsstaat I (seit ca. Ende der 1990er) Im Sozialinvestitionsstaat wird Sozialpolitik stärker unter Investitions-Gesichtspunkten betrachtet. Sozialpolitik soll sich lohnen und rentabel sein. Dienstleistungen für junge Menschen stehen im Vordergrund (anstelle von finanziellen Leistungen für Ältere). Sozialinvestive Maßnahmen fokussieren insbesondere auf (Aus-)Bildung und Gesundheit, die als Voraussetzung für Erwerbsarbeit (Beschäftigungsfähigkeit = „Employability“) gesehen werden und einen Bedarf an Sozialleistungen präventiv verhindern sollen Problematisch ist, dass sich die Maßnahmen in der Praxis meist nur an den Bedürfnissen des Arbeitsmarktes ausrichten, einen einseitig aktivierenden Charakter haben, und häufig auf eine kurzfristige Integration in den Arbeitsmarkt abstellen („work-first“ statt „learn-first“). Maßnahmen ähneln dann dem neoliberalen Typ.
Leitbild: Sozialinvestitionsstaat III – Was ihn ausmacht … 1.) Neues Geschlechterbild „adult (permanent) worker“ statt „male bread winner“. 2.) Der Gedanke der Prävention wird wichtiger. 3.) Vorstellung, dass Gerechtigkeit über gleiche Ausgangschancen (im Bildungssystem) hergestellt werden kann. 4.) Die eigenen Verantwortung wird betont (Sich nicht zu bilden wird dann zur eigenen Verantwortung – jedoch Beibehaltung eines Schulsystem, das soziale Unterschiede produziert, auch die Diskriminierung auf dem Ausbildungsmarkt bleibt bestehen.) 5.) „Angebots-Orientierung der Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik“ (heißt, die ArbeitnehmerInnen sollen sich optimieren für den Arbeitsmarkt + Flexibilisierung der Arbeitnehmer) statt keynesianische Nachfrage- politik (bei der der Staat in Krisen mehr Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt selbst produziert.) 6.) Gleichzeitig zunehmender verpflichtender und aktivierender Charakter der Maßnahmen (z. B. Übergang Ausbildungsgarantie in Ausbildungspflicht)
Der Sozialinvestitionsstaat – Rettet uns die Bildung? Untersuchungen sind hier sehr kritisch: Armut verhindert die Nutzung von Bildungschancen. Des- halb muss gleichzeitig Armut bekämpft und Bildungs- chancen eingeräumt werden (Solga 2015). 20 Jahre Bemühungen innerhalb der EU haben kaum Erfolge hervorgebracht (vgl. Cantillon 2011), die Einkommens- ungleichheit steigt überall in Europa. Mehr Bildung produziert nicht per se mehr Arbeitsplätze, sondern führt gleichzeitig zu mehr Konkurrenz unter den Besser-Gebildeten. Eine kollektive Verbesserung einer Schicht wurde bisher nur durch hohen politischen Druck (z.B. 68er Bewegung) oder ökonomische Interessen der Regierung erreicht (Langer 2020).
Teil 3:
Ein ressourcen-orientiertes Verständnis von
Armut und seine Bedeutung für die Praxis der
BeratungMangel an Verwirklichungschancen (nach Amartya Sen)
Kritik an einer Orientierung materieller Ressourcen.
Die Möglichkeit der Umsetzung der Ressourcen in Ziele ist abhängig von
den individuellen Umsetzungsmöglichkeiten.
Ergebnis:
Ausgangssituation: Menge der Verwirklichungs- Welche individuellen Ziele
chancen (capabilities) und Lebensqualität
Gleiche Chancen? werden erreicht?
Bei Sen stehen die eigenen Zielsetzung der Betroffenen im Vordergrund.Ressourcen und Ressourcentransformation: Sen, Bourdieu und
psychologische Ressourcentheorien und Forschung zu Arbeitslosigkeit
Einkommen
(ökonomisches Kapital)
Psychische
Zeit
Ressourcen
Gesundheit Bildung
(kulturelles Kapital)
Soziales KapitalRessourcenorientierung – das Konzept „Ressourcenorientierung stellt auf Methoden, Vorgehensweisen und Haltungen ab, die die persönlichen wie auch die zwischen- menschlichen Potenziale, Stärken oder Kraftquellen von Individuen in den Vordergrund stellen.
Ressourcenorientierung und ihre zentralen Grundsätze
Unbeirrbarer Glaube an die Entwicklungsfähigkeit der KlientInnen
Vermeidung von defizitorientierten Eignungsfeststellung für berufliche
Tätigkeiten und Betonung der produktiven Veränderungsmöglichkeiten
Orientierung an den Zielen und Bedürfnissen der KlientInnen (anstelle
einer strikten Orientierung an der Beschäftigungsfähigkeit)
Ressourcen (Anerkennung, Vertrauen) entstehen in der Interaktion,
insbes. auch in Interaktionen von Beratungsprozessen, daher Absage an
eine automatisierte Erfassung (z.B. AMS-Algorithmus).
Positive Aktivierung durch intrinsische Motivation und Erleben von
Selbstwirksamkeit.
Nutzung sozialer Ressourcen unter Berücksichtigung von Hürden und der
Entstehung von Scham.
Ressourcenaustausch findet v. a. im Privaten (Partnerschaften, Familie)
statt. Wie persönlich muss oder darf Beratung sein? (In Abhängigkeit von
Institutionen, Beratungskontext und Absichten)Ressourcenrad
Ressourcenrad
Ressourcenkarte
Ressourcen und Stärken
Person Umgebung
BelastungenRessourcenaktivierung mittels „Ziellauf“ (Nina Ständer) Ziel: Fokussierung eines angestrebten Zieles (z. B. Schulabschluss oder Studiumsabschuss) Durchführung: Auf einem Blatt wird – ähnlich einem Brettspiel – der Weg zum Ziel verbildlicht (ggf. als Weg oder Jogging-strecke). Hürden und Aufgaben werden eingetragen und definiert. Über eine Spielfigur kann die eigene Position jeden Tag verfolgt werden. Es ist Platz für Umwege, Hürden, Erholungszeiten und „Plan-B- Varianten“. Der spielerische Zugang bringt Leichtigkeit in die Betrachtungen. Es können Fragen zu Höhen und Tiefen sowie vorhandenen Ängsten gestellt werden. Zeit kann so besser eingeteilt werden.
Danke fürs Zuhören!
Alban Knecht „Santa Precaria“
Andrea Messer-
www.albanknecht.de schmid 2017Bibliographie
Atzmüller, Roland (2009): Die Entwicklung der Arbeitsmarktpolitik in Öster-
reich. Dimensionen von Workfare in der österreichischen Sozialpolitik. In:
Kurswechsel, H. 4, S 24–34
Atzmüller, Roland / Krenn, Manfred / Papuschek, Ulrike (2012): Innere Aus-
höhlung und Fragmentierung des österreichischen Modells: Zur Entwicklung
von Erwerbslosigkeit, prekärer Beschäftigung und Arbeitsmarktpolitik, in:
Scherschel / Streckeisen / Krenn (Hrsg.): Neue Prekarität. Frankfurt:
Campus, S. 75ff.
Bohrn Mena, Veronika (2018): Die neue ArbeiterInnenklasse. Menschen in
prekären Verhältnissen. 3. Auflage. ÖGB-Verlag
Castel, Robert (2000): Die Metamorphosen der sozialen Frage. Eine Chronik
der Lohnarbeit. Konstanz: UVK
Cantillon, Bea (2011): The paradox of the social investment state: growth,
employment and poverty in the Lissbon era. In: Journal of European Social
Policy, 21, H. 5, S. 432–449
Hofmann, Julia (2015): Das Zeitalter des Prekariats. In: blog.arbeit-
wirtschaft.at. Online: http://blog.arbeit-wirtschaft.at/das-zeitalter-des-
prekariatesBibliographie
Knittler, Käthe / Heuberger, Richard (2018): Working Poor – ein neuer
Indikator. Forba Fachgespräch, Wien, 13.11. https://www.forba.at/wp-
content/uploads/2019/09/Handout_Heuberger_November-2018.pdf
Malli, Gerlinde: Spielräume der Bewältigung in einer prekären Welt. In:
Dimmel, Nikolaus / Schenk, Martin / Stelzer-Orthofer, Christine (Hrsg.) (2014):
Handbuch Armut in Österreich. 2. Auflage. Innsbruck, Wien, Bozen: Studien
Verlag. S. 394–495
Riesenfelder, Andreas / Danzer, Lisa / Wetzel, Petra (2017): Arbeitskräfte-
überlassung in Österreich. Sozialpolitische Studienreihe, Bd. 24
Solga, Helga / Becker, Rolf (2015): Bildung und materielle Ungleichheiten.
Der investive Sozialstaat auf dem Prüfstand: In: Soziologische Bildungs-
forschung. Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie
Sonderheft, 52, S. 459–487
Zandonella, Martina (2017): Auswirkungen prekärer Lebens- und Arbeits-
bedingungen auf die politische Kultur in Österreich. In: Wirtschaft und
Gesellschaft – WuG (Kammer für Arbeiter und Angestellte für Wien). Vol.
43(2), S. 263–296
http://emedien.arbeiterkammer.at/viewer/pdf/AC08890876_2017_02/wug_2017
_43_2_0263.pdfWeitere Literatur zu Armut, Ausgrenzung und Prekarität
Literaturliste
Forschung zu Armut und Ausgrenzung
Theoretische Konzepte, Indikatoren, qualitative und
quantitative Armutsforschung
Zugang über: http://www.albanknecht.de/materialien.html
Permanente Adresse der akt. Version:
http://www.albanknecht.de/materialien/Literatur_Armutsforschung.pdfSie können auch lesen