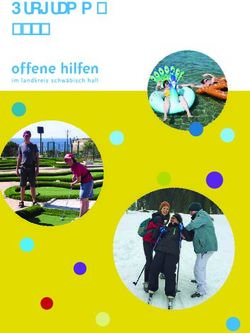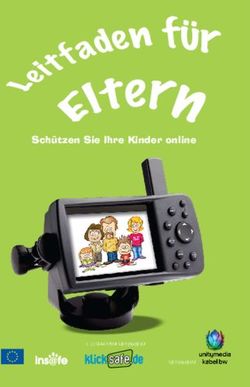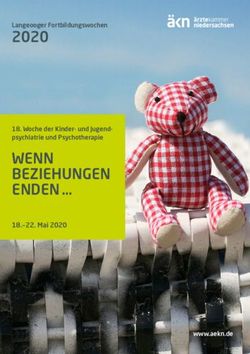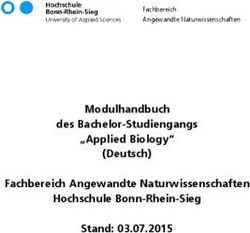Begleitheft zur Ausstellung - NETZwerk gegen häusliche und
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Inhaltsverzeichnis Seite
Einleitung
Ziel – Zielgruppe........................................................................................................................ 3
Inhalt der Ausstellung.................................................................................................................. 4
Einsatzmöglichkeiten und Ausstellung als Leihgabe.................................................................... 5
Informationen
Tafel 2 Gewalt in Paarbeziehungen und Text....................................................... 6 – 8
Tafel 3 – 6 Partnergewalt gegen Frauen hat viele Gesichter.................................... 9 – 13
„Warum geht die Frau nicht weg“ ......................................................... 13 – 14
Tafel 7 Die Gewaltspirale und Text .................................................................. 15 – 18
Tafel 8 – 13 Gewalt ist nie privat!............................................................................. 19 – 24
Intervention
Tafel 14 Schritte aus der Gewalt ................................................................................ 25
Tafel 15 Platzverweis und Text .......................................................................... 26 – 27
Tafel 16 Das Gewaltschutzgesetz...................................................................... 28 – 29
Tafel 17 – 18: Netzwerk Häusliche Gewalt und Text................................................... 30 – 32
Prävention
Tafel 19 Kinder misshandelter Mütter und Text.................................................. 33 – 36
Tafel 20 Über ein Fünftel aller Kinder… und Text .............................................. 37 – 39
Hilfe für Kinder misshandelter Mütter ................................................... 39 – 40
Tafel 21 Leertafel zur individuellen Gestaltung .......................................................... 41
Tipps für Kids ............................................................................................... 42
Tafel 22 Wenn ein Kind denkt …................................................................................ 43
Tafel 23 Wenn ein Kind spürt…….............................................................................. 44
Tafel 24 Wenn ein Kind mit anhören muss................................................................. 45
Tafel 26 Wenn ein Kind mit ansehen muss …............................................................ 46
Tafel 27 Gewalt in der Familie „Nummer gegen Kummer“.......................................... 47
Being in Love … ............................................................................................................. 48 – 50
Tafeln 28 – 32 Being in Love….................................................................................... 51 – 55
Date rape ............................................................................................. 56 – 57
Referenzen ............................................................................................................. 58 – 59
Impressum ..................................................................................................................... 60
Aus Gründen der Lesbarkeit wurde in dem Begleitheft, außer in der direkten Anrede, auf die
Geschlechterunterscheidung verzichtet.
4Einleitung
Die Ausstellung „Zerrissen – Kinder als Opfer häuslicher Gewalt“ ist ein Gemeinschaftsprojekt
des Ministeriums für Gesundheit und Soziales Sachsen-Anhalt, des Landeskriminalamtes
Sachsen-Anhalt, der LIKO – Landesintervention und Koordination bei häuslicher Gewalt und
Stalking in Sachsen-Anhalt, mit Unterstützung durch die Fachhochschule Polizei Sachsen-
Anhalt zur Bekämpfung der Gewalt gegen Frauen und Kinder im häuslichen Bereich.
Unsere Ausstellung „Zerrissen – Kinder als Opfer häuslicher Gewalt“ wendet sich an vorrangig
Betroffene, die innerhalb einer bestehenden Ehe oder nichtehelichen Partnerschaft Gewalt
erfahren oder Gewalt erfahren haben. In Paarbeziehungen sind die Täter überwiegend Männer,
die Gewalt richtet sich meist gegen Frauen. Dabei geht Gewaltanwendung häufig über die
Paarbeziehung hinaus, so dass zum Beispiel auch Kinder gefährdet sein können.
Insbesondere der präventive Blickwinkel ist nicht nur für die Polizei von großem Interesse. Hierin
besteht die Möglichkeit zu verhindern, dass im familiären Umfeld gelernte Opfer- und Täterrollen
über die Kinder in gewaltgeprägten Familien „sozial weitervererbt“ werden.
Die Polizei ist ein wesentlicher Netzwerkpartner auch im Rahmen dieser Thematik, sowohl in
repressiver als auch in präventiver Hinsicht.
Ziel
Unsere Ausstellung „Zerrissen – Kinder als Opfer häuslicher Gewalt“ verfolgt das Ziel, nicht nur
Betroffenen eine Hilfestellung zu geben, sondern allen Bürgern diese brisante Thematik nahe zu
bringen.
Viele Opfer wagen auf Grund der hohen Schambelastung ihrer Situation nicht den Schritt, sich
an Hilfeeinrichtungen zu wenden. Und häufig wissen sie auch nicht, dass sie eine Vielzahl von
Möglichkeiten zu ihrem Schutz und dem ihrer Kinder sowie zum Aufbau eines „neuen“,
gewaltfreien Lebens in Anspruch nehmen können.
Wir wollen erreichen, dass jedem Besucher der Ausstellung bewusst wird:
► Halten Sie sich vor Augen, dass Sie der Gewalt nicht
hilflos ausgeliefert sind. Bedenken Sie: durch Nichthandeln
schützen Sie Straftäter. Reagieren Sie so schnell wie möglich.
Wird Gewalt nicht unterbrochen, kann sie sich steigern!
Zielgruppe
Insbesondere werden Kinder und Jugendliche angesprochen. Viele Kinder und Jugendliche
erleben in ihrer Primärfamilie sowohl Gewalt zwischen den Eltern als auch unmittelbar
körperliche und psychische Gewalt.
Kinder misshandelter Mütter brauchen nicht nur Unterstützung, um die zwischen den Eltern
erlebte Gewalt zu verarbeiten, sondern auch weitere Hilfe, damit Erziehungs- und
Fürsorgedefizite, die üblicherweise in gewaltgeprägten Familien auftreten, aufgefangen werden
können.
3Inhalt
Die Ausstellung gliedert sich in drei Komplexe:
Informationsteil
Hier werden grundsätzliche Fakten zu häuslicher Gewalt dargestellt und die „Gewaltspirale wird
erläutert, in der besonders deutlich zum Ausdruck kommt, warum Frauen in einer
gewaltgeprägten Beziehung so große Schwierigkeiten haben, diese zu beenden.
Durch diesen Teil ist es zum einen möglich, betroffenen Frauen aufzuzeigen, dass sie kein
Einzelfall sind und sich nicht schämen müssen, wenn sie bisher keine oder nur ungenügende
Versuche unternommen haben, der gewalttätigen Beziehung in all seinen Fassetten zu
entkommen.
Darüber hinaus wird Verständnis für das von Außenstehenden oft als inkonsequent und paradox
empfundene Verhalten der von Gewalt betroffenen Frauen gefordert.
Interventionsteil
Besucher werden an dieser Stelle über die Arbeit der Netzwerkpartner zur Bekämpfung der
Gewalt gegen Frauen im häuslichen Bereich informiert.
Präventionsteil
Es gilt, neben der Intervention auch die Prävention zu stärken. Die Kinder misshandelter Mütter
müssen stärker als bisher in den Fokus der Betrachtung genommen werden.
Dies gilt natürlich in besonderem Maße, wenn die Kinder zusätzlich auch selbst körperliche
Gewalt erleiden.
Wichtig sind auch geschlechtsspezifische Unterstützungsangebote zur Verarbeitung vorherr-
schender Rollenbilder und zur Entwicklung alternativer Männlichkeits- und Weiblichkeitsmodelle.
Von familiärer Gewalt betroffene Kinder und insbesondere Jugendliche suchen sich als ersten
Ansprechpartner in der Regel Gleichaltrige, ihre peer group.
Deshalb ist es wichtig, mit den Informationen der Ausstellung nicht nur die betroffenen Minder-
jährigen, sondern auch ihre Freundinnen und Freunde anzusprechen.
Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, den Film „Kennst du das auch?“ über DVD-Spieler oder
PC zu präsentieren. Dieser Film wird durch das Berliner Interventionsprojekt gegen häusliche
Gewalt (BIG e.V.) vertrieben und ist für den Einsatz an Schulen und Kindereinrichtungen für die
Altersgruppe der Acht- bis 14jährigen gedacht. Im Film kommen fünf Kinder zur Sprache, die
Gewalt von Männern gegenüber ihren Müttern erfahren haben und berichten von ihren Gefühlen
und Ängsten, aber auch davon, wie sie den Mut fanden, sich Hilfe zu holen. Der
urheberrechtlich geschützte Film wird mit der Ausstellung verliehen und muss auch mit dieser
zurück gegeben werden.
Weitere Präventionstafeln (gesonderte Anforderung) thematisieren Paarbeziehungen unter
Jugendlichen und Heranwachsenden. Unter Einbeziehung geschlechtstypischer Besonderheiten
soll der Blick dafür geschärft werden, woran die Jugendlichen merken können, ob sie sich in
einer „ungesunden“ Beziehung befinden oder ob ihre Beziehung in Ordnung ist.
4Dieser Ausstellungsteil sollte von Netzwerken und Lehrkräften für begleitende Projekte
gegen respektloses, dominierendes Beziehungsverhalten und insbesondere gegen sexuelle
Gewalt in der Entstehungsphase von Teenagerbeziehungen genutzt werden.
Einsatzmöglichkeiten
Die Ausstellung wird in Verantwortung des Landeskriminalamtes Sachsen-Anhalt kostenfrei an
örtliche Netzwerke gegen häusliche Gewalt ausgeliehen. Empfohlen wird die Nutzung eines
zentralen öffentlichen Gebäudes, zum Beispiel des örtlichen Rathauses.
Um Jugendliche ansprechen zu können, sollen Schulen eingebunden und Vorbesprechungen
mit interessierten Lehrkräften durchgeführt werden. Mitarbeiter von örtlichen
Gewaltberatungsstellen und Jugendhilfe sollten in Zusammenarbeit mit der örtlichen Polizei
Ausstellungsführungen für Jugendliche gewährleisten und sich dabei als örtliche
Ansprechpartner persönlich bekannt machen. So kann die Hemmschwelle zur
Inanspruchnahme von Unterstützung gesenkt und auch Zivilcourage im Sinne von Hinschauen
und der Organisation von Hilfe durch Netzwerkintervention gefördert werden.
Tipp:
Die Wirkung der sowohl informativen als auch emotional ansprechenden Ausstellung kann
wesentlich erhöht werden, wenn Schulen den Ausstellungsbesuch mit Hilfe des örtlichen
Netzwerkes gegen häusliche Gewalt vor- und nachbereiten. Unterstützend kann hierfür das
Begleitheft zur Ausstellung verwendet werden.
Sehr effektvoll können auch Kooperationen mit der Polizei und der Justiz sein.
Schulklassen können nach einem Vortrag über polizeilich/rechtlich Relevantes zum Thema zum
Beispiel eine öffentliche Gerichtsverhandlung besuchen, in der über einen Fall häuslicher
Gewalt verhandelt wird.
Ausstellung als Leihgabe
Die Ausstellung wird den Nutzern kostenfrei und im Wochentakt zur Verfügung gestellt. Die
Anlieferung, der Auf- bzw. Abbau erfolgen jeweils montags.
Der Einsatz der Ausstellung für Tagesveranstaltungen ist nur in Ausnahmefällen möglich.
Nicht im Lieferumfang enthalten sind eine Eingangstür zum symbolischen Betreten einer
Wohnung sowie Abspieltechnik für Power Point- oder Videopräsentationen.
Um die Ausstellung termingerecht nutzen zu können, wird eine frühzeitige Vorbestellung (von
mindestens 12 Wochen) empfohlen.
Sollten wesentliche Ausstellungsteile vorsätzlich oder durch grobe Fahrlässigkeit zu Bruch
gehen oder anderweitig in Mitleidenschaft gezogen werden, hat der Nutzer für den
entstandenen Schaden einzustehen.
Sämtliche Schadensfälle sind umgehend anzuzeigen, damit defekte Teile sofort durch das
Landeskriminalamt Sachsen-Anhalt ersetzt werden können.
Zur Vorbestellung und Detailabsprache wenden Sie sich an das Landeskriminalamt Sachsen-
Anhalt, Dezernat Polizeiliche Kriminalprävention, Lübecker Straße 53-63, in 39124 Magdeburg,
Telefon: 0391/250 App.: 1200, 1206, 1216 oder per E-Mail: PraeventionG@lka.pol.sachsen-
anhalt.de.
5Gewalt in Paarbeziehungen
Um die Häufigkeit psychischer Gewaltausübung in Paarbeziehungen zu identifizieren, wurden
alle Frauen (die von körperlicher oder auch sexueller Gewalt betroffenen ebenso wie die nicht
davon betroffenen), die aktuell in einer Partnerschaft leben, nach Kontroll- und
Dominanzverhalten des Partners befragt.
Die Fragen bezogen sich auf unterschiedliche Dimensionen von psychischer Gewalt in
Paarbeziehungen: verbalen Aggressionen, Beleidigungen und Demütigungen, extreme
Kontrolle, Eifersucht, Isolation und Einschränkung des Bewegungsspielraumes, bis hin zu
Drohungen verschiedenster Art und schließlich ökonomischer Gewalt und Entmündigung.
Die Befunde zeigen auf, dass dort, wo in einem höheren Maße psychische Gewalt, Dominanz
und Kontrolle in Paarbeziehungen ausgeübt wird, die Wahrscheinlichkeit von körperlicher und
sexueller Gewalt ebenfalls hoch ist, und dass andersherum in durch körperliche und auch
sexuelle Gewalt belasteten Paarbeziehungen auch häufiger psychische Gewalt ausgeübt wird.1
Auch wenn körperliche sowie sexuelle (bzw. sexualisierte) Gewalt in Paarbeziehungen kein
spezielles Problem bestimmter Bevölkerungsschichten ist, sondern Bildungs- und
Einkommensschicht übergreifend auftritt, konnte die BMFSFJ-Studie zu Gewalt im Leben von
Frauen dennoch tendenziell eine stärkere Belastung der Bevölkerungsgruppen mit niedrigem
Bildungsstand feststellen. Danach haben fast 45 % der gewalttätigen Partner keinen oder einen
niedrigen Schulabschluss (Volks- oder Hauptschule).2
Ähnliches gilt in Bezug auf die Erwerbstätigkeit der gewalttätigen Männer:
„… der höhere Anteil der nicht Erwerbstätigen bei den Gewalt ausübenden Partnern bleibt aber
dennoch deutlich bestehen. Diese Befunde geben erste Hinweise darauf, dass zwar Gewalt
durch männliche Beziehungspartner keineswegs nur oder überwiegend durch arbeitslose
Männer verübt wird und damit erklärt werden kann – dafür sind die Anteile der Erwerbstätigen zu
hoch –, dass aber der Anteil der arbeitslosen oder nicht erwerbstätigen Männer bei den Gewalt
ausübenden Männern deutlich höher liegt und der Faktor bei einem Teil der Gewalt in
Paarbeziehungen eine Rolle spielen könnte.3
Auch Pfeiffer stellte in einer Studie des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen
(KFN) fest, dass ein signifikanter Zusammenhang zwischen der Erwerbslosigkeit des Vaters und
dem Auftreten häuslicher Gewalt besteht.
In seiner Befragung von Jugendlichen gab jeder Sechste, dessen Vater erwerbslos oder auch
Sozialhilfeempfänger ist, an, häufiger beobachtet zu haben, wie seine Mutter vom Partner
geschlagen oder getreten wurde. Dies wurde in Familien, in denen der Vater erwerbstätig war,
lediglich in gut 5 % der Fälle dokumentiert.4
1
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ): Lebenssituation,
Sicherheit und Gesundheit von Frauen in Deutschland: 247-251
2
ebd.: 243
3
ebd.: 244
4
Pfeiffer, C., Wetzels, P., Enzmann, D., 1999: Innerfamiliäre Gewalt gegen Kinder und
Jugendliche und ihre Auswirkungen: 14-15
7Dagegen konnte kein signifikanter Zusammenhang zwischen dem Nettoeinkommen des
gewalttätigen Partners und der Ausübung von Gewalt gegen die Partnerin festgestellt werden.5
Als Situationen, in denen es zum ersten Mal zu Gewaltausübung kam, wurden die Heirat und
zum Beispiel auch das Zusammenziehen genannt (ca. 38 und 34 %).
Auch der Beginn einer Schwangerschaft [(10 %), zudem wird jede sechste Frau während der
Schwangerschaft von ihrem Partner misshandelt6)], die Geburt des Kindes (fast 20 %) oder der
Entschluss der Frau zur Trennung (17 %) konnten als Auslöser identifiziert werden.7
Eine Auswertung der Polizeilichen Kriminalstatistik hinsichtlich häuslicher Gewalt, hat ergeben,
dass im polizeilichen Hellfeld, also bei jenen Fällen, die der Polizei zur Kenntnis gelangt sind,
ca. 90 % aller Opfer weiblich waren und über 95 % der weiblichen Geschädigten Opfer eines
männlichen Täters wurden. Bei männlichen Opfern hingegen hielten sich weibliche und
männliche Täter in etwa die Waage.
Im Hellfeld der Polizeilichen Kriminalstatistik ist die Gewaltbelastung über Jahre konstant drei
Mal höher als die von Frauen.8
Um Aussagen zur Gewaltbelastung von Männern treffen zu können, gab das Bundesministerium
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSJ) die Pilotstudie „Gewalt gegen Männer in
Deutschland“ in Auftrag. Dieser zufolge sind auch Männer von Gewalt betroffen, sogar in einem
höherem Maß, als dieses für Frauen zutrifft. 90 % aller körperlichen Gewalttaten, die Männer
erleben, geschehen in der Öffentlichkeit und im Freizeitbereich durch (meist männliche)
Unbekannte, Nachbarn, Bekannte und Freunde. Dagegen erleben Männer psychische Gewalt
häufig am Arbeitsplatz durch (meist männliche) Vorgesetzte.9
Dennoch werden auch Männer Opfer von Gewalt durch ihren Partner oder Expartner.
Auch hier reichen die Gewaltwiderfahrnisse vom Ausüben leichten psychischen Drucks bis hin
zu schweren und gefährlichen Körperverletzungsdelikten.
Tipp:
Nähere Informationen hierzu können Sie sich im Internet unter www.bmfsfj.de (Publikationen)
herunter laden.
5
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend: Lebenssituation, Sicherheit und Gesundheit von
Frauen in Deutschland: 246
6
Heise, Lori L., 1994: Gender-based violence and women’s reproductive health: 221-229
7
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend: Lebenssituation, Sicherheit und
Gesundheit von Frauen in Deutschland: 220-262
8
BMFSFJ: Gewalt gegen Männer in Deutschland: 256
9
ebd.: 297ff
89
Plakat: Finanzielle Gewalt
(Tafel 4)
10Plakat: Körperliche Gewalt
(Tafel 6)
11Plakat: Sexuelle Gewalt
(Tafel 7)
12Partnergewalt gegen Frauen hat viele Gesichter
Beziehungen, in denen häufig bis regelmäßig schwere Gewalt ausgeübt wird, werden in der
Fachdiskussion als Misshandlungsbeziehungen bezeichnet. In solchen Beziehungen dienen
Gewalt oder Gewaltdrohungen hauptsächlich dazu, die andere Person in eine schwächere
Position zu versetzen und die eigene Machtposition zu erhalten oder auszubauen.10 Gewalt
zwischen Intimpartnern beinhaltet nicht nur körperliche Gewalt wie Schlagen, Stoßen, Treten,
Würgen, Fesseln mit Gegenständen oder mit Waffen verletzen und bedrohen etc. Auch sexuelle
Gewalt ist eine Ausdrucksform von Partnergewalt, wobei die Frau zum Beispiel gezwungen wird,
sexuelle Handlungen unterschiedlichster Art, die sie nicht möchte, an sich vornehmen zu lassen
oder selbst vorzunehmen. Zudem kann es sein, dass der Mann sich weigert, ein Kondom zur
Verhütung von Geschlechtserkrankungen oder einer Schwangerschaft zu benutzen bzw. seine
Partnerin zur Prostitution zwingt. Einschüchterungen, Drohungen, Beleidigungen und
Demütigungen gehören zur psychischen Partnergewalt ebenso wie das Einschränken von
Kontakten, Kontrolle des Tagesablaufs, Einsperren, Isolieren und die Kinder oder Haustiere als
Druckmittel zu missbrauchen. Unter finanzieller Gewalt sind alle Maßnahmen des Täters zu
verstehen, mit denen er seine Partnerin ökonomisch von sich abhängig macht. Die
Gewaltformen treten selten einzeln auf, Übergänge sind fließend und die Abgrenzungen eher
theoretisch.
Alle Formen der Gewalt dienen letztendlich der Ausübung von Macht und Kontrolle in der
Beziehung.11
„Warum geht die Frau nicht endlich weg?“
Alle Opfer wollen, dass die Gewalt endet, aber längst nicht alle wollen die Beziehung
abbrechen. Außenstehende erwarten allerdings oft, dass Opfer ihren gewalttätigen Partner
verlassen. Kehren Frauen mehrmals zum Partner zurück und oder verharmlosen die erlebte
Gewalt, löst dies vor allem im privaten Umfeld der Opfer, jedoch auch bei manchen
Fachpersonen Hilflosigkeit und Unverständnis aus. Es wird dann bezweifelt, dass die
gewaltbetroffene Frau ihre Situation überhaupt verändern will. Viele der Opfer verlieren
daraufhin die Unterstützung durch ihr Umfeld und werden selbst für ihre Situation verantwortlich
gemacht: die Schuld wird vom Täter auf das Opfer verlagert. Neben der Gewalt macht die Frau
mit ihrem Mann auch positive Erfahrungen. Es gibt in der Beziehung gute Momente – dies
erschwert den Ausstieg aus der Gewaltspirale, denn die Frau klammert sich an die
unrealistische Hoffnung, die Gewalt sei zu Ende.
Hier spielt eine entscheidende Rolle die durch die Frau in ihrer Ursprungsfamilie erfahrene
Sozialisation: die höchste Viktimisierungsrate bei Frauen durch ihren Partner wurde dann
festgestellt, wenn die Frau als Kind sowohl Gewalt zwischen ihren Eltern miterlebt hat als auch
selber Opfer körperlicher Gewalt durch ihre Eltern wurde. Ebenfalls besteht ein signifikanter
Zusammenhang zwischen innerfamiliärer sexueller Viktimisierung von Mädchen und sexueller
Viktimisierung als Frau durch den Partner.12
10
Fachstelle gegen Gewalt/Eidg. Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann: FAKTENBLATT 7 Die Spirale der
Gewalt in Paarbeziehungen: 2
11
Mark, H., 2005: Häusliche Gewalt aus medizinischer Perspektive: 65
12
vgl. Wetzels, P., 1997: Gewalterfahrung in der Kindheit – Sexueller Missbrauch, körperliche Misshandlung und
deren langfristige Konsequenzen: 97ff.
13Auch Kinder spielen eine wichtige Rolle in der gewaltgeprägten Beziehung. Sie können ein
Grund sein, den Partner zu verlassen, damit sie nicht weiter der gewalttätigen Situation
ausgesetzt sein müssen. Manche Mütter schämen sich vor den Kindern, weil diese sie in
entwürdigenden Situationen erleben, denen sie ohnmächtig ausgeliefert sind. Kinder werden
aber ebenso oft als ein Grund gesehen beim Partner zu bleiben. Manche Frauen wollen, dass
die Kinder in einer traditionellen Familie mit Vater und Mutter aufwachsen können. Oder sie
trauen sich nicht zu, alleine für die Kinder zu sorgen. Neben diesen Gründen gibt es noch
weitere vielfältige Beweggründe für ein Bleiben oder Verharren der Frau in einer
gewaltgeprägten Beziehung:
• Scham- und Schuldgefühle
• Drohungen des Misshandlers (Nachstellungen, Drohung mit Mord, Selbstmord oder den
Kindern etwas anzutun werden häufig in der Trennungsphase geäußert und müssen
unbedingt ernst genommen werden!)
• Angst- und Ohnmachtgefühle (Angst vor Isolation, Angst, die Anforderungen nicht alleine
bewältigen zu können, das Gefühl, dass sowieso niemand helfen kann)
• Materielle Abhängigkeit
• Verlust des Lebensumfeldes (neue Wohnung, die Kinder müssen eine andere Schule
besuchen, sie verlieren ihren Freundes- und Bekanntenkreis, evtl. ist ein neuer Arbeitsplatz
nötig)
• Verlust familiärer Kontakte
• Traditionelles Partnerschafts- und Familienbild („die Familie nicht zerstören“, Frauen fühlen
sich verantwortlich für das „Funktionieren“ der Beziehung und der Familie)13
13
in Teilen zitiert nach Mark, H., 2005: Häusliche Gewalt aus medizinischer Perspektive: 66
14Plakat: Die Gewaltspirale
(Tafel 8)
15Die Gewaltspirale
In der Anfangszeit einer gewaltgeprägten Beziehung treten häufig kaum erkennbare Formen
von Gewalt auf. Kontrollierendes Verhalten und Dominanzstrategien des Täters können sich mit
liebevollem und zugewandtem Verhalten des Partners abwechseln, so dass viele Frauen ihrer
Wahrnehmung, dass das Verhalten ihres Partners nicht in Ordnung ist, misstrauen.
Mit der Dauer der Beziehung nimmt jedoch das Macht ausübende Verhalten oft an Häufigkeit
und Intensität zu. Auch die Dunkelfeldstudie des Bundesministeriums für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend zur Gewaltbelastung von Frauen wies in 47 % der Fälle eine Steigerung der
Häufigkeit der Gewalt nach, 27 % der Frauen gaben an, dass sich die Häufigkeit nicht geändert
habe. 14
Zur Intensität der Gewalt gaben 41 % der Frauen eine Steigerung, 37 % eine gleichbleibende
Intensität an.15
Misshandlungsbeziehungen sind von Gewalt geprägt, doch diese tritt nicht dauernd offen
zutage. Es entwickelt sich eine so genannte Gewaltspirale, die mit ihrem typischen Ablauf von
Spannungsaufbau – Misshandlung – Reue und liebevoller Zuwendung – Abschieben der
Verantwortung – Spannungsaufbau charakteristisch für gewaltgeprägte Partnerschaften ist.
Dieser Zyklus wiederholt sich, wird häufig von Mal zu Mal kürzer und die Gewalttaten schlimmer.
Meist kann er nur durch Intervention und Begleitung von außen durchbrochen werden. 16
Phase des Spannungsaufbaus
Diese Phase ist geprägt von Abwertungen, Demütigungen, Beschimpfungen. Die Frau versucht
körperliche Gewalttätigkeiten zu verhindern. Sie richtet ihre ganze Aufmerksamkeit auf den
Mann, eigene Bedürfnisse und Ängste werden unterdrückt. Sie hofft, auf diese Weise konflikt-
hafte Situationen und Misshandlungen frühzeitig erahnen und durch angepasstes Verhalten
vermeiden zu können. Mehr oder weniger unbewusst versucht der Mann durch die Demütigung
seiner Partnerin sein Bild von sich als Mann, also das, was er für männlich hält, zu stabilisieren.
Durch sein Kontroll- und Dominanzverhalten und die Herabwürdigung seiner Partnerin wehrt er
eigene Schwächegefühle und die Befürchtung, nicht männlich genug zu sein, ab. Früher oder
später kommt es häufig aus einem beliebigen Anlass zu einer Gewalteskalation.
Das Opfer kann trotz aller Versuche, auch mit „vorauseilendem Gehorsam“ den Ansprüchen und
Forderungen des Mannes gerecht zu werden, das gewalttätige Handeln des Gegenübers
letztlich nicht verhindern und kontrollieren.
14
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend: Lebenssituation, Sicherheit und Gesundheit von
Frauen in Deutschland: 269
15
ebd.
16
Die folgenden Darlegungen zur Gewaltspirale stützen sich , zu großen Teilen zitiert, auf die Fachstelle gegen
Gewalt/Eidg. Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann: Faktenblatt 7-Die Spirale der Gewalt in
Paarbeziehungen
16Phase der Misshandlung
Opfer reagieren in der Phase körperlicher Misshandlung unterschiedlich: Flucht, Gegenwehr
oder Ertragen der Misshandlung. Wenn die Gewalt nicht durch Flucht oder Gegenwehr beendet
werden kann, ist das Opfer den Misshandlungen ausgeliefert. Die Betroffene weiß nicht, wann
die Gewalt enden wird. Oft sind diese Situationen mit Todesängsten verbunden. Die erlittene
Gewalt, der Verlust jeglicher Kontrolle sowie die absolute Hilflosigkeit haben - neben
körperlichen Verletzungen - schwerwiegende psychische Folgen.
Manche Frauen geraten in einen Schockzustand, der über Tage anhalten kann. Wenn in einem
solchen Moment die Polizei gerufen wird, erscheint das Opfer vielleicht aggressiv, apathisch
oder widersprüchlich in den Aussagen. Oft entwickeln Opfer von schwerer häuslicher Gewalt so
genannte posttraumatische Belastungsstörungen, die sich in verschiedenen körperlichen,
psychischen und psychosomatischen Symptomen äußern. Typisch sind Schlafstörungen,
chronische Schmerzen, Ängstlichkeit, Verlust des Vertrauens in sich und andere Menschen.
Phase der Reue und Zuwendung
Nach einer akuten Misshandlung zeigt der Täter oft Reue. Er möchte das Geschehene rück-
gängig machen und verspricht, sein Verhalten zu ändern. Er schämt sich, fühlt sich ohnmächtig
und befürchtet, die Frau zu verlieren. Es gibt Männer, die in diesem Moment Hilfe suchen – z.B.
bei einer Beratungsstelle für Männer gegen Gewalt. Andere Männer appellieren an die Liebe
und an das Verantwortungsgefühl der Frau, beteuern, dass nur sie ihn retten könne. Dies gibt
der Frau ein Gefühl vermeintlicher Macht. Hoffend, dass sich der Partner nun wirklich verändere,
ziehen Frauen in dieser Phase häufig das Trennungsbegehren zurück oder widerrufen
Aussagen, die sie z.B. im Rahmen eines Strafverfahrens gemacht haben.
Manche Frauen kehren vom Frauenhaus nach Hause zurück oder brechen eingeleitete Bera-
tungsgespräche ab. Die Frau verdrängt die Erinnerungen an die Misshandlungen.
Außenstehenden gegenüber verteidigt die Frau vielleicht ihren Mann und verharmlost die
erlittene Gewalt, manche Frauen erinnern sich tatsächlich nicht mehr daran. Viele gewalttätige
Männer können ihre Versprechungen auch Drittpersonen gegenüber sehr glaubhaft darlegen.
Manchmal wirkt das Umfeld dahingehend auf die Frau ein, dass sie ihrem Partner verzeihen und
nochmals eine Chance geben soll.
Abschieben der Verantwortung
Nach der Reue folgt oft eine Suche nach der Ursache des Gewaltausbruchs. Zur traditionellen
Männerrolle gehört u.a., dass Männer sich wenig mit eigenen Gefühlen beschäftigen.
Die Wahrnehmung von Ohnmacht- und Schwächegefühlen wird oft abgewehrt und verdrängt.
Daher empfinden viele Männer die Gewalttat als etwas, das «über sie gekommen ist», das sie
nicht kontrollieren konnten. Dementsprechend suchen sie die Gründe nicht bei sich selbst,
sondern in äußeren Umständen (z.B. Alkoholkonsum, Schwierigkeiten bei der Arbeit) oder bei
der Partnerin: («Warum hast du mich gereizt?»).
Der Mann schiebt die Verantwortung ab, indem er die Schuld bei der Frau sucht. Da sich die
meisten Frauen aufgrund der erlernten traditionellen Geschlechterrolle u.a. immer noch als
verantwortlich für das Gelingen einer Beziehung fühlen, haben sie das Gefühl versagt zu haben,
denn es ist ihnen nicht gelungen, den Mann von der Gewaltausübung abzuhalten. Typisch ist,
dass gewaltbetroffene Frauen Schuldgefühle entwickeln, die Schuldzuweisung durch den Mann
akzeptieren und ihm verzeihen. Um das Gefühl der totalen Ohnmacht zu vermeiden, über-
nehmen sie oft sogar die Verantwortung für sein gewalttätiges Handeln («Ich habe ihn
provoziert»). Das gibt ihnen die Illusion, eine nächste Gewalteskalation verhindern zu können.
Frauen übernehmen so Verantwortung für eine Tat, die sie nicht begangen haben.
17Dementsprechend müssen sich Männer für ihr Verhalten nicht mehr verantwortlich fühlen. Und
die Frauen haben Schuldgefühle, weil sie das gewalttätige Verhalten des Partners nicht
verhindern konnten. Häufig beginnen Männer zu diesem Zeitpunkt, sich für ihre Reue, ihre
Tränen und Beteuerungen nach der Gewalteskalation zu schämen und sie als ein Zeichen von
Schwäche zu empfinden, die es abzuwehren gilt. Wenn weder Frau noch Mann Hilfe suchen,
um die ungelösten Grundprobleme in der Beziehung oder/und der eigenen Persönlichkeit
anzugehen, setzt schleichend die Phase des erneuten Spannungsaufbaus wieder ein. Irgendein
Anlass führt zu einer weiteren Gewalteskalation und die Spirale dreht sich erneut.
Die Erfahrungen von Polizei, Frauenhäusern und Opferberatungsstellen zeigen, dass die Miss -
handlungen oft mit der Zeit sogar häufiger und massiver werden.
Tipp:
Kostenlose Medien (Broschüren, Dokumentationen, CD-ROM etc.) zu den Themen
• Gewalt gegen Frauen
•. Netzwerkarbeit gegen häusliche Gewalt
• Kinder misshandelter Mütter
• Informationen für die Polizei, Justiz und Ärzteschaft
• Informationen für Betroffene
erhalten Sie beim Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
Alexanderplatz 6
10178 Berlin
www.bmfsfj.de
sowie Informationen und Hinweise unter www.polizei-beratung.de.
18Tafel 10 (Gewalt ist nie privat)
19Tafel Nr. 11 einfügen
(Eigentlich sind wir ein glückliches Paar)
20Tafel Nr. 12 einfügen
(Ich liebe Dich)
21Tafel Nr. 13 einfügen
(Eigentlich ist es nicht immer so)
22Tafel Nr. 14 einfügen
(Eigentlich führen wir eine perfekte Ehe)
23Tafel Nr. 15 einfügen
(Diagnose: Treppe herunter gefallen)
24Tafel Nr. 16 einfügen
(Schritt für Schritt aus der Gewalt)
25Tafel Nr. 17 einfügen
(Platzverweis)
26Platzverweis
Die Polizei wird im Rahmen der akuten Krisenintervention alle Maßnahmen ergreifen, die
Gefahren von den Opfern abwenden. Hier ist eines der wirkungsvollsten Instrumente der
polizeiliche Platzverweis aus Wohnungen, der in Sachsen-Anhalt im Gesetz über die öffentliche
Sicherheit und Ordnung geregelt ist.
Damit wird dem Täter das Betreten der gemeinsamen Wohnung und ggf. weiterer Orte sowie die
Annäherung an diese Orte für einen begrenzten Zeitraum von maximal 14 Tagen untersagt.
Der Platzverweis wird auf die Gefahrenprognose der Polizei gestützt und ist unabhängig von
einem Antrag der Betroffenen. Durch den Platzverweis soll die Gefahr unterbrochen werden, die
bei einer weiter bestehenden häuslichen Gemeinschaft für das Opfer in vielen Fällen weiterhin
droht.
Zudem wird den Betroffenen ein räumlicher und zeitlicher Schutzraum verschafft, in dem sie sich
in Sachsen-Anhalt insbesondere durch Beratungs- und Interventionsstellen professionell
beraten lassen können und bestärkt werden, weitere Schritte zu gehen, um für sich und ihre
Kinder ein gewaltfreies Leben aufzubauen (z. B. durch die Beantragung einer Schutzanordnung
und einen Antrag auf Zuweisung der Wohnung). Des Weiteren führt der Staat dem Täter durch
diese Maßnahme seine Verantwortung vor Augen (Wer schlägt, muss gehen!). Dies ist ein
entscheidender Unterschied im Vergleich zu den polizeilichen Möglichkeiten, die es gab, bevor
ein solcher Platzverweis gesetzlich geregelt war: der geschlagenen Frau blieb oft nichts anderes
übrig, als, ggf. mit ihren Kindern, die Wohnung zu verlassen und in ein Frauenhaus zu ziehen,
während der Mann, plakativ gesprochen, zu Hause sitzen bleiben und alle Annehmlichkeiten
des eigenen Heims in Anspruch nehmen konnte.
Dennoch können Frauen natürlich auch weiterhin mit ihren Kindern in ein Frauenhaus ziehen,
wenn ihnen dies sicherer erscheint. Einige Frauen haben Angst, dass ihr Mann sich nicht an den
Platzverweis halten wird und mit einem noch höheren Aggressionspotenzial zurückkehrt. Oder
sie können den Gedanken nicht ertragen, in der Wohnung verbleiben zu müssen, in der sie
teilweise jahrelang misshandelt worden sind. Vielleicht ist ihr Selbstvertrauen und ihr Selbst-
wertgefühl durch die Gewalterfahrung nahezu zerstört, so dass sie sich gar nicht mehr zutrauen
für sich und ihre Kinder alleine zu sorgen.
Tipp:
Informationen zur Vorbereitung einer „Flucht“ mit Hinweisen zum persönlichen Sicherheitsplan,
Packen einer Notfalltasche, Verhalten bei Gefahr, Tipps für Hilfe und Unterstützung u. v. m. sind
unter www.gewaltschutz.info (Vorbereitung) herunter zu laden.
27Tafel 18 (Gewaltschutzgesetz) einfügen
28Gewaltschutzgesetz
Mit dem „Gesetz zur Verbesserung des zivilgerichtlichen Schutzes bei Gewalttaten und
Nachstellungen sowie zur Erleichterung der Überlassung der Ehewohnung bei Trennung
(Gewaltschutzgesetz)“ vom 01.01.2002 wird den von häuslicher Gewalt Betroffenen eine weitere
effektive Schutzmöglichkeit zur Verfügung gestellt. Von Gewalt betroffene Frauen haben die
Möglichkeit, bei der Rechtsantragsstelle des Amtsgerichtes einen Antrag auf Zuweisung der
gemeinsam genutzten Wohnung zu stellen.
Diese Zuweisung ist völlig unabhängig von bestehenden Miet- oder Eigentumsverhältnissen und
wird bis maximal sechs Monate verfügt. Die Zuweisung kann einmalig um höchstens sechs
weitere Monate verlängert werden. Auch andere Anordnungen zum Schutz der Frau,
Annäherungsverbot, Verbot der Kontaktaufnahme etc., können von der Richterin oder dem
Richter erlassen werden. Diese Anordnungen gewinnen insbesondere in Fällen von Stalking
Bedeutung, in denen ein Mensch von einer anderen Person unzumutbar verfolgt und belästigt
wird. Zwar kann eine Schutzanordnung gegen einen Stalker auch dann erwirkt werden, wenn
zuvor keine Intimpartnerschaft bestanden hat, jedoch wird in jedem zweiten Stalkingfall das
Opfer vom ehemaligen Partner gestalkt17,18. Über 80 % sind beim Ex-Partner-Stalking die
Männer die Täter und die Frauen die Opfer. In den meisten dieser Fälle war die zuvor
bestehende Intimbeziehung durch häusliche Gewalt geprägt. In diesen Fällen besteht auch die
große Gefahr einer gewalttätigen Eskalation gegen die ehemalige Partnerin. Verstößt der Täter
gegen eine gerichtliche Schutzanordnung, so begeht er eine Straftat nach § 4 des
Gewaltschutzgesetzes. Gegen ihn wird eine Strafanzeige gefertigt, ein Ermittlungsverfahren
eingeleitet.
Die Umsetzung des Gewaltschutzgesetzes erfordert eine intensive Zusammenarbeit zwischen
Polizei, Beratungseinrichtungen und Justiz. Diese interdisziplinäre Kooperation setzt auf allen
Seiten ein hohes Maß an Kommunikations- und Vernetzungsbereitschaft voraus.
17
Wondrak, I., 2004:26
18
vgl. Löbmann, R., 2004:76
29Tafel 19 (Netzwerke häuslicher Gewalt)
30Netzwerk Häusliche Gewalt
In Sachsen-Anhalt gibt es ein flächendeckendes Netzwerk von über 40 Einrichtungen, wie
Opferberatungsstellen im sozialen Dienst der Justiz, Beratungsstellen für Opfer sexueller
Gewalt, Ambulante Frauenberatungsstellen, Frauenhäuser und Interventionsstellen, in denen
Opfer häuslicher Gewalt Hilfe und Unterstützung finden.
Hier werden die betroffenen Frauen beraten und mit ihnen ein individuell auf ihr Bedürfnis und
ihre Situation abgestimmtes Vorgehen (Unterstützung bei Antragstellungen, Behördengängen
bis hin zur Vermittlung eines Rechtsanwaltes) angeregt.
Durch einen kontinuierlichen Erfahrungsaustausch zwischen den Netzwerkbeteiligten soll
sichergestellt werden, dass die gewaltbetroffenen Frauen auf abgestimmte Hilfskonzepte
zurückgreifen können. Neben den genannten Institutionen sollten auch die Ärzteschaft und das
Krankenhauspflegepersonal, Beratungsanbieter für Frauen mit Migrationshintergrund und die
Jugendhilfe als wichtige Partner zur Bekämpfung der Gewalt im sozialen Nahraum mit
einbezogen werden.
Die Netzwerkpartner ermöglichen durch die Wahrnehmung der Schnittstellenfunktion zu den
anderen Netzwerkangeboten einen nahtlosen Weg von der Soforthilfe im akuten Geschehen
über eine Bestärkung der Frau, ihre Unterstützung und Begleitung bis hin zum Aufbau eines
neuen, gewaltfreien Lebens für sich und ihre Kinder.
Die zur Ausstellung gehörende Freitafel dient den örtlich ansässigen Netzwerkpartnern zur
Präsentation ihrer Interventionsmöglichkeiten.
31Tafel 20 (Netzwerke im Land Sachsen-Anhalt)
32Tafel 21 (Kinder misshandelter Mütter)
33Kinder misshandelter Mütter
Ist eine Frau der Gewalt ihres Partners ausgesetzt, werden im Haushalt lebende Kinder fast
immer Augen- oder Ohrenzeugen der Gewalttaten. Von den Frauen, die Unterstützung bei
Beratungsstellen suchten, hatten fast zwei Drittel Kinder19, bei polizeilichen Einsätzen wurde in
über 40 % der Fälle dokumentiert, dass Kinder im Haushalt leben, jedoch ist zu vermuten, dass
dieser Prozentsatz höher ist, da in vielen polizeilichen Vorgängen zu häuslicher Gewalt die
Frage nach Kindern im Haushalt nicht beantwortet wurde bzw. nicht zu beantworten war20. „Die
gewaltbelastete Familienstruktur hat schwerwiegende Auswirkungen auf die körperliche,
kognitive und emotionale Entwicklung der Kinder und Jugendlichen.“21 Hier sind beispielhaft Ent-
wicklungsrückstände, ein gestörtes Selbstwertgefühl, emotionale Verunsicherungen, psychische
Störungen, psychosomatische Symptome, soziale Schwierigkeiten und Verhaltensauffälligkeiten
zu nennen.
Kinder fühlen sich häufig zwischen widerstreitenden Gefühlen hin- und hergerissen. So
bewegen sich Jungen – im Falle der Gewalt des Vaters gegen die Mutter – eher in einem
Spannungsverhältnis zwischen der Identifikation mit dem Vater und der Verantwortung für die
Mutter, während sich Mädchen mit der Mutter identifizieren, aber ihr gegenüber gleichzeitig auch
Enttäuschung und Verachtung fühlen lassen. Entwicklungsspezifische Aspekte sind ebenfalls
relevant. Besondere Aufmerksamkeit erfordern kleine Kinder. Sie erleben die Bedrohung ihrer
Bindungsperson als eigene existenzielle Bedrohung, als Angst vor Vernichtung. Gewalt
zwischen Elternpersonen bedeutet für Kinder regelhaft eine Beeinträchtigung der Beziehung zu
beiden Elternteilen. Diese sind in unterschiedlicher Weise in ihrer Verantwortung als Eltern
eingeschränkt und nicht in der Lage, angemessen auf kindliche Bedürfnisse, vor allem dem
Bedürfnis nach Struktur und Orientierung einzugehen.
Struktur und Orientierung bilden jedoch den Rahmen, schwierige Erfahrungen zu bewältigen.
Hinzu kommt, dass Erwachsene oft nicht wahrnehmen, in welcher Weise ihre Kinder betroffen
sind und wie sehr sie leiden. Aufgrund der eigenen Betroffenheit ist oft die empathische
Zuwendung zum Kind eingeschränkt. Für das Kind gibt es ein hohes Risiko der Parentifizierung
(sich für die Eltern verantwortlich zu fühlen und damit selbst in eine Elternrolle zu kommen)
sowie das Risiko, Loyalitätskonflikte nicht lösen zu können.
In gewaltsamen Eskalationen kann es nicht gleichzeitig bei der Mutter und beim Vater sein und
die Erwachsenen stellen oft – ausgesprochen oder unausgesprochen – die Frage, zu wem hältst
Du?22
Des Weiteren ist neben den Entwicklungsstörungen von Kindern, die in einer gewaltbelasteten
Familiensituation aufwachsen von erheblicher Bedeutung, dass die erlebte Gewalt zu einem
Erlernen von gewalttätigen Konfliktlösungsmustern führen kann. Wetzels et al. stellten fest, dass
„Gewalterfahrungen in der Kindheit bei Frauen mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit erneuter
Opferwerdung einhergehen“.23 Hierbei wirken sowohl die Beobachtung von Partnergewalt
zwischen den Eltern als auch die „unmittelbare kindliche Viktimisierung durch elterliche
physische Gewalt“24 risikosteigernd, wobei die Kombination beider Gewaltformen zur höchsten
Viktimisierungsrate der Frauen im Erwachsenenalter führte.
19
Nds. Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit (2004): Mit BISS gegen häusliche Gewalt, 72
20
ebd.: 125
21
Frauenhaus München gGmbH: Frauenhilfe Jahresheft 2000, 60
22
Weber-Hornig, M./ Kohaupt, G. (2005): Partnerschaftsgewalt in der Familie, 23-24
23
Wetzels, P., 1997: Gewalterfahrung in der Kindheit – Sexueller Mißbrauch, körperliche Mißhandlung und deren
langfristige Konsequenzen: 96
24
ebd.
34Ein ausgeprägter Zusammenhang besteht auch für Frauen, die vor ihrem 14. Lebensjahr intra-
oder extrafamiliär sexuell viktimisiert wurden: über 60 % dieser Mädchen wurden nach dem
14. Lebensjahr Opfer einer Vergewaltigung (einschl. Versuch). Knapp 20 % der Mädchen und
jungen Frauen, die vor ihrem 18. Lebensjahr innerhalb ihrer Familie sexuell viktimisiert wurden,
wurden später durch ihren Ehepartner vergewaltigt.25
Der Kriminologe Pfeiffer stellte im Rahmen einer Schülerbefragung 1998 einen signifikanten
Zusammenhang zwischen dem Erleiden körperlicher Gewalt durch die Eltern in der Kindheit und
eigenem gewalttätigen Handeln der befragten Jugendlichen fest. Die Befragten, die bis zu ihrem
12. Lebensjahr von ihren Eltern häufig misshandelt wurden, waren als Jugendliche mehr als
doppelt so häufig selber gewalttätig (16,9 % vs. 35,6 %). „Ein ähnlich deutlich überzufälliger
Zusammenhang findet sich für elterliche Gewalterfahrungen in den letzten 12 Monaten und das
aktive Gewalthandeln Jugendlicher.
Hier zeigt im Falle elterlicher Misshandlung mit 42,5 % eine um das dreifache erhöhte Täterrate
gegenüber den Jugendlichen, die in den letzten 12 Monaten solche Gewalt durch Eltern nicht
erlitten haben (Gewalttäterrate 16,6 %)“26 Auch diese Befunde sind Hinweis darauf, dass Gewalt
als Konfliktlösungsmodell erlernt werden und zu einer höheren Akzeptanz personaler Gewalt zur
Durchsetzung eigener Belange in Krisensituationen führen kann.
„Die Wäscheleine“:
Für Kinder ist es wichtig, über die erlebte Gewalt reden zu können. In den meisten Frauen-
häusern wird diesem Bedürfnis der Kinder dadurch entgegen gekommen, dass spezielle
Angebote für Kinder misshandelter Mütter vorgehalten werden. Ältere Kinder haben zum
Beispiel die Möglichkeit, in Gruppenangeboten der Frauenhäuser ihre Gewalterlebnisse zu
verbalisieren, jüngere Kinder suchen sich Ausdrucksformen im Spiel und mit anderen kreativen
Mitteln.
Leben die Kinder mit ihren Müttern nicht im Frauenhaus, sind spezielle Angebote zur
Verarbeitung der Gewalterlebnisse durch die Jugendhilfe notwendig. Unter präventiven
Aspekten ist dies insbesondere im Hinblick auf die intergenerationale Weitergabe von Gewalt
als Konfliktlösungsmuster bedeutsam (s. Text zu Tafel 19: Kinder misshandelter Mütter). Die
Wäscheleine versinnbildlicht in der Ausstellung den häuslichen Bereich, in dem viele Kinder
misshandelter Mütter sich ohnmächtig gegen die Gewalt des Vaters oder Partners ihrer Mutter,
klein, schwach, nutzlos und der Situation hilflos ausgeliefert fühlen. Sie müssen die verbale und
körperliche Erniedrigung und Entwertung der Mutter durch den Vater oder auch Mann
miterleben.
25
ebd.: 97
26
Pfeiffer, C./Wetzels, P./Enzmann, D., 1999: Innerfamiliäre Gewalt gegen Kinder und Jugendliche und ihre
Auswirkungen: 21-22
3536
Tafel Nr. 22 (Über ein Fünftel aller Kinder ….)
37Über ein Fünftel aller Kinder und Jugendlichen … .
Der Kriminologe Wetzels untersuchte 1997 retrospektiv die Gewaltbelastung in der Kindheit und
Jugend. Er stellte fest, dass 22,7 % aller befragten Erwachsenen angaben, in ihrer Kindheit
miterlebt zu haben, wie es zu körperlicher Gewalt zwischen den Eltern kam.27
Über 40 % der Probanden, die häufiger Gewalthandlungen zwischen ihren Eltern beobachtet
haben, gaben an, zusätzlich selber von ihren Eltern körperlich misshandelt worden zu sein – im
Vergleich zu 5,7 % misshandelter Kinder in Familien, in denen elterliche Gewalt nicht
beobachtet wurde. Auch die Rate sexueller Gewalttaten an Kindern war in Familien, in denen
elterliche Partnergewalt erlebt wurde, mit 13,5 % deutlich höher als in Familien, in denen solche
nicht gemacht wurden (4,1 %).28
Zudem werden bei Kindern, die in einem Klima von Gewalt und Demütigung aufwachsen,
gehäuft Vernachlässigungserscheinungen beobachtet. Die Mutter ist „aufgrund der
Misshandlungs- und Vergewaltigungsfolgen (wie physische Verletzungen, Scham- und Schuld-
gefühle, Ängste, Verminderung des Selbstwertgefühls, Depressionen, selbstzerstörende Ten-
denzen, psychosomatische Erkrankungen und Drogenabusus) phasenweise nur eingeschränkt
in der Lage, für ihre Kinder angemessen zu sorgen.“29
Und da man zusätzlich davon ausgehen kann, dass die Väter, die als Gewalttäter agieren,
selten das Kindeswohl angemessen im Blick haben, sind die Kinder sehr häufig auf sich alleine
gestellt und überfordert.
Auch die Übernahme elterlicher Aufgaben und Verantwortlichkeiten durch die Kinder, die so
genannte Parentifizierung, wird als Folge erlebter Partnergewalt zwischen den Eltern be-
schrieben. Insbesondere ältere Kinder übernehmen die Verantwortung für die Beendigung der
Gewalt zwischen den Eltern, holen Hilfe und fühlen sich aufgrund des Eingreifens Dritter,
insbesondere der Polizei, „zum einen entlastet, zum anderen aber auch häufig schuldig und
voller Angst.“30
Auch bieten sie sich häufig, um die Gewalt von der Mutter abzulenken, (erfolgreich) als
Aggressionsobjekt an.
Damit Kinder die erlebte elterliche Partnergewalt verarbeiten können, brauchen sie die Erlaubnis
der Eltern, darüber zu sprechen. Ein weiterer wichtiger Schritt für die Kinder ist, dass sie ihre
vermeintliche Verantwortung für das Geschehene abgeben dürfen, indem die Eltern aus-
drücklich die Verantwortung dafür übernehmen.
Dies sind zwei wesentliche Ergebnisse, die die Eltern mit den Beratern erarbeiten müssen.
Mütter müssen in die Lage versetzt werden, (wieder) kompetent erziehen und (wieder) die Rolle
der zu respektierenden Erziehungsperson einnehmen zu können.31
Um eine lücken- und stufenlose, den Bedürfnissen und Erfordernissen der Eltern und der Kinder
genügende Begleitung, Beratung und Unterstützung zu gewährleisten ist ein vernetztes, pro-
aktives und aufeinander abgestimmtes Vorgehen unter Einbeziehung der
27
Wetzels, P., 1997: Gewalterfahrung in der Kindheit – Sexueller Missbrauch, körperliche Misshandlung und deren
langfristige Konsequenzen: 165
28
ebd.: 184-185
29
Heynen, S., 2005: Prävention Häuslicher Gewalt – Kinder als Opfer häuslicher Gewalt: 4
30
Weber-Hornig, M./Kohaupt, G. (2005): Partnerschaftsgewalt in der Familie: 24
31
Heidelbach, U./ Kreikenberg, B., 2005: Spezielle Angebote für Jungen und Mädchen, die von
Partnerschaftsgewalt betroffen sind: 47-48
38• Polizei,
• Jugendämter
• freien Träger der Jugendhilfe und Kinderschutzeinrichtungen
• Frauenhäuser und Interventionsstellen bei häuslicher Gewalt
• Familiengerichte
• Strafjustiz
• Kindergärten und Schulen
zu strukturieren und zu standardisieren.
Hilfe für Kinder misshandelter Mütter
„Mädchen und Jungen, die häusliche Gewalt erlebt haben, brauchen nach der Aufdeckung der
Situation eine rasche und offensive Intervention sowie leicht zugängliche Unter-
stützungsangebote. Mädchen und Jungen müssen persönlich und direkt (durch die
professionellen Unterstützungseinrichtungen, z. B. Jugendämter, Träger der Jugendhilfe etc.)
angesprochen und gehört werden. Und sie haben das Recht, über die Situation informiert zu
werden.“32
Dabei ist es nicht ausreichend, die Kinder bei den Beratungsangeboten ihrer Mütter quasi
„nebenher“ mitlaufen zu lassen. Kinder brauchen speziell auf ihre Bedürfnisse abgestimmte
Beratungs- und Unterstützungsangebote sowie einen konkret benannten Ansprechpartner/ eine
konkret benannte Ansprechpartnerin.
Auch muss professionell beurteilt werden, ob ein Kind zusätzlich weiterführende therapeutische
Hilfe benötigt. Weber-Hornig und Kohaupt stellen folgende Anforderungen an die Arbeit mit
Kindern misshandelter Mütter:
• Die Bedrohung, der Schutz und die Sicherheit der Kinder müssen thematisiert, ein
Sicherheitsplan muss entwickelt werden.
• Zur Verarbeitung herrschender Rollenbilder und Entwicklung alternativer Männlichkeits- und
Weiblichkeitsmodelle ist eine geschlechtsspezifische Arbeit mit den Kindern erforderlich.33
Dies ist dringend geboten, um der generationenübergreifenden Rollenimitation durch die
Jungen und Mädchen vorzubeugen.
Die an der Intervention in Fällen häuslicher Gewalt sowie bei der Unterstützung von Kindern
misshandelter Mütter beteiligten Professionen sollten folgende Leitlinien beachten:
• Mädchen und Jungen sind eine eigenständige Zielgruppe bei der Intervention gegen
häusliche Gewalt. Ihr Wille und ihre Bedürfnisse müssen in allen Phasen der Intervention
eruiert werden.
Sie müssen alters- und situationsangemessen an den geplanten Maßnahmen beteiligt
werden.
• Die getroffenen Maßnahmen müssen das Kindeswohl berücksichtigen.
• Der Schutz und die Sicherheit von Müttern und Kindern müssen gleichermaßen gewährleistet
sein.
• Die Gewährleistung von Schutz und Sicherheit hat Vorrang vor dem Umgangsrecht des
misshandelnden Partners.34
32
Buskotte, A., 2005: Kinder misshandelter Mütter – Anforderungen an das Unterstützungssystem: 8
33
Weber-Hornig, M./ Kohaupt, G., 2005: Partnerschaftsgewalt in der Familie: 28
34
Buskotte, A., 2005: Kinder misshandelter Mütter – Anforderungen an das Unterstützungssystem: 11-12
39Tipp:
Der Landespräventionsrat Niedersachsen hat im Auftrag des Niedersächsischen Ministeriums
für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit, des Niedersächsischen Ministeriums für Inneres
und Sport und des Niedersächsischen Justizministeriums ein Eckpunktepapier „Kinder
misshandelter Mütter – Handlungsorientierungen für die Praxis“ herausgegeben, das unter
www.lpr.niedersachsen.de (Publikationen) im Internet herunter geladen werden kann.
Bei der auf Tafel 27 angegebenen Internetadresse www.kids-hotline.de handelt es sich um ein
Forum mit Onlineberatung in der Trägerschaft des Kinderschutz und Mutterschutz e. V. (s. auch
www.kinderschutz.de), eines anerkannten Trägers der freien Jugendhilfe gem. § 75 SGB VIII.
Hier können Jungen und Mädchen sich durch Fachberater in Einzelberatungen Hilfe holen,
Probleme „besprechen“ und sich mit anderen Kindern und Jugendlichen, die ähnliche Sorgen
haben, austauschen.
Die „Nummer gegen Kummer“ Tel.: 0800 111 0 333 ist eine Initiative des Deutschen Kinder-
schutzbundes. An 90 Standorten sind die Kinder- und Jugendtelefone bundesweit eingerichtet
und rund 10.000 Kinder und Jugendliche rufen dort täglich an, um Rat, Unterstützung und Trost
zu finden. Die Nummer gegen Kummer ist kostenlos und wochentags von 15 bis 19 Uhr besetzt
(www.nummergegenkummer.de).
Die auf den nachfolgenden Seiten abgedruckten „Tipps für Kids“ dienen Lehrkräften als
Kopiervorlagen und können von ihnen im Unterricht an die Schüler verteilt werden.
40Sie können auch lesen