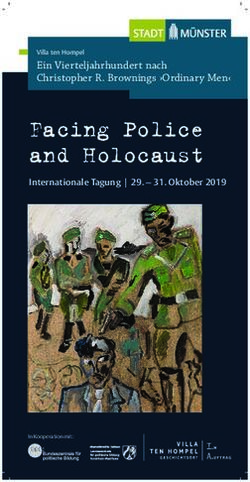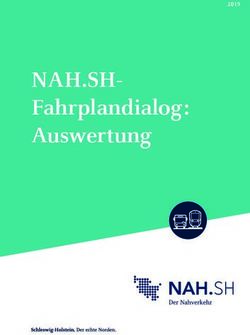"Zweiter Weltkrieg und Holocaust in den erinnerungspolitischen und öffentlichen Geschichtsdiskursen Ostmittel- und Osteuropas nach 1989/1991" - De ...
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
OLDENBOURG MGZ 79/1 (2020): 151–155
Nachrichten aus der Forschung
Josephine Meyer
»Zweiter Weltkrieg und Holocaust in den
erinnerungspolitischen und öffentlichen
Geschichtsdiskursen Ostmittel- und
Osteuropas nach 1989/1991«
Konferenz veranstaltet von Daria Kozlova, Friedrich-Schiller-
Universität Jena/KZ-Gedenkstätte Flossenbürg; Paul Srodecki,
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel/Ostravská univerzita;
in Kooperation mit dem IKGN e.V. – Nordost-Institut,
Universität Hamburg; der Deutschen Stiftung Friedensforschung
(DSF) Osnabrück; dem Herder-Institut für historische
Ostmitteleuropaforschung – Institut der Leibniz-Gemeinschaft
(HI) Marburg, Internationales Begegnungszentrum (IBZ), Kiel,
27./28. September 2019
https://doi.org/10.1515/mgzs-2020-0009
Auch 80 Jahre nach Beginn des Zweiten Weltkrieges zeigt sich, wie schwierig die
Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte sein kann. Während der einein-
halbtägigen internationalen und interdisziplinären Konferenz wurde die Entwick-
lung verschiedener Narrative zum Zweiten Weltkrieg und zum Holocaust nach
1989/1991 in Ostmittel‑ und Osteuropa betrachtet.
Die erste Sektion »Staat und Erinnerung. Konkurrenz der nationalen und
lokalen Narrative«, durch die Daria Kozlova (Jena/Flossenbürg) führte, eröffnete
Paul Srodecki (Kiel, Ostrava) mit seinem Vortrag »Zwischen verklärten Mythen
und historischer Dekonstruktion. Kriegsdenkmäler als geschichtspolitische Zank-
äpfel am Beispiel Polens«. Die erste Phase der Dekommunisierung des öffent-
lichen Lebens habe zwischen 1989 und 1998 stattgefunden. Sie sei durch die
Kontakt: Josephine Meyer, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel,
E-Mail: josi_meyer@web.de
MGZ, © 2020 ZMSBw, Potsdam. Publiziert von De Gruyter152 Josephine Meyer OLDENBOURG
Regierungspartei »Recht und Gerechtigkeit« (Prawo i Sprawiedliwość, PiS) in den
letzten Jahren revitalisiert und instrumentalisiert worden, um das öffentliche
Narrativ zu beeinflussen. Als Grundlage hierfür sah Srodecki von der polnischen
Regierung ausgehende, nach innen und außen ausgrenzende Konstruktionen
vom »Anderen« und »Fremden«, die sich in der Denkmalpolitik widerspiegelten.
Srodecki betonte, dass Polen hier nur exemplarisch für andere postsozialistische
Länder stehe, in denen der Rückbau von Kriegsdenkmälern ebenso voran-
getrieben werde.
Elizaveta Gaufman (Bremen) beleuchtete das »Post-Trauma of World War II in
Russia« unter dem Blickwinkel der »Post-Memory«. Die durch den Krieg entstan-
denen Traumata seien in Form kollektiver Erinnerungen und Gedenkrituale an
nachfolgende Generationen weitergegeben worden. Die damit verknüpften
Emotionen mache sich die derzeitige russische Regierung zunutze, um die öffent-
liche Meinung zu beeinflussen. Als aktuelles Beispiel nannte Gaufman das
Wiederbeleben von Feindbildern des Zweiten Weltkrieges im Kontext der seit 2013
andauernden Ukrainekrise.
»From the Great Patriotic War to World War II. How the memory has changed
in Georgia after independence« war das Thema von Nino Chikovani (Tbilisi). Zur
Zeit der Perestroika sei die von dem sowjetischen Narrativ geprägte Erinnerung an
Fakten und Namen neu bewertet und durch das Aufkommen zuvor tabuisierter
Themen hinterfragt worden, wodurch es zu einem Zusammenstoß zwischen der
alten und der neu entstandenen Erinnerung kam. Zu einem finalen Bruch mit dem
offiziellen sowjetischen Narrativ sei es erst seit dem Georgienkrieg 2008 gekom-
men. Es habe auf verschiedenen Ebenen eine radikale Revision der Erinnerung an
den Zweiten Weltkrieg stattgefunden.
»Deutsch denkende Tschechen? Zweiter Weltkrieg, Hultschiner Ländchen
und Lokalgedächtnis« – dieser Problematik stellte sich Pavel Kladiwa (Ostrava).
Die deutsch-preußische Vergangenheit der Region wie auch die daraus resultie-
rende deutsche Identität der Hultschiner sei bis zur Wende tabuisiert oder –
gerade im Hinblick auf die Zeit von 1938 bis 1945 – mit dem Vorwurf der Kollabo-
ration abgetan worden. Eine differenzierte Auseinandersetzung mit dieser
Thematik habe erst nach 1989, beispielsweise durch Zeitzeugenberichte, statt-
gefunden.
David Feest (Hamburg) betrachtete »Eine rein örtliche Angelegenheit? Estland
und die Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg«. Er betonte, dass die estnische
Erinnerung bis heute von den durch die sowjetische Besatzung verursachten Trau-
mata und der Hervorhebung der vermeintlichen Freiheiten unter deutscher Besat-
zung geprägt sei. Die Kollaboration während des Zweiten Weltkrieges sei deshalb
als Befreiungskampf gegen den Kommunismus umgedeutet worden. Diese natio-
nale Erinnerung stoße im internationalen Kontext auf Unverständnis. FeestOLDENBOURG Zweiter Weltkrieg und Holocaust 153
bemerkte abschließend, dass es eine Herausforderung bleibe, Lokal‑ und Indivi-
dualerinnerung zu verbinden.
Den Auftakt zur zweiten Sektion »Ethnische und religiöse Minderheiten zwi-
schen Tabuisierung, Vergessen und Erinnerung«, geleitet von Srodecki, machte
Beáta Márkus (Pécs) mit ihrem Vortrag »Von der Tabuisierung bis zum Gedenk-
jahr – Die Deportation der Ungarndeutschen in die Sowjetunion 1944/1945 als
Teil ungarischer Erinnerungskultur«. Die öffentliche Tabuisierung des Themas sei
erst in den 1990er Jahren aufgehoben worden. Die Regierungen der letzten Jahre,
besonders unter Victor Orbán, sollen demnach eine Zentralisierung und Nationa-
lisierung der Erinnerungskultur verfolgen. Márkus zufolge habe diese Erinne-
rungspolitik die für die ungarische Mentalität so typische »Rivalisierung der
Opfer« nur noch zusätzlich verstärkt.
Magdalena Nowicka-Franczak (Łódź) referierte über »Memory’s backlash or
revival? Polish-Jewish wartime past in the contemporary public debate in
Poland«. PiS versuche die polnische Beteiligung am Holocaust zu dementieren,
jeden Widerspruch dieses Narrativs zu unterbinden und parallel hierzu neue
Opfergruppen in der Erinnerungskultur zu etablieren. Dies spiegele jedoch die
Identitätskrise der polnischen Gesellschaft wider, in der Opferrivalisierung eine
große Rolle spiele. Nowicka-Franczak kam zu dem Schluss, dass die emotional
geführte öffentliche Debatte zu diesem Thema noch weit von einer nüchternen
geschichtswissenschaftlichen Auseinandersetzung entfernt sei.
Joachim Tauber (Hamburg), der über die »Schwierige Vergangenheit: Der
Umgang mit dem Holocaust in Litauen seit 1989« referierte, betonte, dass auch in
Litauen zur Sowjetzeit das Narrativ des Vaterländischen Krieges dominiert habe,
weshalb man sich während dieser Zeit nicht mit litauischer Kollaboration
auseinandergesetzt habe. Noch immer beherrsche das Bild des Kommunismus als
einer vermeintlich jüdischen Erfindung die kollektive Erinnerung weiter Teile der
Bevölkerung. In den letzten 30 Jahren sei das Feindbild schrittweise dekonstruiert
worden, vor allem hinsichtlich der Frage nach einer litauischen Holocaust-Betei-
ligung. Diese an sich positive Entwicklung sah Tauber jedoch durch die in den
letzten Jahren vor dem Hintergrund eines gesellschaftlichen Rechtsrucks aufgetre-
tenen Spannungen getrübt.
Goran Hutinec (Zagreb) erläuterte anhand vielseitiger Beispiele »Holocaust in
the memory politics and public historical discourses in Croatia (1989–2019)«.
Zuerst habe es in Kroatien eine Verleugnungsphase gegeben, gefolgt von einer
durch die Europäisierung hervorgerufenen Neuinterpretation der Holocauster-
innerung. Seit 2013/2015 könne man jedoch einen deutlichen Rückschritt diesbe-
züglich erkennen. Dabei werde gerade aus rechtsnationalen Kreisen versucht, das
umstrittene Ustaša-Regime unter dem Deckmantel des Gedenkens an die Opfer
des Kommunismus zu rehabilitieren und die faschistischen Verbrechen der Jahre154 Josephine Meyer OLDENBOURG
1941–1945 zu relativieren. Es gebe auch Gegenbewegungen, etwa durch Gedenk-
feiern jüdischer Gemeinschaften, jedoch bleibe die Ustaša-Symbolik insbeson-
dere in der Populärkultur weiterhin präsent.
Frank Golczewski (Hamburg) schloss die zweite Sektion mit seiner Key Note
»Mechanismen des Umgangs mit der Vergangenheit«. Er stellte fest, dass die
Interpretation von historischen Ereignissen und ihre Verbreitung maßgeblicher
für das kollektive Geschichtsbewusstsein als die historischen Ereignisse selbst
seien. Die Emotionalisierung der Erinnerungskultur sei geradezu unvermeidlich,
dabei könne die »wehrlose Vergangenheit« nach Belieben für eigene Zwecke
missbraucht werden. Der Gebrauch dieser Mechanismen habe in Osteuropa einen
Charakter »diskursiver Unfreiheit«, die sich Golczewski zufolge auf den inneren
Wunsch zurückführen lasse, sich lieber mit Helden als mit Opfern zu identifizie-
ren.
Bei der abschließenden, von Rebekka Wilpert (Kiel) moderierten Sektion
»Orts‑ und personenbezogene Narrative zum Zweiten Weltkrieg« betrachtete
Kozlova eingangs die »Museale Darstellung des Zweiten Weltkrieges in der
Ukraine« und erkannte innerhalb des Landes regionale Unterschiede. Kozlova
stellte insgesamt drei gut veranschaulichte Thesen auf. Erstens sei die staatliche
geschichtspolitische Entwicklung dynamisch, die museale Entwicklung statisch.
Zweitens würden Museen versuchen, geschichtspolitische mit gesellschaftlichen
Narrativen zu verbinden. Drittens stehe der Holocaust in der Ukraine stellvertre-
tend für alle tabuisierten Themen in der Sowjetunion. Nicht in jedem Museum
habe jedoch eine Veränderung stattgefunden. Die sowjetische Tradition bleibe oft
weiter bestehen.
Aliaksandr Dalhouski (Minsk) thematisierte mit »Zwischen Nationalisierung,
Resowjetisierung und Europäisierung. Konkurrierende Diskurse zum Erinne-
rungsort Malyj Trostenez« einen weißrussischen Gedenkort, der gleich mehrerer
Opfergruppen gedenke: Juden, sowjetischen Kriegsgefangenen und Partisanen-
verdächtigen. Nachdem kurz nach der Unabhängigkeit 1991 zunächst nach sowje-
tischer Tradition versucht worden sei, die Kommemoration aller Opfergruppen zu
vereinen, habe Mitte der 1990er Jahre eine kritische Auseinandersetzung einge-
setzt, wodurch ein differenzierteres Geschichtsbild entstanden sei. Aufgrund der
verschiedenen Nationalitäten der jüdischen Opfer bestehe seit einigen Jahren der
Wunsch, eine übernationale Gedenkstätte zu errichten. Die Umsetzung sei
aufgrund unterschiedlicher nationaler Interessen jedoch schwierig.
Melina Hubel (Greifswald) fokussierte mit »Der Auschwitz-Freiwillige. Eine
Skizze des Heldennarratives um Witold Pilecki« auf die Entstehung und Entwick-
lung des Heldennarrativs rund um den polnischen Widerstandskämpfer. Pilecki
informierte mit seinen Berichten aus dem KZ Ausschwitz bereits 1940 die Außen-
welt. 1948 wurde er durch die Kommunisten wegen Spionage verurteilt undOLDENBOURG Zweiter Weltkrieg und Holocaust 155
hingerichtet. Der gewaltsame Tod mache ihn, stellvertretend für alle kommunis-
tischen Gewaltverbrechen in Polen, zu einem modernen polnischen Märtyrer. Die
Konstruktion dieses Heldenmythos’ sei ein Musterbeispiel für die Erinnerungs-
politik der PiS. Die Erinnerungspolitik bediene vielseitige Narrative und könne
so gut instrumentalisiert werden.
Katja Wezel (Göttingen) stellte die Frage »Abkehr von der Opferkonkurrenz?
Neue museale Darstellungen des Holocaust und der sowjetischen Gewaltherr-
schaft in Lettland«. Dabei verglich sie zwei Rigaer Museen: das »Riga Ghetto and
Latvian Holocaust Museum« und das »Stura Maja«, die ehemalige Zentrale der
sowjetischen Staatssicherheit, die heute stellvertretend als Museum für die
Gewaltverbrechen der Sowjetzeit in Lettland fungiert. Die getrennte Betrachtung
des nationalsozialistischen und des sowjetischen Regimes helfe einer Opferriva-
lität vorzubeugen. Auch wenn diese bis heute innerhalb des lettischen Kollektiv-
gedächtnisses vorhanden sei, gebe es unter jüngeren Generationen einen posi-
tiven Wandel hin zu gemeinsamen statt konkurrierenden Narrativen.
Ludwig Steindorff (Kiel) fasste die wichtigsten Erkenntnisse der Tagung zu-
sammen und merkte an, dass die jeweiligen historischen Kontexte der einzelnen
Länder berücksichtigt werden müssten, um die heterogenen Entwicklungen der
verschiedenen Erinnerungsdiskurse besser zu verstehen. Auch wenn bisher eine
vollständige, den ostmittel‑ und osteuropäischen Raum in sich vereinende
Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg und den Holocaust fehle, würden die zahl-
reichen Parallelen, aber auch Unterschiede in der erinnerungskulturellen Auf-
arbeitung in den jeweiligen nationalen öffentlichen Erinnerungsdebatten eine
spannende Grundlage für weitere Forschungen bieten. Es stelle sich die Frage,
wer Adressat dieser neuen Erinnerungspolitik sei und warum diese Narrative in
den jeweiligen Ländern so gut funktionierten.Sie können auch lesen