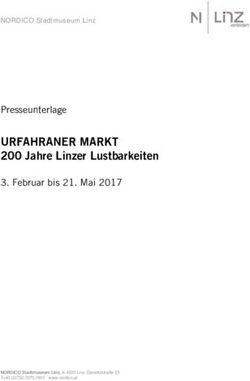Analyse eines Auszuges des Artikels "Doping im Sport - neue Entwicklungen" aus dem Magazin "Swiss Medical Forum"
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Zürcher Hochschule Winterthur
Departement Angewandte Linguistik und Kulturwissenschaften
Studiengang Übersetzen
Textanalyse Deutsch
Semesterarbeit
Stefanie Liechti & Petra Sevinç
Analyse eines Auszuges des Artikels „Doping im Sport – neue
Entwicklungen“ aus dem Magazin „Swiss Medical Forum“
betreut von:
Michaela Baumann, lic. phil.
Januar 2005Semesterarbeit, D TxAn, UE2 Doping im Sport – neue Entwicklungen Stefanie Liechti, Petra Sevinç
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung..................................................................................................................................1
2. Textexterne Faktoren ...............................................................................................................1
2.1 Senderpragmatik ..............................................................................................................1
2.2 Empfängerpragmatik........................................................................................................2
2.3 Medium/Kanal und Ortspragmatik ...................................................................................2
2.4 Zeitpragmatik....................................................................................................................3
2.5 Textfunktion ......................................................................................................................3
3. Textinterne Faktoren ................................................................................................................4
3.1 Textthematik und Textinhalt.............................................................................................4
3.2 Präsuppositionen..............................................................................................................4
3.3 Makrostruktur/Gliederung.................................................................................................4
3.4 Lexik .................................................................................................................................5
3.5 Syntax...............................................................................................................................6
3.6 Suprasegmentale Elemente.............................................................................................7
3.7 Nonverbale Textelemente ................................................................................................7
3.8 Defekte Textstellen...........................................................................................................8
4. Schlusswort ..............................................................................................................................8
5. Danksagung .............................................................................................................................9
6. Quellen .....................................................................................................................................9
7. Anhang .....................................................................................................................................9
iSemesterarbeit, D TxAn, UE2 Doping im Sport – neue Entwicklungen Stefanie Liechti, Petra Sevinç
1. Einleitung
In der vorliegenden Semesterarbeit wollten wir ursprünglich einen wissenschaftlichen Text mit
einem populärwissenschaftlichen Text zum selben Thema vergleichen. In einem ersten
Arbeitsschritt sahen wir uns diverse populärwissenschaftliche Magazine an, doch schien uns
keiner der Artikel passend für eine solche Semesterarbeit. Als wir auf den hier behandelten
Fachartikel stiessen, sprach uns dieser sogleich an. Wir entschieden uns, diesen Artikel als
Basis für unser weiteres Vorgehen zu verwenden. Erst wollten wir ihn mit einem Sachartikel zum
selben Thema vergleichen, doch nach Absprache mit unserer Betreuerin Frau lic. phil. Michaela
Baumann stellte sich heraus, dass unser Vorhaben den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde.
Wir entschlossen uns deshalb, uns auf die Analyse eines Auszuges des Fachtextes zu
beschränken.
Wir befassen uns mit dem Artikel „Doping im Sport – neue Entwicklungen“, den wir der Nummer
43 des „Swiss Medical Forums“ entnommen haben, die am 20. Oktober 2004 erschienen ist.
Konkret betrachten wir die Seiten 1081 – 1083, 1088 (ab „Ausnahmebewilligung zu
therapeutischen Zwecken ATZ“) – 1089 des Artikels. Wir folgen dem Analysekonzept von
Christiane Nord und untersuchen den Text auf textexterne und textinterne Faktoren hin. Die
Bereiche Medium/Kanal und Ortspragmatik hingegen fassen wir unter einem Punkt zusammen.
Abschliessend behandeln wir in einem zusätzlichen Kapitel defekte Textstellen. Im Anhang der
Arbeit werden die wichtigsten Quellen aufgeführt.
2. Textexterne Faktoren
2.1 Senderpragmatik
Autorengemeinschaft:
Dr. phil.nat. Matthias Kamber:
Fachkommission für Doping-Bekämpfung, Geschäftsstelle, Swiss Olympic Association,
Bern
Sportwissenschaftliches Institut des BASPO, Magglingen
Dr. med. Bruno Müller
Facharzt FMH für Endokrinologie/Diabetologie und FMH für Innere Medizin
b.mueller@hin.ch
Fachkommission für Doping-Bekämpfung, Geschäftsstelle, Swiss Olympic Association,
Bern
60 % Oberarzt Abteilung für Endokrinologie und Diabetologie, Universitätsklinik,
Inselspital, Bern
40 % in Gemeinschaftspraxis, Luisenstrasse 7, 3005 Bern
Dr. Emanuel R. Christ:
emanuel.christ@insel.ch
Abteilung für Endokrinologie und Diabetologie, Universitätsklinik, Inselspital, Bern
Seite 1 von 9Semesterarbeit, D TxAn, UE2 Doping im Sport – neue Entwicklungen Stefanie Liechti, Petra Sevinç
Autorenpräsenz:
S. 1087, letzter Abschnitt (Glukokortikoide), Zeile 12:
„Unseres Erachtens […]“ an dieser Stelle wird Kritik geübt an der Regelung der WADA (Welt-
Anti-Doping-Agentur) bezüglich der Glukokortikoide. Der Gebrauch des Possesivpronomens
„unser“ deklariert die Äusserung klar als persönliche Meinung der Autorengemeinschaft.
2.2 Empfängerpragmatik
Der Text ist für Schweizer Ärztinnen und Ärzte verfasst worden, die sich weiterbilden wollen.
Aus der Orthographie wird ersichtlich, dass sich das Magazin und somit auch der Artikel an ein
Schweizer Publikum wendet: ss an Stelle von ß.
Ein weiterer Hinweis auf Schweizer Leserschaft sind die Akronyme BASPO und FMH, die in
dieser Arbeit als Präsuppositionen definiert sind. Für ein deutsches oder österreichisches
Publikum fallen sie unter diese Kategorie, bei einem Schweizer Publikum jedoch darf man
solche Akronyme durchaus als bekannt voraussetzen. Sie werden in dieser Arbeit nur der
Vollständigkeit halber als Präsuppositionen aufgeführt.
An folgenden Stellen wird der Empfänger insofern implizit angesprochen, als Empfehlungen für
die Arztpraxis abgegeben werden:
S. 1081: 3. und 4. Abschnitt, S. 1088: „Thema Doping in der Arztpraxis“
S. 1089: „Standesrecht“
Ärzte werden über die rechtliche Lage informiert.
2.3 Medium/Kanal und Ortspragmatik
Der Text ist im Magazin „Swiss Medical Forum/Schweizerisches Medizin Forum/Forum Médical
Suisse“ in der Rubrik „Curriculum“ erschienen und kann unter www.medicalforum.ch als pdf-
Datei abgerufen werden.
Das „Offizielle Fortbildungsorgan der Schweizerischen Gesellschaft für Innere Medizin“
erscheint jeden Mittwoch mit einer Auflage von knapp 30 000 Exemplaren und wird vom
Schweizerischen Ärzteverlag herausgegeben.
Verlag
EMH Schweizerischer Ärzteverlag AG
Postfach
CH-4010 Basel
Tel.: +41-61-467 85 55
Fax: +41-61-467 85 56
E-Mail: verlag@emh.ch
Website: http://www.emh.ch
Die Zeitschrift ist teilweise zweisprachig (deutsch und französisch). Die Quintessenz der
wichtigsten Fort- und Weiterbildungsartikel „Curriculum“ und „Praxis/Cabinet“, sowie die
Rubriken „Periskop/Périscope“ und „Multiple-Choice“ werden durch den Verlag in die jeweils
andere Sprache übersetzt.
Gemäss „Swiss Medical Forum“ werden in der Rubrik „Curriculum“ Themen aus allen
Spezialgebieten der Inneren Medizin, der Neurologie, aber auch der operativen Fächer sowie
der Ophthalmologie, der Hals-Nasen-Ohrenheilkunde und der Dermatologie, etc. behandelt.
Seite 2 von 9Semesterarbeit, D TxAn, UE2 Doping im Sport – neue Entwicklungen Stefanie Liechti, Petra Sevinç
Am Ende des Magazins hat der Leser die Möglichkeit seinen Wissenszuwachs aus den
Rubriken „Curriculum“ und „Praxis“ anhand von Multiple-Choice-Fragen zu überprüfen.
Typisch für fachwissenschaftliche Magazine beginnt nicht jede Nummer mit der Seite 1, sondern
nur das allererste im Jahr. In den nachfolgenden Magazinen wird die Nummerierung bis Ende
Dezember weitergeführt.
2.4 Zeitpragmatik
Das „Swiss Medical Forum“ ist im Januar 2001 zum ersten Mal erschienen.
Der Text muss nach den Olympischen Spielen von Athen (11- 29. August 2004) verfasst worden
sein.
S. 1082: „Die (nationalen) Sportorganisationen hatten bis zu den Olympischen Spielen 2004 in
Athen Zeit […]“
Der Artikel „Doping im Sport – neue Entwicklungen“ ist am 20. Oktober 2004 erschienen.
2.5 Textfunktion
Ziel des Magazins ist es, die wichtigsten Fort - und Weiterbildungsbedürfnisse der Schweizer
Ärztinnen und Ärzte abzudecken.
Im Rahmen dieser Zielsetzung informiert die Autorengemeinschaft in dem von uns analysierten
Artikelauszug über neue Entwicklungen in der Dopingbekämpfung.
Beispiele:
S. 1082:
Annahme des Welt-Anti-Doping-Codes (WADC) am 5. März 2003
S. 1082:
Seit 1. Januar 2004 ist die Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) für die „Liste mit verbotenen
Substanzklassen und Methoden“ zuständig.
Der Text ist demzufolge hauptsächlich informativ.
Die Autorengemeinschaft gibt auch Empfehlungen für die Arztpraxis weiter.
Beispiele:
S. 1081:
Punkte 3 und 4 der Quintessenz
S. 1088 f.:
„Ausnahmebewilligungen zu therapeutischen Zwecken ATZ“ bis „Standesrecht“
Der Text hat an diesen Stellen auch appellativen Charakter.
Seite 3 von 9Semesterarbeit, D TxAn, UE2 Doping im Sport – neue Entwicklungen Stefanie Liechti, Petra Sevinç
3. Textinterne Faktoren
3.1 Textthematik und Textinhalt
Die Thematik entspricht der Artikelüberschrift („Doping im Sport – neue Entwicklungen“).
Inhaltlich ist der Text in folgende Subthemen aufgegliedert:
• „Doping-Definition“
• „Dopingbekämpfung“
• „Verbotene Substanzklassen und Methoden“
• „Ausnahmebewilligungen zu therapeutischen Zwecken ATZ“
• „Thema Doping in der Arztpraxis“
• „Standesrecht“
3.2 Präsuppositionen
Der Leser muss über Fachwissen aus den Bereichen Medizin, Sport und Kultur verfügen, um
den Text vollumfänglich zu verstehen. Dies wird unter anderem aus folgenden Textstellen
ersichtlich:
S. 1081:
Swiss Olympic Association; BASPO
S. 1082:
UNESCO
S. 1083:
Substanzklassen S4, S5, S6, S7, S8; ng/ml; Methoden M1, M2, M3; Betablocker; Diuretika;
Phenylalkylamin; Katecholamin; Adrenalin; Noradrenalin; Dopamin; zentralnervös; peripher;
Amphetamin; Ephedrin; Methylephedrin; µg/ml; ephedrinhaltig; Phenylephrin;
Phenylpropanolamin; Pipradol; Pseudoephedrin; Synephrin
S. 1089:
LH-Bestimmung; ALAT; ASAT; IGF-I; FMH
3.3 Makrostruktur/Gliederung
Die Makrostruktur des Textes ist durch die verschiedenen Subthemen und ihre entsprechenden
Titel gegeben. Allerdings ist die Gliederung mangelhaft, insofern als Titel unterschiedlichen
Grades nicht als solche gekennzeichnet werden: Stimulantien, Narkotika, Cannabinoide, etc.
sind Unterkapitel zum Thema „Verbotene Substanzklassen und Methoden“ (S. 1083 ff), dennoch
werden sie graphisch als gleichrangig dargestellt.
Artikelstruktur
„Quintessenz“: Hier werden in sehr direkt formulierten Sätzen ("learning points") die
wesentlichen neuen Informationen zusammengestellt. Die „Quintessenz“ erscheint auf der
ersten Seite des Artikels in Deutsch und Französisch (Übersetzung durch Verlag).
Seite 4 von 9Semesterarbeit, D TxAn, UE2 Doping im Sport – neue Entwicklungen Stefanie Liechti, Petra Sevinç
Einführung/Hintergrund: Geschichtlicher Hintergrund und Definitionen
Hauptteil: Aktualitäten, Entwicklungen, Neuerungen
Schlussteil: Konsequenzen/Tipps für die Arztpraxis
Literatur
Multiple-Choice-Fragen
3.4 Lexik
Standardsprachlich mit Fachterminologie
Isotopie:
Die Isotopie der Rechtssprache zieht sich durch den ganzen Text:
S. 1081:
verboten; Verfahren
S. 1082:
verbieten; „Absicht der Leistungssteigerung“ erfüllt sein; beweisen; juristisch; verboten;
versuchter Gebrauch; Verweigerung; Vestoss; Verfälschen oder versuchtes Verfälschen; Besitz
von verbotenen Substanzen; Handel mit verbotenen Substanzen; Abgabe, versuchte Abgabe
verbotener Substanzen; Komplizenschaft; Verletzung der Dopingbestimmungen; Evidenz
S. 1083:
verboten; verbieten; Dopingkontrollen; Betäubungsmittelgesetz
S. 1088:
einfaches Verfahren; verboten; Standardverfahren; Gesuch; rechtfertigen; einreichen;
Missbrauch; verneinen
S. 1089:
Aufdeckung von Doping; Missbrauch; juristisch; Standesrecht; Artikel; Absatz; zustimmen; in
Kraft treten
Fachterminologie:
S. 1081:
Endokrinologie und Diabetologie; Stimulantien; Narkotika; Cannabinoide; Anabolika;
Peptidhormone; Beta-2-Agonisten; antiöstrogen wirkende Substanzen; maskierende
Substanzen; Diuretika; Glukokortikoide; akromegale Stigmata; Androgenisierung;
Hodenatrophie; Gynäkomastie; Striae distensae oder Striae rubrae; Hepatosteatose;
Differentialdiagnose
S. 1082:
Metaboliten; pharmakologisch; Evidenz
S. 1083:
Derivat; Regenerationsfähigkeit; Euphorie; Halluzination; Paranoia; kardiovaskulär; Albutamol;
Lipolyse; Glykolyse; Bronchodilatation; Laktattoleranz; Stimulantien; Narkotika; Cannabinoide;
Seite 5 von 9Semesterarbeit, D TxAn, UE2 Doping im Sport – neue Entwicklungen Stefanie Liechti, Petra Sevinç
Anabolika; exogen; endogen; anabol; androgen; Steroid; Peptidhormone; Beta-2-Agonist;
Aatiöstrogen wirkende Substanz; maskierende Substanz; Glukokortikoid
S. 1088:
Appliziert; intramuskulär; laborchemisch; Formoterol; Salbutamol; Salmetero; Terbutalin; topisch;
intraartikulär; Steroid; Kortikosteroid; Epikondylitis; Diprophos-Injektion; Betamimetika-Therapie;
Kortikosteroid; bronchiale Hyperreagibilität; Betamimetika; Steroid; spirometrisch; peroral; rektal;
Suppositorien; Glukokortikoid
S. 1089:
Unphysiologisch; exogen; supprimieren; Akromegale Stigmata; Akre; Androgenisierung;
Hodenatrophie; Gynäkomastie; Striae distensae/rubrae; Hepatosteatose; Kortikoidmissbrauch;
Kortisol; Steroid; EPO; Anabolika; Hämoglobin; Hämatokrit
Stilfigur:
S. 1088:
Litotes: „nicht selten“
3.5 Syntax
Zur exemplarischen Veranschaulichung der Syntax wurde das Kapitel „Stimulantien“ auf S. 1083
ausgewählt.
Der Artikel enthält auffallend viele Hauptsätze. Die Verknüpfungen zwischen und innerhalb der
einzelnen Sätze erfolgen mittels Konjunktionen, Relativpronomen und Deiktika. Weiter
auffallend und typisch für einen informativen Text ist die Häufung von Partizipialsätzen,
Nominalstil und Passivgebrauch.
Ein weiterer Hinweis auf den informativen Charakter des Artikels ist der ausgeprägte Gebrauch
von Tabellen und Listen der sich durch den ganzen Text hindurch zieht.
Stimulantien
Stimulantien (auch Psychostimulantien genannt) sind Wirkstoffe, welche die allgemeine,
zentrale und/oder periphere Körperaktivität erhöhen. Dies ist mit einer kurzfristigen Steigerung
der körperlichen Leistung und der Stimmung verbunden. Stimulantien haben vielfach die
Struktur von Phenylalkylaminen und sind struktur- und wirkungsmässig den körpereigenen
Katecholaminen Adrenalin, Noradrenalin und Dopamin verwandt. Im Sport wurde vor allem mit
Substanzen experimentiert, die gleichzeitig zentralnervöse und periphere Wirkungen aufweisen.
Einerseits wollte man damit eine erhöhte Wachheit, Wettkampfaggressivität und Motivation
erwirken und andererseits Herz-Kreislauf-System und Energiestoffwechsel anregen [2].
Die wirksamsten und bis vor kurzem am meisten verwendeten Substanzen waren die
Amphetamine, die vor allem im Radsport und Fussball zum Einsatz kamen. Verschiedene
Untersuchungen [3, 4] zeigten, dass die sportliche Leistung durch die Einnahme von
Amphetaminen tatsächlich gesteigert werden kann.
Aufgrund der häufigen Zwischenfälle mit Amphetaminen mit teilweise tödlichem Ausgang
(1960: Knut Jensen, dänischer Radfahrer; 1967: Tom Simpson, britischer Radfahrer), verbot das
IOK 1968 diese Substanzen für den Wettkampf, nicht aber für die Vorbereitungsphase
(Training). Amphetamine waren somit Auslöser für die Einführung von Dopingbestimmungen
und -kontrollen. Wegen des Suchtpotentials unterliegen zudem Amphetamine und deren
Derivate dem Betäubungsmittelgesetz (Tab. 1).
Einige der verbotenen Stimulantien wie Ephedrin und Methylephedrin sind in vielen, auch
rezeptfrei erhältlichen Medikamenten gegen Erkältungserkrankungen enthalten. Bis vor einigen
Seite 6 von 9Semesterarbeit, D TxAn, UE2 Doping im Sport – neue Entwicklungen Stefanie Liechti, Petra Sevinç
Jahren betrafen positive Dopingresultate vielfach solche Medikamente, die therapeutisch und
nicht mit dem Ziel der Leistungssteigerung eingenommen/verschrieben worden sind. Um dieser
Tatsache Rechnung zu tragen, wurden deshalb für Stimulantien «Toleranzgrenzen» erlassen.
Für Ephedrin und Methylephedrin beispielsweise sind maximale Urinkonzentrationen von 10
mg/ml festgelegt worden. Um Komplikationen zu vermeiden, ist es in Einzelfällen aber
angezeigt, ephedrinhaltige Medikamente rechtzeitig vor einem Wettkampf abzusetzen.
Alternativ ist darauf zu achten, dass im Falle von banalen Erkältungserkrankungen dopingfreie
Medikamente zum Einsatz gelangen. Bei der Fachkommission für Dopingbekämpfung von
Swiss Olympic (FDB) ist eine Liste unbedenklicher Medikamente erhältlich.
Seit dem 1. Januar 2004 sind auch schwach wirksame Stimulantien wie Koffein, Phenylephrin,
Phenylpropanolamin, Pipradol, Pseudoephedrin und Synephrin nicht mehr auf der Dopingliste
und somit ohne Einschränkungen erlaubt. Die Labors sind aber verpflichtet, die
Analyseresultate für diese Substanzen der WADA zu melden. Mit diesem
«Überwachungsprogramm» will die WADA sicherstellen, dass entsprechende Medikamente
nicht wieder vermehrt im Sport zum Einsatz gelangen.
3.6 Suprasegmentale Elemente
S. 1081: Aufzählungszeichen
S. 1082: Gedankenstriche; Aufzählungszeichen; Klammern
S. 1083: Klammern; Schrägstriche; Anführungs- und Schlusszeichen
S. 1088: Anführungs- und Schlusszeichen kombiniert mit Klammern; Klammern
S. 1089: Aufzählungszeichen Klammern
3.7 Nonverbale Textelemente
S. 1081:
S. 1082: [1]: Verweis auf Literatur
S. 1083: Tabelle mit Wirkungen und Nebenwirkungen verbotener Substanzklassen
[2], [3,4],
S. 1089: [17]
Seite 7 von 9Semesterarbeit, D TxAn, UE2 Doping im Sport – neue Entwicklungen Stefanie Liechti, Petra Sevinç
3.8 Defekte Textstellen
S. 1088:
„Ausnahmebewilligungen zu therapeutischen Zwecken ATZ“ anstelle von
Ausnahmebewilligungen zu therapeutischen Zwecken (ATZ), vier Zeilen weiter unten werden die
Klammern korrekt verwendet.
S. 1089:
„Anabolika-Mussbrauch“ an Stelle von Anabolika-Missbrauch
4. Schlusswort
Wir haben den Artikel „Doping im Sport – neue Entwicklungen“ nach dem Konzept von
Christiane Nord analysiert. Rückblickend stellen wir fest, dass unsere Arbeit eine gute
Vorbereitung für eine spätere Übersetzung des Textes wäre. Dies war jedoch nie unsere Absicht
und auch nicht das Ziel dieser Arbeit. Genau hier liegt der Hund begraben. Wir haben unsere
Analyse ohne eine konkrete Fragestellung begonnen, was zur Folge hatte, dass wir auf kein
Thema vertieft eingegangen sind. Eine präzise Fragestellung wäre für eine solche Arbeit
hilfreich gewesen. Unsere Arbeit wurde ziemlich monoton und wir gewannen den Eindruck, dass
die Attraktivität für den Leser darunter leidet.
Da es sich um einen informativen Text handelt, ist es relativ schwierig, eine konkrete
Fragestellung zu formulieren. Der Artikel weist keine grossen Besonderheiten in Bezug auf
Inhalt und Form auf. Der Kontext, der uns zu Beginn sehr faszinierte und uns dazu veranlasste,
den Artikel auszuwählen, erwies sich als weniger ergiebig, als wir erwartet hatten.
Seite 8 von 9Semesterarbeit, D TxAn, UE2 Doping im Sport – neue Entwicklungen Stefanie Liechti, Petra Sevinç
5. Danksagung
Wir bedanken uns herzlich bei Dr. Martin Sidler für seine Unterstützung bei der Suche eines
geeigneten Ausgangstextes für unsere Semesterarbeit. Ebenso danken wir Frau Ruth Schindler
für ihre freundliche Auskunft über das „Magazin Swiss Medical Forum“. Nicht zuletzt bedanken
wir uns bei unserer Dozentin Frau lic. phil. Michaela Baumann. für ihre Betreuung. Ein
besonderer Dank gilt Frau Barbara Flury, Herrn Bernhard Neuhaus, Herrn Daniel Schaltegger,
Herrn Oli Kunz, Herrn Filippo Svalduz und Janine Schlachter für ihre Unterstützung in jeder
(Not-)Lage und zu jeder (Un-)Zeit.
6. Quellen
Swiss Medical Forum/ Schweizerisches Medizin Forum/Forum Médical Suisse, N° 43, 2004
ISSN Printversion: 1424-3784
ISSN Elektronische Ausgabe: 1424-4020
www.medicalforum.ch
Nord, Christiane: Textanalyse und Übersetzen. Heidelberg: Julius Groos Verlag, 1995.
www.dopinginfo.ch
http://staff-www.uni-marburg.de/~semihirn/psychpharm/stimulantien.htm
www.hirslanden.ch/de/Aerzte/card.cfm?DoctorID=1239&map=true
Pschyrembel, Willibald: Pschyrembel Klinisches Wörterbuch. Berlin: Walter de Gruyter & Co.,
1998.
7. Anhang
Ausgangstext
Seite 9 von 9Sie können auch lesen