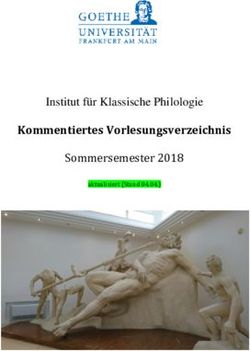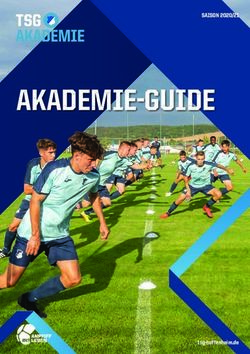Anmerkungen zur Dichtung der Bukowina: Itzik Manger, Rose Ausländer, Paul Celan - Schnittstelle ...
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Anmerkungen zur Dichtung der Bukowina:
Itzik Manger, Rose Ausländer, Paul Celan
Thomas Schneider
1. Dichtung der Bukowina
Wie immer die Debatte um den interkulturellen Charakter der ehemals in be-
sonderem Maße multiethnischen und mehrsprachigen Bukowina angesichts
„eine[r] zunehmende[n] Polarisierung der wissenschaftlichen Auffassungen
über die interkulturelle Qualität der Erscheinungs- und Ergebnisformen des
bukowinischen […] Völkerpluralismus“ (Werner 2003a: 20) sich gestalten mag
– das Faktum der nicht selten an Verklärung grenzenden projektiven Aufla-
dung, wie sie die Bukowina als deutsch-jüdische Literaturlandschaft von den
in ihr Aufgewachsenen und vor allem ex post durch die aus ihr Vertriebenen
vielfach erfahren hat, ist um so auffälliger, als es immer auch schon gewichtige
Gegenstimmen gab. Rose Ausländers oft zitierten Zeilen von den „[v]ierspra-
chig verbrüderte[n] (/) Lieder[n] (/) in entzweiter Zeit“ (Ausländer 1984: 72)
aus dem Gedicht Bukowina II und Paul Celans prominentester Äußerung über
die Landschaft seiner Herkunft in der Bremer Rede von 1958: „Es war, wenn
ich diese topographische Skizze noch um einiges ergänzen darf, das mir, von
sehr weit her, jetzt vor Augen tritt, – es war eine Gegend, in der Menschen und
Bücher lebten“ (Celan 2000l: 185), seien deswegen, gleichsam vorsichtig kor-
rektiv, die Aussagen zweier Autoren mit dem selben Erfahrungshintergrund
gegenübergestellt, die das Bild einer ungetrübten und befruchtenden Inter-
kulturalität durch den Hinweis auf den in der Bukowina schon lange vor der
deutschen Besatzung herrschenden Antisemitismus zumindest relativieren. In
seiner Rede zum 60. Geburtstag kommt der 1901 in Czernowitz geborene und
später in Polen lebende jiddische Dichter Itzik Manger im Zusammenhang
poetologischer Überlegungen zu der von ihm bevorzugt verwendeten Form der
Ballade auf diesbezügliche Erfahrungen zu sprechen:
Mein Gemüt war seit Anbeginn voller balladenhafter Schatten. Ist das ein Wunder? Ich wuchs in
einem Land des klassischen Antisemitismus auf. Die griechisch-orthodoxen Kirchen breiteten
ihren giftigen und gefahrvollen Schatten über die jüdische Bevölkerung aus. In Polen, dem Land,
in dem ich bis zum Zweiten Weltkrieg lebte, spitzte sich dies zu. Hinter jedem polnischen Juden
zeichneten sich zwei Schatten ab: einer des erschrockenen Juden selbst und ein zweiter, fremder
Schatten mit einem Messer zwischen den Zähnen. (Manger 2004: 326)
Ähnlich äußert sich, in einem seiner letzten Interviews, der 1912 geborene, im
Alter von zwölf Jahren nach Czernowitz gekommene und als letzter jiddischer
Dichter dieser Region 2009 verstorbene Josef Burg:
Schnittstelle Germanistik, Jahrgang 1 (2021), Ausgabe 1
© 2021 Universitätsverlag WINTER GmbH Heidelberg
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)38 Thomas Schneider
Czernowitz hat Österreich, Rumänien, die Sowjetunion und die Ukraine erlebt und überlebt.
Alle haben dieser Stadt ihren Stempel gegeben. In der österreichischen Zeit war es eine Stadt,
wie es sie sonst wohl nur selten gab. Man hat nichts gewusst von einem Antisemitismus, von
einem Hass von Mensch zu Mensch. Als die Rumänen gekommen sind mit ihren ,Juden nach
Palästina‘-Rufen wurde alles anders. (Burg 2008: 25)
Und Celan selbst verließ im Schuljahr 1934/35 „das Oberrealgymnasium, das
er bisher besucht hatte, das ,Liceul Ortodox de Baeti‘, nicht wegen des Lehr-
plans […], sondern einzig und allein wegen des dort herrschenden Antisemitis-
for personal use only / no unauthorized distribution
mus“ (Chalfen 1983: 56). In einem Brief vom 30. Januar 1934 an seine Tante
in Palästina hält er dazu fest: „Was Angelegenheit Zeugniß betrifft, ja, hm! ich
bin der Zweite, aber..... nicht der erste, wie es von Rechtswegen hätte sein sollen.
Die Professoren, die Angehörigkeit zum jüdischen Zweig der semitischen Rasse
und noch viele andere Hinderniße! Ja, was den Antisemitismus in unserer
Schule betrifft, da könnte ich ein 300 Seiten starkes Buch drüber schreiben.“
Winter Journals
(Celan, zit.n. Chalfen 1983: 51)
Sowohl der eher launige Ton, in dem der vierzehnjährige Celan das Problem
des ihn doch sehr konkret betreffenden Antisemitismus als (nur) eines von
vielen Hindernissen anzusprechen vermag, wie auch die seltsam abstrakte und
wie distanziert wirkende Andeutung einer ,entzweiten Zeit‘ bei der späten
Rose Ausländer mögen wiederum Indizien dafür sein, dass mögliche soziale
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
und ethnische Konfliktlinien in der Bukowina der 1930er Jahre noch nicht als
wirklich bedrohlich oder gar destruktiv empfunden wurden, auch nicht für die
Wirklichkeit oder zumindest die Möglichkeit einer menschlichen, ideellen und
künstlerischen Gemeinschaft über die Sprach- und Völkergrenzen hinweg
oder gar durch diese hindurch. Gerade wenn man die These, dass „[d]ie von
den deutsch-jüdischen Autoren aus der Bukowina und Galizien entwickelten
positiven Ansichten dieser (süd)osteuropäischen Kulturregionen […] aus lebens
geschichtlichen Zusammenhängen unter dem Zeichen der Totalitarismen des
20. Jahrhunderts, des Holocaust vor allem, begriffen werden müssen“ (Werner
2003a: 20), unterstützt, müssen die Verhältnisse vor 1940/41 immerhin so
gewesen sein, dass sie retrospektiv eine starke positive Aufladung zuließen
– mag deren hoher Intensitätsgrad dann wiederum nur aus dem Unmaß von
Terror und Zerstörung und der nachfolgenden Erfahrung des ungeliebten
Exils zu erklären sein. Was Celans immer wieder zum Ausdruck gebrachte
Sehnsucht nach der Bukowina betrifft, so spielt ohne Frage auch seine zweite
traumatische Erfahrung, die vom Nachleben des Antisemitismus im Deutsch-
land der 1950er und 60er Jahre eine Rolle, wie er es vor allem (aber nicht nur)
in der Affäre um die Plagiatsvorwürfe Claire Golls erfuhr. Celans in einem Brief
an Alfred Margul-Sperber vom 30. Juli 1960 aufgeworfene Frage, „ob ich nicht
besser bei den Buchen meiner Heimat geblieben wäre…“ (Celan 1975: 56), ergeht
genau zwei Monate, nachdem er von Claire Golls unter dem Titel „Unbekanntes
Schnittstelle Germanistik, Jahrgang 1 (2021), Ausgabe 1
© 2021 Universitätsverlag WINTER GmbH Heidelberg
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Anmerkungen zur Dichtung der Bukowina 39
über Paul Celan“ veröffentlichten Plagiatsvorwürfen erfahren hatte, und in den
wenigen, aber intensiven Briefen an den in Czernowitz gebliebenen Freund
Gustav Chomed wird der Geburtsort in den folgenden Jahren, da er der an ihm
nicht gelungenen physischen Vernichtung die psychische und geistige folgen
sieht, endgültig zur rückwärtsgewandten Utopie. Der Brief vom 6. Februar
1962, in dem er die Goll-Affäre mit Bezug auf Heinrich Heine bitter kommen-
tiert: „Augenblicklich ist es so weit, daß man mich – siehe Loreley – für inexis-
tent erklärt. (Buchstäblich, lieber Gustav!) Und mich nach Strich und Faden
bestiehlt…“, endet mit dem Aufruf von Czernowitz als dem humanen Gegen-
bild: „Ach weißt Du, ich wollte, ich wohnte noch dort – nicht nur die Töpfer-
gasse war… menschlich.“ (Celan 2010: 16, 17)1 Die unmittelbare Antwort Cho-
meds auf diesen in seiner Deutlichkeit auch aus der Situation heraus
verstehbaren Wunsch Celans mag dem Ineinander der politisch-gewaltsamen
und emotionalen Besetzung des Ortes, an dem die Briefpartner als Kinder zu
spielen pflegten, in ihrer Nüchternheit und die Wirklichkeit prononcierenden
Schärfe auf andere Weise gerecht werden und sei deshalb in extenso zitiert:
Die Töpfergasse, liebes Paulchen, mit all dem was in, auf und um ihr [sic; T.S.] war – die gibt es
schon lang nicht mehr. ,Eto bylo davno i nepravda‘ heisst es sehr treffend auf russisch. Es ist nur
noch eine Erinnerung, die in – einigen – Herzen lebt. Du brauchst also nichts zu bedauern. Die
Tragödie unseres Lebens ist nicht die, dass die Töpfergasse verschwunden ist. Die Tragödie liegt
darin, dass es sie eigentlich gar nicht gegeben hat, außer in unserer Vorstellung. Wir sind die
Geisteskinder eines Deutschlands der Dichter und Denker, das es schon lang nicht mehr gibt.
Ich war in jenen Jahren in ziemlich engem Kontakt mit allen möglichen Arten von Deutschen
und habe mich mehr als einmal von unserer haushohen geistigen Überlegenheit überzeugt. Und
dass die Mehrzahl von ihnen Schweinehunde sind, hab ich schon damals, trotz der gedemütigten
Lage, in der sie waren, erkannt. Ausserdem hab ich noch Auschwitz und Ravensbrück gesehen…
(Chomed 2010: 22)2
Aber nicht erst retrospektive Beschwörung, auch schon die deutsch-jüdische
Dichtung der 1930er Jahre inszeniert die Bukowina als einen positiv besetzten
Raum, in welchem Juden sich einmal nicht auf Wanderschaft befinden, sondern
einer heimatlichen Landschaft eng verbunden erscheinen. Alfred Margul-
Sperber hält 1936 ausdrücklich fest, daß die „Bukowiner jüdischen Dichter […]
dem Boden und der Landschaft viel stärker verhaftet“ sind, „als dies bei jü
dischen Dichtern anderswo der Fall zu sein pflegt“ (Margul-Sperber, zit. n.
Emmerich 2001: 24) und veröffentlicht seine Lyrik, die dieser Boden-Haftung
1 Zur umfassenden Aufarbeitung der Affäre um die Plagiatsvorwürfe Claire Golls vgl. Wiedemann
(2000).
2 Brief vom 17. 2. 1962. – Vgl. aber auch die nochmalige Wendung der Thematik in Celans Antwort
vom 26. 2. 1962: „[…] die Töpfergasse, die ich zwar gar nicht anders sehe als Du, die es aber
dennoch gibt: quia absurdum.“ (Celan 2010: 25) Vgl. auch die Thematisierung des Absurden
in Celans Meridian-Rede von 1960 und die auf „den Ort meiner eigenen Herkunft“ bezogene
Feststellung: „Keiner dieser Orte ist zu finden, es gibt sie nicht, aber ich weiß, wo es sie, zumal
jetzt, geben müßte, und … ich finde etwas!“ (Celan 2000m: 202)
Schnittstelle Germanistik, Jahrgang 1 (2021), Ausgabe 1
© 2021 Universitätsverlag WINTER GmbH Heidelberg
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)40 Thomas Schneider
Ausdruck gibt, 1934 unter dem Titel Gleichnisse der Landschaft – eine Pro-
grammformulierung, deren konservativer und mythogener Gehalt ihm selbst
noch für die frühe Dichtung Celans gilt, wenn er Otto Basil in einem Brief aus
dem Jahr 1947 „doch gern sagen [möchte], daß Paul Celan der Dichter unserer
westöstlichen Landschaft ist, den ich ein halbes Menschenalter von ihr erwartet
habe und der diese Gläubigkeit reichlich lohnt“, um Celans ,Landschafts‘-Lyrik
dann allerdings seltsam übergangslos mit der doch vollendeten Bodenlosigkeit
der Prosa Kafkas zu vergleichen: „Ich für mein Teil glaube, daß Celans Gedichte
das einzige lyrische Pendant des Kafkaschen Werkes sind.“ (Margul-Sperber,
zit. n. Emmerich 2001: 72) Margul-Sperbers thematischer und formaler Kon-
servatismus, sein Bekenntnis „zu allem Veralteten und Herkömmlichen, in
Form, Wahl und Behandlung seiner dichterischen Gegenstände“ (Margul-
Sperber, zit. n. Emmerich 2001: 59), steht exemplarisch für jene Bukowiner
Lyrik, „der Peter Demetz mit Recht ihre ,anachronistische Loyalität zur deut-
schen klassisch-romantischen Tradition‘ vorgeworfen hat. […] Naturschwär-
merei, Harmoniestreben und ein Verharren in der traditionellen, metrisch re-
gelmäßigen Reimstrophe wie in geläufiger Bildlichkeit kennzeichnen diese
Lyrik, von Ausnahmen abgesehen. Poetisierung, Romantisierung der Welt ist
ihr nicht in Frage gestelltes Ziel.“ (Emmerich 2001: 41) Und Klaus Werner hält
in seinen Ausführungen zur „buchenländischen Natur- und Landschafts
dichtung“ entsprechend kritisch fest:
Die buchenländische Lyrik der 1930er Jahre gehorchte einem Funktionsverständnis, das sich
einer direkten, attackierenden Vergegenwärtigung zunehmend finsterer Zeiten verschloss und
Sozialkritik weitgehend aussparte, die Kontradiktion von Dichtung und Politik, Poesie und Ge-
sellschaft festschrieb und Lyrik als Fluchtpunkt menschlicher Hoffnungen und Sehnsüchte jen-
seits verunsichernder Weltläufe ansiedelte. Wo sich am Horizont die Zeichen des Faschismus
zu häufen begannen, der bald ganz Europa überziehen sollte, schuf jenes ,immer / zum Grund
zu‘, ins Mythische vordringende Wachhalten des Immerwährenden und Konsistenten, ergänzt
um Hymnen an die Nacht und poetische Mondscheinsonaten, tröstliche Ersatzrealitäten, redete
diese noble Dichtung der Dinge und des Herzens, dieser, wie man auch sagen könnte, poetische
Moderantismus, die Wirklichkeit in einem problematischen Sinne still. (Werner 2003b: 33)
Die hier zur Charakterisierung der bukowinischen Lyrik benutzte Metaphorik
mag andeuten, dass der in ihr konstituierte Flucht-Raum zentral auch ein müt-
terlich konnotierter ist. Der Raum der Imagination, den die ,Lieder‘ der ,Land-
schaft‘ abgewinnen und einer sich andeutenden ,Entzweiung‘ entgegensetzen,
kann in dem genauen Sinne einer Beschwörung von sprachloser Verständi-
gung und zeitüberhobenem Einverständnis als ein Raum des Imaginären ver-
standen werden, wie ihn für das kindliche Wünschen die Allgegenwart der
Mutter repräsentiert. Keine Rede vom ,Grund‘, vom ,Immerwährenden‘ und
,Konsistenten‘ funktioniert ohne die infantile emotionale Besetzung dieser wie
der ihnen in der Lyrik entsprechenden Metaphern, als welche die der ,Milch‘
die im intertextuellen Feld dieser Dichtung vielleicht sprechendste ist. Rose
Schnittstelle Germanistik, Jahrgang 1 (2021), Ausgabe 1
© 2021 Universitätsverlag WINTER GmbH Heidelberg
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Anmerkungen zur Dichtung der Bukowina 41
Ausländers Gedicht Bukowina III (Ausländer 1984: 130) apostrophiert die
Landschaft denn auch ausdrücklich als nährende Mutter und imaginiert die
Aufhebung der Unterschiedenheit der Sprachen in einer Kunst, in der die mit-
aufgenommene väterliche Komponente eine eindeutig sekundäre Rolle spielt:
Grüne Mutter
Bukowina
Schmetterlinge im Haar
Trink sagt die Sonne
rote Melonenmilch
weiße Kukuruzmilch
ich machte sie süß
Violette Föhrenzapfen
Luftflügel Vögel und Laub
Der Karpatenrücken
väterlich
lädt dich ein
dich zu tragen
Vier Sprachen
Viersprachenlieder
Menschen die sich verstehn
Noch das ,Stillreden der Wirklichkeit‘, mit dem Werner seine kritischen Aus-
führungen zum Moderantismus dieser Dichtung schließt, hat seine genaue
Entsprechung in der Strophe des Gedichts Ferner Gast (Margul-Sperber 1939:
23) von Margul-Sperber, dessen matrilineare Genese kaum abzuweisen ist:
Ihre Augen, unaussprechlich lind,
Sehn mich an mit fernem Sternenblinken;
Und sie flüstert: Willst du nicht, mein Kind,
Von der dunklen Milch des Friedens trinken?
Und auch die Beschwörung einer maximalen Intimität mit der Mutter in Rose
Ausländers 1939 in ihrem ersten Gedichtband veröffentlichtem Gedicht Ins
Leben (Ausländer 1939) verläuft über die bukowinisch omnipräsente Metapher
der Milch:
Nur aus der Trauer Mutterinnigkeit
strömt mir das Vollmaß des Erlebens ein.
Sie speist mich eine lange, trübe Zeit
mit schwarzer Milch und schwerem Wermutwein.
Die psychisch bedeutsame Möglichkeit der Evokation und Überführung infan-
tiler emotionaler Besetzungen in die Sprache des Erwachsenen konzentriert
sich bei Margul-Sperber und Ausländer auf eine klassische Weise in der Meta-
pher der Milch, insofern in der ,dunklen‘ bzw. ,schwarzen Milch‘ die imaginäre
Ambivalenz von Leben und Tod – individualgeschichtlich bzw. psychogenetisch
Schnittstelle Germanistik, Jahrgang 1 (2021), Ausgabe 1
© 2021 Universitätsverlag WINTER GmbH Heidelberg
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)42 Thomas Schneider
die von guter und böser Mutter – zwar angedeutet ist, durch die formale Har-
monisierung zugleich aber melancholisch moderiert: aufgehoben und stillge-
stellt – in Bezug auf die damit unmittelbar verbundene Metaphorik des Näh-
rens: gestillt erscheint. Als räumliche Repräsentation des Imaginären, so
könnte man zusammenfassend und zugespitzt sagen, wird die Bukowina zur
Gebär-Mutter dieser Dichtung.
Eine andere Dimensionierung erfährt der Rekurs auf die Bukowina als einen
mütterlichen Raum, als Repräsentationsraum des mütterlichen Imaginären in
der Lyrik Celans. Das initiale Oxymoron der Todesfuge, die „Schwarze Milch
der Frühe“, schneidet die psychokonstitutive Möglichkeit individualgeschicht-
lichen Durcharbeitens des Imaginären, wie es bei Margul-Sperber und Aus-
länder auch und gerade nach der Shoah dichterisch noch weitgehend im Rekurs
auf klassisch-romantische Modelle funktioniert, im Eingedenken der unauf-
hebbaren Wirklichkeit der Ermordung der Mutter ab und hebt dadurch das
mit der Mutter verbundene Imaginäre zugleich in eine andere, überpersönliche
Dimension.3 In einem Brief an Margul-Sperber vom 30. Juli 1960 verallgemei-
nert Celan die Beschwörung der ,Gegend, in der Menschen und Bücher lebten‘:
die retrospektive Evokation der Verbindung der „Buchen meiner Heimat“ mit
dem „Wort Mensch“ (Celan 1975: 54-56) zu der topographischen Konstruktion
einer Verbindung des Ostens bzw. des Östlichen mit einem im Westen „selten
gewordenen Seelenhaften“4, um über diese Konstruktion eines östlich Seelen-
haften bzw. seelenhaft Östlichen das sein Leben zerschneidende Trauma als
objektives formulierbar zu machen. Das Gedicht Der Reisekamerad (Celan
2000a: 66) greift das imaginäre Ineinander von Mutter und Raum noch als
persönliche Möglichkeit auf und vollendet die schützende Identifikation noch
und gerade im Außen des ,geteilten Lagers‘, ohne dass die mit dem Possessiv-
pronomen gegen den Verlust behauptete Möglichkeit der individuellen, zu-
gleich psychologischen (Seele) und poetologischen (Wort) Dimension der
Identifkation selber angegriffen würde. Die durch die anaphorische und paral-
lele Fügung und die stabilisierende Alliteration als paradigmatische beschwo-
rene Identifikation:
3 Celans Eltern wurden im Juni 1942 von den Deutschen abgeholt und am 18. August 1942 in
das Lager Michailowka deportiert; im Herbst/Winter 1942 Tod des Vaters durch Flecktyphus,
bald darauf Ermordung der Mutter. Die Härte der Celanschen Lyrik, „ihr wesentlich nicht be-
kenntnishafter, ihr unpersönlicher Charakter“ (Szondi 1978: 384), ist nicht zuletzt in diesem
objektiven Schnitt durch die Psyche fundiert. Es ist diese Dekonstitution der Psyche, die sie
unvermittelt auf jene sowohl geschichtliche wie vorgeschichtliche Dimensionen öffnet, von
denen weiter unten die Rede ist. Zum Problem des mütterlichen Imaginären in diesem Kontext
vgl. Schneider (2017).
4 Vgl. auch die Briefe an Chomed vom 26. 2. 1962 (Entwurf) und 18. 3. 1962 (Ausführung), die
das ,Seelenhafte‘ und das ,Östliche‘ über die Person und den Namen von Celans Frau, Gisèle
Celan-Lestrange – „Fräulein Seltsam“ – zusammenführen. (Celan 2010: 26, 30)
Schnittstelle Germanistik, Jahrgang 1 (2021), Ausgabe 1
© 2021 Universitätsverlag WINTER GmbH Heidelberg
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Anmerkungen zur Dichtung der Bukowina 43
Deiner Mutter Seele schwebt voraus.
Deiner Mutter Seele hilft die Nacht umschiffen, Riff um Riff.
Deiner Mutter Seele peitscht die Haie vor dir her.
Dieses Wort ist deiner Mutter Mündel.
Deiner Mutter Mündel teilt dein Lager, Stein um Stein.
Deiner Mutter Mündel bückt sich nach der Krume Lichts.
– wird mit der Apostrophe des Gedichts Schwarzerde (Celan 2000d: 241) zur
sprachlichen Identifikation des Verlusts der Mutter und der einer nicht einmal
mehr die „Krume Lichts“ tragenden, sondern vollends schwarz gewordenen
Erde intensiviert:
SCHWARZERDE, schwarze
Erde du, Stunden-
Mutter
Verzweiflung:
Ein aus der Hand und ihrer
Wunde dir Zu-
geborenes schließt
deine Kelche.5
Es ist dieser doppelte Verlust des mütterlichen Imaginären und seiner Reprä-
sentation im Raum, mit dem für Celan die Kontinuität dichterischer Imagina-
tion prinzipiell fraglich und „[d]ie Frage nach dem Woher […] dringender, ver-
zweifelter“ – Dichtung ihre eigene Verwundung wird: „die Dichtung – in einem
seiner Essays über die Poesie nennt Mandelstamm sie einen Pflug – reißt die
untersten Zeitschichten auf, die ,Schwarzerde der Zeit‘ tritt zutage“ (Celan
1999: 219). Mit dem Zusammenfall von Zivilisation und Barbarei, wie Celan
ihn in Todesfuge thematisiert und wie er sich für ihn im Zusammenfall von
Mutter- und Mördersprache darstellt, geht die Zerstörung in die Sprache der
Dichtung selber ein, die das Imaginäre in der Anstrengung seiner für die Psyche
konstitutiven Erinnerung zugleich immer auch aufzureißen gezwungen ist.
Durch die Identität von Evokation und Revokation wird das Sprechen apore-
tisch. Celans intensive Aufnahme und Auseinandersetzung mit der jüdischen
Tradition kann in diesem Zusammenhang auch als Versuch verstanden werden,
die durch die Zerstörung des inneren Konnexes von Sprache und Imagination
un-aus-tragbar gewordene Verletzung in eine überpersönliche symbolische
Ordnung einzutragen, die den Zusammensturz der lyrischen Rede verhindert,
ohne den Grad der traumatischen Verletzung zu relativieren. In Text und
Kontext des späten Gedichts Aus Engelsmaterie (Celan 2000f: 196) ergänzt
Celan die individualgeschichtlich unbeantwortbar gewordene Frage nach dem
5 Vgl. den Kommentar von Wiedemann zu dem Ausdruck „Schwarzerde“: „Fruchtbare Humus-
schicht in Südrußland und der Ukraine, auch in Celans Heimat Bukowina; der Bestandteil
,Czerno-‘ von ,Czernowitz‘ entspricht russ. черный für ,schwarz‘.“ (Wiedemann 2005: 688)
Schnittstelle Germanistik, Jahrgang 1 (2021), Ausgabe 1
© 2021 Universitätsverlag WINTER GmbH Heidelberg
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)44 Thomas Schneider
Woher um die Frage nach dem Wohin, indem er sie als geschichtsphilosophi-
sche Spannung von Arché und Telos in die topographischen Koordinaten der
jüdischen Mystik einschreibt. Die Zeile „vom Osten gestreut, einzubringen im
Westen“, zitiert explizit Gershom Scholems Von der mystischen Gestalt der
Gottheit: „Aus dem Osten stammt der Same, der in der Sphäre der Schechina in
die Welt tritt und aus ihr, ,wo sich aller Same vermischt‘, bei der Erlösung wie-
der heimgebracht wird“, sowie: „Im Osten ist das Schatzhaus der Seelen, die in
die Sphäre der Schechina, die der mystische Westen oder die Vermischung ist,
ausgesät werden.“ (Scholem, zit. n. Wiedemann 2005: 779) Der Übertragung
der Bukowina in die mystische Vorstellung des Ostens entspricht dabei die der
Mutter in die mystische Vorstellung der Schechina, in welche „das seit dem be-
rühmten Kapitel 31 in Jeremia auftauchende Bild der Mutter Rahel, die über
ihre Kinder, die ins Exil ziehen, weint, sowie die Personifizierung Zions als einer
mütterlichen Gestalt“ (Scholem, zit. n. Wiedemann 2005: 782) eingegangen ist.
Mit „Mutter Rahel“ und „Ziw“, dem Licht der Schechina, zitiert das Gedicht
Nah, im Aortenbogen (Celan 2000f: 202) die kabbalistischen Spekulationen
ausdrücklich, um das „Hellwort“ – einem zentralen Verfahren der Celanschen
Lyrik folgend – „im Hellblut“ zugleich wiederum physisch rückzubinden und
anatomisch zu verorten.
2. Einbruch der Gewalt
Auf dem Hintergrund der Trennung von Dichtung und gesellschaftlich-politi-
scher Realität und der imaginären Aufladung der Bukowina muss der Terror
des Zweiten Weltkriegs um so stärker als Einbruch der Gewalt in einen zuvor
geschützten und schützenden, mütterlich bergenden Raum erfahren worden
sein. Von den vielen Texten, die davon Zeugnis ablegen, sei hier nur ein kurzer
Ausschnitt aus Alexander Gelmans Kindheit und Tod zitiert:
Vor dem Krieg bin ich dem Tod nur ein einziges Mal begegnet. Und dann habe ich in einem
Winter Dutzende, ja Hunderte von Toten gesehen, darunter meine Mutter, meinen Bruder,
meine Großmutter, meine Tante mit Mann und Sohn, meinen Onkel mit Frau und Sohn … Der
Tod war nicht bloß Teil meiner Kindheit, er bestimmte sie, er war Herr über alles und machte
mit meiner Seele, was er wollte. Ich weiß gar nicht so richtig, was er angerichtet hat, und werde
es auch nie erfahren. (Gelmann, zit. n. Werner 2003c: 73)
Die eindringlichen Worte Gelmans weisen mit der gewaltsamen Zerstörung
von Physis und Psyche auf jene Unfassbarkeit und Unerfahrbarkeit des Ge-
schehens hin, wie sie einen traumatischen Vorgang kennzeichnen. Der Ver-
zweiflung über die der Unfassbarkeit und Unerfahrbarkeit des Geschehens
entsprechende Unsagbarkeit, wie sie der letzte Satz Gelmans birgt, hat die
Dichtung während und nach der Shoah (eine) Sprache abzuringen versucht.
Schnittstelle Germanistik, Jahrgang 1 (2021), Ausgabe 1
© 2021 Universitätsverlag WINTER GmbH Heidelberg
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Anmerkungen zur Dichtung der Bukowina 45
Die damit verbundene Problematik ist nicht nur eine der Unangemessenheit
jeden Sprechens und jeden Ausdrucks gegenüber der Dimension der Gewalt
und des Leids, sondern die noch fundamentalere der inneren Zerstörung der
Sprache durch die Zerstörung der Psyche, des Einbruchs der Gewalt auch in
die inneren emotionalen Räume und damit in deren sprachliche Repräsenta-
tion: die Auflösung der für die Psyche konstitutiven emotionalen Besetzungen
von Sprache, wie sie sich individualgeschichtlich in der gleichzeitigen Genese
des Seelenlebens und seines sprachlichen Ausdrucks bilden. Genau diesen
Aspekt hält Gelman – entsprechend dem hier thematisierten Zusammenhang
von Imaginärem und Gewalt – schon im Titel seiner Aufzeichnugen fest. Die
Artikulation des traumatischen Geschehens, sofern es überhaupt zu einem
Aussprechen kommt, erscheint der Verletzung deswegen nicht angemessen,
weil der traumatische Einschnitt die Emotionen von der Sprache und die Spra-
che von den Emotionen trennt und in der Folge jedes Sprechen zu einem in
diesem intensiven Sinne äußeren und äußerlichen macht. Das traumatische
Geschehen kann prinzipiell nicht in die Sprache zurückgeholt: gerade auch
sprachlich nicht erinnert und verinnerlicht werden; es bewohnt die Psyche wie
eine durch Verseuchung unbetretbar gewordene Zone, die auch ihre Umge-
bung kontaminiert. Wenn Celan am 29. Januar 1970 in einem seiner letzten
Briefe schreibt, er „habe in [s]einen Gedichten ein Äußerstes an menschlicher
Erfahrung in dieser unserer Zeit eingebracht“ (Celan 2010: 62), dann ist damit
auch jener Punkt anvisiert, an dem das Innen menschlicher Erfahrung durch
die gewaltsame Zerstörung des konstitutiven Zusammenhangs von Sprache
und Emotionalität zu einem Außen zu werden droht – und in genau diesem
Sinne die Anstrengung provoziert, immer wieder, von Text zu Text, ,einge-
bracht‘ zu werden. Die Arbeit an der Erfahrung des Terrors ist genau deswegen
eine intensiv sprachliche und als solche ihre eigene Gefährdung, insofern das
notwendige Einbringen des Außen das Seelenleben und seinen sprachlichen
Ausdruck noch einmal zu zerstören, um die schon zitierte Metapher
Mandelstams aufzugreifen: die Psyche wie ein Pflug aufzureißen droht. Ein
Sprechen, das sich auf der damit angedeuteten Grenze zu bilden und zu halten
versucht, ist tendenziell seine eigene Negation.
Versucht man, die traumatische Erfahrung des Einbruchs von Gewalt rein
strukturell als Aufhebung der Unterscheidung von Innen und Außen durch
Vergewaltigung und Überwältigung der Psyche und ihres sprachlichen Aus-
drucks und damit als Nullpunkt nicht nur von sprachlicher Erfahrung, sondern
von symbolischer Ordnung überhaupt zu fassen, so referiert die Dichtung nach
der Shoah nicht selten auf vor allem zwei strukturelle Figuren, um die Erfah-
rung des Nullpunkts bzw. den Nullpunkt in die Erfahrung einzuholen und der
in ihm konzentrierten Gewalt von dieser Gewalt nicht berührte Erfahrungsge-
halte, ja die Möglichkeit von Erfahrung überhaupt abzugewinnen. Im Folgenden
Schnittstelle Germanistik, Jahrgang 1 (2021), Ausgabe 1
© 2021 Universitätsverlag WINTER GmbH Heidelberg
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)46 Thomas Schneider
sollen diese Figuren an Texten von Itzik Manger und Rose Ausländer exempla-
risch aufgezeigt werden, um dann auf diesem Hintergrund das Spezifische des
Celanschen Ansatzes anzudeuten.
2.1 Nullpunkt und Inversion
In seinem poetologischen Text Die Ballade – die Vision des Bluts von 1929 hat
Itzik Manger die traditionelle Figur der Inversion als „balladische Verwand-
lung“ zum konstitutiven Moment seiner Lyrik erklärt. Metaphorisch wird ein
Nullpunkt von Erfahrung anvisiert und als Durchgangs- und Umschlagspunkt
zu einer gesteigerten Erfahrung und ihres unmittelbaren Ausdrucks in der
Dichtung beschworen. Exakt „da“, wo Wahrnehmung und Sprache enden und
die Grenzen von Innen und Außen sich im „Rausch“ dionysischen „Einswer-
dens“ verlieren, „beginnt das große Bacchanal“ und „wird auf dem Grund der
Nacht die Niemandstat geboren“:
Das ist der Strahl, der die ruhige Empfindung, die stille lyrische Seelenschwingung verwischt.
Das ist der Anblick am Rand der Nacht, des Tods und Wahnsinns. Das ist das wilde Mysterium,
das in unserem exaltierten Blut schlummert – die Ballade. (/) Ich gehe durch die Dämmerung,
grau in grau. Am Horizont erwacht das Unklare. Silhouetten werden gänzlich schwarz. Bäume,
Häuser, Laternen. Alte gebückte Bettler. Das Blut hebt zu brausen an, verschlingt das Panora-
ma von Umrissen. Wird Rausch … Berauschung. Und durch das Einswerden von Silhouette und
Rauschen des Bluts kommt die balladische Verwandlung in Gang. Die Schattenrisse der Bettler
tragen in ihren schwer schleppenden Schritten Fragezeichen. Sie ritzen diese Fragezeichen in
die nächtlichen Sterne ein. Umherziehende Gestalten fragen. Verlorene Gestalten suchen. Die
Nacht schweigt, antwortet nicht. Gibt das Verlorene nicht zurück. Da beginnt das große Baccha-
nal. Die dürre Bettlerhand entzündet rote sündige Monde. Und mit wilder Ekstase wird auf dem
Grund der Nacht die Niemandstat geboren. Das zerzauste, sinnlose Gelächter menschlicher
Verzweiflung. Die große mystische Vision unseres Blutes – die Ballade. (Manger 2004: 325f.)
Nicht anders beschwört noch Mangers bereits oben zitierte und die Erfahrung
des Antisemitismus thematisierende Rede zum 60. Geburtstag den Nullpunkt
als die invertierende Genese eines anderen Zustands. Die inzwischen erfolgte
Deromantisierung der Erfahrung von Rausch und Nacht zu der einer konkreten
Todesdrohung affiziert nicht die prinzipiell mystische Struktur der Absolution:
des Umschlagens von Negation in Position und deren sowohl religiöse wie ro-
mantische Aufladung, ihrer Qualifizierung als ,Läuterung‘ und ,Verwandlung‘:
Mein Gemüt war seit Anbeginn voller balladenhafter Schatten. Ist das ein Wunder? Ich wuchs
in einem Land des klassischen Antisemitismus auf. Die griechisch-orthodoxen Kirchen breite-
ten ihren giftigen und gefahrvollen Schatten über die jüdische Bevölkerung aus. In Polen, dem
Land, in dem ich bis zum Zweiten Weltkrieg lebte, spitzte sich dies zu. Hinter jedem polnischen
Juden zeichneten sich zwei Schatten ab: einer des erschrockenen Juden selbst und ein zweiter,
fremder Schatten mit einem Messer zwischen den Zähnen. (/) All diese Schatten, die in mein
jüdisches Gemüt hineingedunkelt hatten, versuchte ich in meiner Ballade zu läutern, das Balla-
denhafte in mir und um mich herum in Musik zu verwandeln.6 (Manger 2004: 326)
6 Um nicht nur Programmformulierungen, sondern auch einen lyrischen Text Mangers zu zitieren,
Schnittstelle Germanistik, Jahrgang 1 (2021), Ausgabe 1
© 2021 Universitätsverlag WINTER GmbH Heidelberg
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Anmerkungen zur Dichtung der Bukowina 47
Aus der Situation des postbukowinischen Exils heraus rekurriert Rose Aus-
länder auf dieselbe Struktur als Bedingung für die poetische Reinszenierung
der verlorenen Landschaft. Auch ihr Gedicht Im Dschungel (Ausländer 1985:
337) steigert das im Titel angedeutete Chaos bis zu dem Punkt des Ineinan-
ders von seelischem und sprachlichem Ver-Sagen als dem Moment, da der
,Zauber‘ einsetzt:
[…]
Wo sollen meine Gespielen
aus dem Apfelland wohnen
der Cecina die geschliffnen Pruthsteine?
Wo die Gespräche mit Kindern
die Augen der Blinden die
weiter schaun als die Gassen?
Wenn ich mich verirre
hier im Dschungel
mein Atem verstrickt
im Steingestrüpp
ruf ich meine Gefährten aus der Tasche:
Revnawald Habsburgshöh
Echo und Dorna
und wenn alles versagt
zaubert in meiner Tasche die Zimbel
den Rabbi Eli Melech herbei
Ob „auf dem Grund der Nacht“ oder „wenn alles versagt“: jeweils wird ein Zu-
stand vollendeter Indifferenz zu dem Punkt stilisiert, der die Bedingung der
Möglichkeit dichterischen Sprechens – vor wie nach der Shoah – darstellt.
Mangers ,balladischer Verwandlung‘ entspricht Ausländers ,zauberische‘ Evo-
kation des Verlorenen – die Möglichkeit sprachlicher Herstellung eines positiv
besetzten emotionalen Raumes aus einer Negation heraus, die als konstitutive
in dem Moment ihres konstitutiven Fungierens noch sich selber negiert und
das auf diese Weise durch sie konstituierte Sprechen nicht affiziert. Indem das
Moment der Negation damit in einem genauen Sinne zugleich bedeutend (für
die Positionen) und unbedeutend (als Negation) wird, ermöglicht es einen
weitgehend narrativen Diskurs, dessen Subjekt-Objekt-Prädikat-Struktur und
der Negation und Position auf diese Weise zusammenschließt, sei die letzte Strophe der Rede
des Schneidergesellen Notte Manger an den Dichter angeführt: „Und eine Träne fiel (/) in dein
Gemüt, (/) mit Wunde und Wunder (/) im Gedicht aufgeblüht.“ (Manger 2004: 249) Das im
November 1942 geschriebene Gedicht steht in dem Band Der Schneidergeselle Notte M anger
von 1948, der dem Gedenken des von den Sowjets nach Samarkand deportierten und 1944 um-
gekommenen Bruders gilt. „Zugleich markiert der Band die Bruchlinie im Mangerschen Werk:
danach entstanden kaum noch Gedichte.“ (Efrat Gal-Ed, Nachwort zu Manger 2004: 320) An
den wenigen späten Gedichten wäre zu überprüfen, inwiefern die Bruchlinie auch das Konzept
der ,balladischen Verwandlung‘ affiziert.
Schnittstelle Germanistik, Jahrgang 1 (2021), Ausgabe 1
© 2021 Universitätsverlag WINTER GmbH Heidelberg
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)48 Thomas Schneider
mimetisch-referentieller Charakter nicht in Frage steht. Die Möglichkeit der
Artikulation von Welt als einem mehr oder weniger geordneten Zusammenhang
von Erinnerung und Erfahrung lagert damit in dem Nullpunkt als in einem
nicht artikulierten und prinzipiell nicht artikulierbaren Zentrum. Seine Insze-
nierung als konstitutive Mitte lyrischen Sprechens: als stummer Punkt der
Vermittlung qualifiziert Dichtung zu einem handhabbaren Medium der Kon-
taktaufnahme mit wie immer räumlich repräsentierten verlorenen Anteilen
der Seele, die Gefahr implizierend, dass diese durch ihre mediale Verfügbarkeit
je und je auch zu abstrakten Gestalten werden.7
2.2 Nullpunkt und Aufspaltung der Ambivalenz
Die Fixierung eines Nullpunkts symbolischer Ordnung kann als Versuch ver-
standen werden, eine destruktive Gewalt zugleich zu bannen und dichterisch
ins Produktive zu wenden. Gelingt der Versuch, so ermöglicht die Indifferenz
als Stillstellung der die Erinnerung irritierenden Ambivalenz von Negation
und Position die Präsenz einfacher Referenzen – wie in dem Gedicht Auslän-
ders die erinnernde Gegenwart bukowinischer Orte. In der Ununterschieden-
heit des Nullpunkts aber insistiert die unausgetragene Ambivalenz von Nega-
tion und Position und generiert eine zweite Form der sprachlichen Artikulation,
nämlich die Aufspaltung der Ambivalenz und ihre antithetische Aufteilung.
Markiert, um eine metaphorische Analogie aufzugreifen, die dichterische „Nie-
mandstat“ bei Manger das unartikulierbare Zentrum der Figur der Inversion,
so die Situierung des dichterischen Sprechens Im Niemandshaus (Ausländer
1986: 169) bei Ausländer exakt den Ausgangsort dieser zweiten Möglichkeit als
einer von differenzierender Artikulation:
Ich wohne im Niemandshaus
Mit Vögeln
Und einer Schlange
[…]
Meine Vögel haben
Herzliche Stimmen
Die Schlange wartet
Auf den Biss
7 Werners Rede von einer „Galerie von Schlüssel-Orten elementarer und ideeller Art“ (Werner
2003b: 36) im Zusammenhang mit dem Text Im Dschungel kann in genau diesem Sinne kritisch
gewendet werden. Vgl. auch seine Einschätzung des „,Mengenartigen‘ der Gedicht-Stafetten“
Ausländers: „Der Eindruck eines gewissen Selbstlaufs der lyrischen Reflexion und einer damit
einhergehenden partiellen Beliebigkeit der Hervorbringungen drängt sich namentlich im Spät-
werk durchaus auf.“ (Werner 2003d: 159)
Schnittstelle Germanistik, Jahrgang 1 (2021), Ausgabe 1
© 2021 Universitätsverlag WINTER GmbH Heidelberg
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Anmerkungen zur Dichtung der Bukowina 49
Der Punkt absoluter Indifferenz, wie er aus dem gewaltsamen Zusammen-
bruch der die symbolische als kulturelle und sprachliche Ordnung konstituie-
renden Differenzen hervorgeht, wird hier nicht zum Punkt der Verwandlung
überhöht, sondern durch Differenzierung der in ihm gebannten Ambivalenz in
die symbolische Ordnung eingebracht. Die Bewältigung der jede symbolische,
sprachlich-kulturelle Ordnung nicht nur irritierenden, sondern unterminie-
renden Indifferenz und damit die Lösung des destabilisierenden Ambivalenz-
konflikts erfolgt durch Auflösung der Ambivalenz in einfache, sprachlich fixier
bare und als solche stabile Gegensätze, wie sie als antithetische Metaphorik
das gesamte Werk Rose Ausländers durchziehen. Als Versuch des Umgangs
mit der Erfahrung von Gewalt sind die immer neuen metaphorischen Anti
thesen Ausländers lesbar auch als ein Umgehen der Gewaltstruktur. Noch das
für ihre Poetik der Ambivalenz zentrale und geschichtsphilosophisch weit aus-
greifende Gedicht Janusengel (Ausländer 1986: 146) entschärft den gewalt
samen Schnitt durch „Zeit“ und „Gedächtnis“, indem er dessen Zwiespältigkeit
mehrfach zu eindeutigen Antithesen neutralisiert und noch abschließend meta
phorisch stillstellt:
Der seinen Flügelschlag kennt
Meister
schneide in unser Gedächtnis
seine Geschichte
rosenzart
messerscharf8
3. Sprache der Ambivalenz
Celans Lyrik hat ihre unversöhnliche Härte daran, dass sie die hier strukturell
als Indifferenz begriffene geschichtliche Situation des Ineinanders von Zivili-
sation und Barbarei als die einer „vollkommenen Schändlichkeit“ (Hamacher
1988: 88) annimmt, ohne die vollkommen schändlich und nur in diesem Sinne
absolut gewordene Gewalt zum Einsatzpunkt invertierender Aufhebung zu
machen oder durch metaphorische Aufspaltung sprachlich zu verwalten. Im
Eingedenken des Verlorenen: der Bukowina als einer ,Gegend, in der Men-
schen und Bücher lebten‘, wird Dichtung als Suche nach dem verlorenen Ort
von Menschlichkeit und Sprache und damit nach ihrer eigenen Möglichkeit
8 Vgl. zu diesem Komplex auch Werner (2003d), wo sich auch eine Deutung des Gedichts Janus
engel findet. Mit einem Wort Franz Fühmanns bezeichnet Werner diesen Modus Rose Aus-
länders, „die existenzielle Lähmung fallweise zu kompensieren“, als „,Magie der Alternative‘“
(Werner 2003d: 151). Das ,magische‘ Moment des Modus der Aufspaltung korrespondiert dem
,zauberischen‘ des Modus der Inversion; beide Modi der Ermöglichung des Sprechens funktio-
nieren über ein nicht artikuliertes bzw. nicht artikulierbares Zentrum.
Schnittstelle Germanistik, Jahrgang 1 (2021), Ausgabe 1
© 2021 Universitätsverlag WINTER GmbH Heidelberg
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)50 Thomas Schneider
zum Versuch einer Ortung: zu Topo-Graphie. Als solchermaßen orts-gebundene
– und in diesem Sinne mag Margul-Sperbers oben angeführte Aussage, Celan
sei „der Dichter unserer westöstlichen Landschaft“, doch zutreffen –
transzendiert sie nicht die irdischen Koordinaten, sondern wird selbst zum
„Gelände“ (Harnischstriemen, Celan 2000e: 28). Als Landvermessung ver-
weigert sich Celans Lyrik den klassischen Modi des dichterischen Umgangs
mit dem Phänomen der Gewalt. Seine blasphemischen Gedichte kritisieren
deswegen zentral den strukturellen Zusammenhang von Inversion und Ästhetik
und weisen diesen auch als problematische Säkularisation der christologischen
Vorstellung des erlösenden Durchgangs durch den Nullpunkt des Kreuzes auf,
wie sie als Imagination der Fixierung und Bannung universaler Gewalt am
Grunde der Möglichkeit universaler „goldene[r] Rede“ (Spät und Tief, Celan
2000a: 35) liegt. Celans Konzeption einer „,grauere[n]‘ Sprache, […] die unter
anderem auch ihre ,Musikalität‘ an einem Ort angesiedelt wissen will, wo sie
nichts mehr mit jenem ,Wohlklang‘ gemein hat, der noch mit und neben dem
Furchtbarsten mehr oder minder unbekümmert einhertönte“ (Celan 2000k:
167), trägt darum als Einspruch gegen den inneren Zusammenhang von Ge-
walt und religiöser und ästhetischer Erlösung einen genauen geschichtsphilo-
sophischen Index. Der genuin christlichen Figur vollzogener und darum immer
wieder vollziehbarer Absolution steht in Celans Dichtung das jüdische Motiv
konkreter Landsuche entgegen.9
Das Maß der Aufgabe einer Vermessung des verlorenen Landes wird in der
Erfahrung der geschichtlichen Situation als der eines Ineinanders von Zivilisa-
tion und Barbarei, des Zusammenbruchs der symbolischen Ordnung als einer
Ordnung von Differenzen, zum Unmaß: im Zustand der Indifferenz sind als
einem prinzipiell maßlosen keine Maßstäbe mehr gegeben. Der Kritik der topo-
logischen Figur der Inversion entspricht deswegen die topo-graphische Kon-
zeption des Verfahrens der Engführung (Celan 2000c: 195ff.) als Gang „mit
der Kunst in deine allereigenste Enge“ (Celan 2000m: 200), der mit dem Ein-
bruch der Gewalt als dem „EINBRUCH des Ungeschiedenen (/) in deine Spra-
che“ (Celan 2000i: 150) zugleich die Engführung von Erfahrung und Sprache,
der Austrag der Identität von Mutter- und Mördersprache ist: „Ich habe die
Worte, die Stimmen wirklich enggeführt (mich von ihnen engführen lassen)
– ins Unerbittliche des letzten Gedichts […]“ (Celan, zit. n. Wiedemann 2005:
667). Der sprachliche Nach-Vollzug der Erfahrung der Vernichtung, auf dem
Celan in dem Brief an Walter Jens vom 21. März 1959 insistiert, ist somit auch
einer der Vernichtung der Sprache, die, „Düsterstes im Gedächtnis“: „,angerei-
chert‘ von all dem“ (Celan 2000l: 186), keine erinnernd bereicherte und be-
reichernde, sondern eine kontaminierte, verseuchte: eine aussätzige und immer
9 Vgl. zu dieser Unterscheidung in Celans Todesfuge Schneider (2010).
Schnittstelle Germanistik, Jahrgang 1 (2021), Ausgabe 1
© 2021 Universitätsverlag WINTER GmbH Heidelberg
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Anmerkungen zur Dichtung der Bukowina 51
wieder aussetzende ist. Die Verderbnis der Sprache generiert eine Sprache des
Verderbens, in der mit ihr selbst noch das Andenken der Opfer pervertiert er-
scheint: „Welches der Worte du sprichst – (/) du dankst (/) dem Verderben.“
(Welchen der Steine du hebst, Celan 2000b: 129) Das Einbringen des Äußers-
ten: die sprachliche Verinnerung von Gewalt und gewaltsamem Tod, terminiert
in Selbstvergewaltigung und Tod der Sprache selbst, indem noch der Prozess
der Signifikation durch die Veräußerung des Signifikanten zum Signifikat ab-
stirbt: „Ein Wort – du weißt: (/) eine Leiche.“ (Nächtlich geschürzt, Celan
2000b: 125) Diese Engführung von Sprache und Erfahrung lässt sich im Werk
Celans bis zu dem Punkt traumatischer Sprach- und Erfahrungslosigkeit ver-
folgen – von der narrativen Evokation der Bukowina in Oben, geräuschlos
(Celan 2000c: 188):
(Erzähl von den Brunnen, erzähl
von Brunnenkranz, Brunnenrad, von
Brunnenstuben – erzähl.
– und der schon zitierten Ineinanderblendung von Mutter- und Ortsverlust in
Schwarzerde (Celan 2000d: 241)
SCHWARZERDE, schwarze
Erde du, Stunden-
Mutter
Verzweiflung:
Ein aus der Hand und ihrer
Wunde dir Zu-
geborenes schließt
deine Kelche.
– über die Verwundung und das physische Sich-Verzehren der Erinnerung
selbst (Schwarz, Celan 2000e: 57):
SCHWARZ,
wie die Erinnerungswunde,
wühlen die Augen nach dir
in dem von Herzzähnen hell-
gebissenen Kronland,
das unser Bett bleibt:
– bis zu der durch die Engführung von Sprach- und Ortsverlust in ihrer Un(dar)-
stellbarkeit endenden Frage in Deine Augen im Arm (Celan 2000f: 123):
Wo?
Mach den Ort aus, machs Wort aus.
Lösch. Miß.
Aschen-Helle, Aschen-Elle – ge-
schluckt.
Schnittstelle Germanistik, Jahrgang 1 (2021), Ausgabe 1
© 2021 Universitätsverlag WINTER GmbH Heidelberg
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)52 Thomas Schneider
Vermessen, entmessen, verortet, entwortet,
entwo
In dem sprachlich durch Paronomasie hergestellten Ineinander von „Aschen-
Helle“ und „Aschen-Elle“, darin das Maßlose der Gewalt zum einzig verfügbaren
Maß und in unausgesprochener Realisierung und Radikalisierung der Parono-
masie von ,Helle‘ und ,Elle‘ die Hölle als ,Helle‘ zu ihrem eigen(st)en Licht ge-
worden ist, erweist sich die Topographie der Indifferenz als strukturell unmög-
lich.10 Sprechen über den Stand von Zivilisation wird nach deren Untergang als
buchstäbliches zum archaischen Vorgang der „Knochenstabritzung“ (Spasmen,
Celan 2000f: 122).11 Die in dem Gedicht Stille! (Celan 2000a: 75): „Sie blutete
schon, als wir mischten das Ja und das Nein, (/) als wirs schlürften“ schon früh
als Struktur der Erfahrung benannte und in Sprich auch du (Celan 2000b:
135) zur Form eines lyrischen Imperativs geronnene Insistenz auf der Unhin-
tergehbarkeit der Struktur der Ununterschiedenheit: „Sprich – (/) Doch schei-
de das Nein nicht vom Ja.“, realisieren die letzten Zeilen des poetologischen
Gedichts Tübingen, Jänner (Celan 2000d: 226) als sprachliche, wenn die
schrittweise immer wieder neu ansetzende Annäherung an die Gegenwart aus
der Perspektive der jüdischen Tradition in infantiler Vorsprachlichkeit mündet
und die Rede am Rande (der Zerstörung) ihrer selbst in Hölderlins spätem
Neologismus für die Nichtunterscheidung von Ja und Nein ver-endet:
Käme,
käme ein Mensch,
käme ein Mensch zur Welt, heute, mit
dem Lichtbart der
Patriarchen: er dürfte,
spräch er von dieser
Zeit, er
dürfte
nur lallen und lallen,
immer-, immer-
zuzu.
(„Pallaksch. Pallaksch.“)
10 Vgl. zu dieser Struktur der Selbstverzehrung auch den Aphorismus aus Gegenlicht: „Täusche
dich nicht: nicht diese letzte Lampe spendet mehr Licht – das Dunkel rings hat sich in sich selber
vertieft.“ (Celan 2000j: 165)
11 Vgl. die ebenfalls durch das Verfahren der Paronomasie getragene Radikalisierung der Eng-
führung von Sprache und Körper bis hin zu der von Logos und Sexus: „SPASMEN, ich liebe
dich, Psalmen […] in dich, in dich (/) sing ich die Knochenstabritzung, (//) Rotrot, weit hinterm
Schamhaar (/) geharft, in den Höhlen […].“ (Celan 2000f: 122)
Schnittstelle Germanistik, Jahrgang 1 (2021), Ausgabe 1
© 2021 Universitätsverlag WINTER GmbH Heidelberg
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Anmerkungen zur Dichtung der Bukowina 53
4. Im Namen – der Kreatur
In der in Tübingen, Jänner wie in vielen anderen Gedichten hergestellten ge-
schichtsphilosophischen Spannung eines Zusammenschlusses von Anfang und
Ende: hier der Anfänge jüdischer Rede im Namen der Väter mit dem Zustand
infantiler Vorsprachlichkeit, steht mit der symbolischen Ordnung auch die
Möglichkeit des Sprechens in Frage. Diagnostisch fällt im Bild der ,lallenden
Patriarchen‘ die Instanz des Vaters, die das Infans aus der sprachlosen Unun-
terschiedenheit zur Sprache zu befreien aufgerufen ist, mit der Position des
Infans strukturell zusammen. Noch den Instanzen bzw. der Instanz der sym-
bolischen Ordnung droht infantile Regression, weil mit dem „Einbruch des
Ungeschiednen“: der Indifferenz von Zivilisation und Barbarei, im Innersten
auch die Sprache als System von Differenzen affiziert ist. Deswegen gilt für Das
– geschichtlich realisierte – Nichts (Celan 2000h: 110):
[…]
das Ende glaubt uns
den Anfang,
vor den uns
umschweigenden
Meistern,
im Ungeschiednen, bezeugt sich
die klamme
Helle.
Anvisiert wird mit dem ,Ungeschiednen‘ als der ,klammen Helle‘ eine Stätte, in
der das Ende des zivilisatorischen Prozesses auf dessen früheste Anfänge zu-
rückverweist und die finale Situation zur initialen wird: ,das Ende uns den An-
fang glaubt‘. Die Struktur der Ungeschiedenheit kann im Bild der „klamme[n]
(/) Helle“ als dem einer das Licht trübenden Feuchtigkeit als Bild des phylo-
genetischen Übergangs vom Meer zum Land gelesen werden. In ihm wird die
Krisis der Gegenwart als eine doppelte kenntlich: wie die phylogenetische In-
differenz von Land und Meer auf die prähistorische Zuständlichkeit der Ge-
genwart, so verweisen die Anfänge der phylogenetischen Differenzierung von
Land und Meer auf diesen Zustand als den, dem als aktuell unhintergehbarem
neue Unterscheidungen abzugewinnen sind.
In der Meridian-Rede hat Celan für den Rekurs auf die Sphäre eines präkul-
turellen und prähumanen Ineinanders von Re- und Progression den Begriff des
„Kreatürlichen“ (Celan 2000m: 191)12 gefunden und die je und je zu leistende
12 Vgl. Celans zeitgleiches Interesse für die von Martin Buber, Joseph Wittig und Viktor von Weiz-
säcker herausgegebene Zeitschrift Kreatur (1926-1930); vgl. auch die Briefe Nr. 26 und 32 in
Celan/Szondi (2005: 20, 23).
Schnittstelle Germanistik, Jahrgang 1 (2021), Ausgabe 1
© 2021 Universitätsverlag WINTER GmbH Heidelberg
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)54 Thomas Schneider
Anstrengung der Dichtung, neue Differenzierungen zu gewinnen, mit aus-
drücklichem Bezug auf Georg Büchners und Jakob Michael Reinhold Lenz‘ ma-
terialistische Ästhetik konzipiert. Büchners bzw. Lenzens „elementarischer
Sinn“: „Man versuche es einmal und senke sich in das Leben des Geringsten
und gebe es wieder, in den Zuckungen, den Andeutungen, dem ganzen feinen,
kaum bemerkten Mienenspiel“ (Büchner 1980: 76) entspricht der elementaren
Arbeit Celans als einer, deren Rückgang auf das Kreatürliche durch die Shoah
allerdings eine andere Dimensionierung erfahren hat. Die gewaltsame „Reduk-
tion auf das nackt Kreatürliche“ (Werner 2000c: 85), wie sie, um nur ein Zeug-
nis anzuführen, etwa in Zeilen Wolf Rosenstocks zum Ausdruck kommt: „Exis-
tenz? Worin besteht sie eigentlich? Im Lechzen. Hier in der Wüste ist dieses
Wüstenwort Inbegriff all dessen geworden, was in uns noch von Seele geblie-
ben ist“ (Rosenstock, zit. n. Werner 2003c: 86), übernimmt das Gedicht als
Geste solchen Lechzens; seine „Aufmerksamkeit“ ist die Gebärde der elementar
bedrohten Kreatur: das Gedicht merkt auf, indem es „verhofft – ein auf die Kre-
atur zu beziehendes Wort“ (Celan 2000m: 197). Dichtung wird diesseits von
Bedeutung zu Gebärden-Sprache. Celan schreibt den Materialismus von Lenz
und Büchner als Insistenz auf dem Kreatürlichen unterhalb jeder Transforma-
tion, sei sie als Läuterung (christlich-)religiöser, als Aufhebung (idealistisch-)
dialektischer oder als Verwandlung (romantisch-)poetischer Natur, fort. Die in
den Gedichten Eine Gauner- und Ganovenweise und Einem, der vor der Tür
stand (Celan 2000d: 242f, 229f.) für den damit verbundenen Anspruch an die
Dichtung stehenden Ausdrücke des ,Krummnasigen‘ und ,Kielkröpfigen‘13 hat
Celan in Anmerkungen zur Meridian-Rede erläutert: „Wer nur der Mandeläu-
gig-Schönen die Träne nachzuweinen bereit ist, der tötet auch sie gräbt sie nur,
die Mandeläugig-Schöne, nur zum andern Mal tiefer ins Vergessen. – Erst wenn
du mit deinem allereigensten Schmerz zu den krummnasigen, bucklichten und
mauschelnden und kielkröpfigen Toten von Treblinka, Auschwitz und anders-
wo gehst, dann begegnest du auch dem Aug und seinem Eidos: der Mandel“
(Celan 1999: 128) – nicht als abwehrende Transformation des Nicht-Schönen,
sondern als annehmende „Ehrfurcht vor dem Geheimnis der krummnasigen
Natur“: „darum auch ist das Gedicht, von seinem Wesen und nicht erst von
seiner Thematik her – eine Schule wirklicher Menschlichkeit: es lehrt das An-
dere als das Andere d.h. sein Anderssein verstehen […]“ (Celan 1999: 104).14
Celans Texte überführen das Anderssein als die Wirklichkeit des Men-
schen in eine Fremdheit, der er in der Meridian-Rede über die materialistische
13 Vgl. auch Celans Widmung eines Sonderdrucks von Gespräch im Gebirg: „Für Peter Szondi,
/ herzlich und krummnasig, krummnasig und / herzlich / Paul Celan / Im September 1960.“
(Celan/Szondi 2005: 18)
14 Vgl. zu dieser Thematik ausführlich Perez (2010).
Schnittstelle Germanistik, Jahrgang 1 (2021), Ausgabe 1
© 2021 Universitätsverlag WINTER GmbH Heidelberg
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Sie können auch lesen