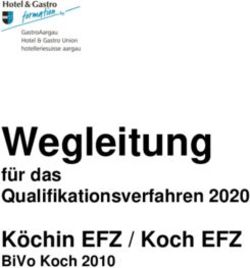Biologische Vielfalt im Garten - Das ehemalige Kapuzinerkloster in Laufen als Beispiel
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Stadtökologie
Abbildung 1
Bernhard Hoiẞ, Hannes Krauss und Peter Sturm Panorama-Bild der
Biologische Vielfalt im Garten
Gartenanlage des
Kapuzinerhofs in Laufen
(Foto: Hannes Krauss).
Das ehemalige Kapuzinerkloster in Laufen als Beispiel
2021 fanden wir mehrere besondere Arten in der rund 10.000 m² großen historischen
Gartenanlage des Kapuzinerhofs in Laufen. Der Klostergarten zeigt exemplarisch, welches
Potenzial für eine vielfältige Flora und Fauna in vielen Gärten steckt und wie dieses durch
gezielte Entwicklung verwirklicht werden kann. Wir stellen hier den Klostergarten und
seine Strukturen vor, wie die verschiedenen Magerrasentypen, eine Streuobstwiese,
Spalierobstreihen, einen Tümpel mit feuchter Hochstaudenflur und Kräuterbeete.
2001 fand die ANL im historischen Kapu Pappeln und Weiden leben. Die Blattkäfer dürf
zinerkloster in Laufen eine neue Heimat. ten sowohl im Garten als auch in den nahen
Damals wurde auch der etwa 10.000 m² Salzachauen ihr Auskommen finden. Die Falten
große Garten neu konzipiert. Ziel war unter wespe kommt natürlicherweise an warmen
anderem, möglichst vielen Arten hier eine Waldrändern oder in feuchten Tallagen (Fluss
Heimat zu bieten. tälern) vor und braucht lehmige Böden, um
Substrat für den Nestbau zu finden.
Besondere Artfunde im Klostergarten
Bereits 2002 – ein Jahr nach Eröffnung des Die Faltenwespe Symmorphus murarius wird
Kapuzinerhofs mit seiner Klostergartenanlage wiederum von mehreren Goldwespen parasi
als Fortbildungsstätte der ANL – sorgten die tiert, darunter die vom Aussterben gefährdete
Nachweise von Idas-Bläuling (Plebejus idas), Goldwespe Chrysis iris (Rote Liste Bayern 1/
Zwergbläuling sowie zwei weiterer Bläulings Deutschland 2; Mandery et al. 2003). Auch die
arten für die erste Überraschung. Die jüngsten se Art konnten wir an den Nisthilfen nachwei
Entdeckungen machten 2021 die Teilnehmen sen. Ein Hinweis darauf, dass von ihrem Wirt, der
den zweier Wildbienenkurse, als sie neben ins Faltenwespe, im Garten des Kapuzinerklosters
gesamt 17 Wildbienengattungen auch mehrere und dessen Umgebung eine relativ große Popu
gefährdete Hautflügler-Arten fanden. Auch eine lation existiert. In der Natur kommt die Art an
in Deutschland neue Art hat sich angesiedelt. Waldrändern und auf Lichtungen vor, sie wird
aber auch immer öfter in Gärten mit sonnen
Die Kontrolle von Schau-Nisthilfen sorgte für exponiertem Totholz nachgewiesen (Wiesbauer
eine kleine Sensation: Hier fanden die Teilneh et al. 2020). Der rund 2.600 m² umfassende
menden unter anderem die gefährdete Falten historische Baumbestand im Garten scheint
wespenart Symmorphus murarius (Rote Liste eine gute Grundlage für die aus mindestens
Bayern 2/Deutschland 2; Weber et al. 2003). Die vier Ebenen bestehende Nahrungskette zu
Weibchen dieser Falten-Wespen-Art hatten in sein (Laubbäume – [Pappel-]Blattkäfer –
ihren Nestern jede Menge Larven von Blattkä Symmorphus murarius – Chrysis iris).
fern eingetragen und kunstgerecht gestapelt.
Eine beliebte Blattkäferart ist wohl der Pappel Das kleine Wäldchen nutzen aber offensichtlich
blattkäfer (Chrysomela populi; Witt 2009), des nicht nur die Blattkäfer und die Faltenwespe
sen Larven wiederum von den Blättern von S. murarius. In einem Themenbeet fanden wir
ANLIEGEN NATUR 44(1), 2022 61Hoiẞ, Krauss & Sturm:
Stadtökologie Biologische Vielfalt im Garten
Das Garten-Konzept
Bei der Neukonzeption des Gartens wurden
bereits vorhandene Grundstrukturen des ehe
maligen Klostergartens erhalten und wiederher
gestellt, zugleich aber auch um neue Lebens
raumstrukturen ergänzt. Der Leitgedanke
war, dass die Artenvielfalt von Außenanlagen
umso größer ausfällt, je höher der Struktur
reichtum ist. Zudem sollte es Raum geben
für eine gewisse Dynamik, aber natürlich
auch für den Gastronomie-Betrieb.
Bei der Konzeption wurde besonders darauf
geachtet, dass der Garten ein kontinuierliches
Angebot für blütenbesuchende Insekten bietet:
- Die ersten Blütenwellen beginnen bereits
im Februar mit Schneeheide (Erica her
bacea), Nieswurz (Helleborus foetidus),
Abbildung 2 Schneeglöckchen (Galanthus nivalis),
Originalplan zur Neugestal- an einer offenen, kiesig-sandigen Stelle eine Hohler Lerchensporn (Corydalis cava),
tung des Klostergartens. kleine Nistkolonie der großen Harzbiene Krokus (Crocus vernus) und Bärlauch
Die im Artikel näher
(Trachusa byssina). Dort konnten wir die Tiere (Allium ursinum).
beschriebenen Bereiche
sind farblich markiert: beobachten, wie sie Harzklümpchen eintrugen,
die vermutlich an den Douglasien im Garten - Im Frühling bilden die Blüten von 36
a) Magerrasen-
gesammelt wurden. Das Harz wird – zusammen verschiedenen Obstgehölzen (alte Apfel-,
Beete
mit Blattstücken von einigen Laub-Gehölzen Birnen- und Zwetschgensorten mit jeweils
b) Wäldchen
– verwendet, um das Nest auszukleiden. Die unterschiedlicher Blüh- und Fruchtzeit) ein
c) Obstspalier
große Harzbiene braucht für ihren Nachwuchs erstes Optimum. Ergänzt wird dieses durch
d) Streuobstwiese
außerdem den Pollen von Schmetterlingsblüt die Vollblüte der Streuobstwiese und der
e) Extensivwiese lern, bevorzugt vom Horn-Klee (Lotus cornicu meisten Magerrasenflächen.
f) Teich latus; Westrich 2018), der in größeren Mengen
g) Hecke auf einer Freifläche zu finden ist. All diese - Im Früh- und Hochsommer blühen viele
h) Kräuterbeete und Bedürfnisse findet sie auf der überschaubaren Arten, wie hohe Königskerzen (Verbascum
Schotterrasen Fläche im Garten des Kapuzinerklosters erfüllt. spec.), Natternkopf (Echium vulgare) oder
i) Nisthilfen Nachtkerzen (Oenothera) in den Kräuter
Darüber hinaus wurden während der beiden beeten oder im Ruderalpflanzenbeet.
Kurse insgesamt sechs Individuen der für Gerade in dieser eher blütenarmen Zeit
Deutschland neuen Pelzbienen-Art (Anthopho ergänzen blühende Gehölz- und Stauden
ra crinipes) gefunden. Die Art braucht Trocken säume rund um die Süd- und Westseite
standorte mit vegetationsarmen Bodenstellen des Klosters das Blütenangebot. Hier fin
oder Erdabbrüchen als Nistplatz (Wiesbauer den sich hitzeresistente, wärmeliebende
2017). Der Fund war der zweite Nachweis Arten wie Herzgespann (Leonurus cardiaca),
dieser Pelzbienen-Art in Deutschland nach Zitronenduftendes Johanniskraut (Hype
dem Erstfund bei Passau (Hopfenmüller et ricum hircinum) mit sehr langer Blütezeit
al. 2021). Sie gehört wohl zu den Gewinnern und hohem Nektar- und Pollenangebot.
des Klimawandels.
- Im Herbst blühen Arten wie Ästige Gras
Mit dem Zwergbläuling (Cupido minimus) findet lilie (Anthericum ramosum), Berg-Aster
auch die kleinste Tagfalterart Bayerns ihr Aus (Aster amellus) oder die Bunte Kronwicke
kommen im Garten. Er wurde wahrscheinlich (Securigera varia).
mit in den Themenbeeten gepflanzten Exempla
ren seiner Raupenfutterpflanze, dem Wundklee Wichtige Elemente für einen hohen Struktur
(Anthyllis vulneraria), eingeschleppt. Der Zwerg reichtum im Garten sind:
bläuling ist im Alpenvorland eine sehr seltene
Art, kommt jedoch auch natürlich an wenigen a. Sechs 10 × 4 m große Themenbeete:
Stellen auf Hochwasserdämmen der Salzach vor. Darin wurden Sonderstandorte mit unter
62 ANLIEGEN NATUR 44(1), 2022Hoiẞ, Krauss & Sturm:
Biologische Vielfalt im Garten Stadtökologie
schiedlichen Vegetationstypen geschaffen. a b
Mit Kalkschotter aus den heimischen nörd
lichen Kalkalpen und Soden der entspre
chenden Vegetation wurde ein alpines Beet
angelegt. Daneben konnte mit Granitschot
ter und Vegetationssoden aus dem Bayeri
schen Wald ein Themenbeet aus Urgestein
mit saurem Standort erstellt werden. In drei
weiteren Beeten wurden mit Hilfe nährstoff
c d
armer Bodensubstrate die Themen Saum
standort, Halbtrockenrasen und Magerwiese
umgesetzt. Das sechste Themenbeet hatte
Kiesbänke der Salzach zum Vorbild. Es wur
de mit Findlingen aus Nagelfluh und Salz
achkies gestaltet und mit Sträuchern und
ausgewählten Stauden ruderal bepflanzt.
b. Ein historisches Wäldchen mit rund 2.600 m² e f
Größe: Der Baumbestand hat sich über die
Jahrhunderte im Zuge der Pflege durch
die Mönche permanent gewandelt. Aktuell
besteht er vor allem aus Rotbuche, Ahorn,
Robinie, Eibe und Douglasie. Die meisten
Eschen mussten aufgrund des Eschentrieb
sterbens und der damit einhergehenden
Unfallgefahr entfernt werden.
g h+i
c. Historische Obstspalier-Laubengänge:
Lückige Stellen werden mit alten Obst
sorten ergänzt. Alte abgestorbene Äste
und Bäume im Spalier bleiben als Lebens
raum so lange wie möglich erhalten.
d. Eine Streuobstwiese: Die Wiese unter den
Obstbäumen wurde als extensiv genutzte
Flachland-Mähwiese mit zweimaliger Mahd g. Eine Hecke mit heimischen, standortgerech Abbildung 3
Die wichtigsten Strukturen im
angelegt. Die zweite Blütenwelle kann ten Gehölzen, die das Lebensraummosaik
Garten des Kapuzinerhofes
damit gezielt in die Sommermonate verlegt vervollständigt. Aufgrund des Grundstück auf einen Blick:
werden. Hier haben sich unter anderem die zuschnitts musste sie im Schatten ange a) Magerrasen-Beete
Knautie sowie die spezialisierte Knautien- legt werden und ist daher vergleichsweise
b) Wäldchen
Sandbiene (Andrena hattorfiana) etabliert. artenarm.
c) Obstspalier
d) Streuobstwiese
e. Eine zentral liegende, extensiv genutzte h. Neue Kräuterbeete als wichtiges Bindeglied
e) Extensivwiese
Wiesenfläche: Sie wird 2 Mal jährlich gemäht zur historischen Nutzung. Neben einer gro
und wurde inzwischen seit gut 20 Jahren ßen Palette an mediterranen Kräutern wie f) Teich
nicht mehr gedüngt. Dadurch entwickel Salbei, Berg-Bohnenkraut oder Weinraute g) Hecke
te sich eine lückige Vegetationsstruktur – sind auch hohe Doldenblütler wie Garten- h) + i) Kräuterbeete mit
gute Nistgelegenheiten für bodennistende Fenchel (Raupenfutterpflanzen für die hier Schotterrasen
und Nisthilfen
Insekten. regelmäßig zu beobachtenden Schwalben
(Fotos: Hannes Krauss).
schwanzraupen, Nektarpflanze für viele
f. Ein großzügiger Teich mit Verlandungs [Schweb-] Fliegen, Käfer und Feldwespen)
zonen und angrenzenden Feuchtflächen oder Berg-Laserkraut vertreten. Besonders
mit durchaus sehenswerten Beständen von gut lassen sich an hohen Lippenblütlern
Fieberklee und Schlangenknöterich. Im wie Herzgespann die auffällig gefärbten
Anschluss wurden größere Bestände von Männchen der Garten-Wollbienen beob
feuchten Hochstaudenfluren mit Mädesüß achten, wenn sie über ihr Blüten-Revier
und Wasserdost etabliert. patrouillieren.
ANLIEGEN NATUR 44(1), 2022 63Hoiẞ, Krauss & Sturm:
Stadtökologie Biologische Vielfalt im Garten
i. Nisthilfen für Hymenopteren. Diese Kleinstruk Fazit
turen wurden im Laufe der Jahre an der Südsei Gut 20 Jahre nach der Neugestaltung des
te eines historischen Gartenhäuschens ange Gartens im Kapuzinerkloster haben sich auf
bracht. Zu den einfachen Baumscheiben kamen kleiner Fläche viele Arten mit lebensfähigen
verschiedene Schaunisthilfen dazu, die in Kur Populationen angesiedelt. Eine wichtige Rolle
sen einfach gezeigt werden können. Durch die spielt dabei sicher die enge Verzahnung von
lange Verfügbarkeit sind sie sehr gut besiedelt. arten- und blütenreichen Wald- und Offenland
lebensräumen inklusive Rohbodenstandorte.
Pflege Wichtig sind auch verschiedene Blütenformen
Die Außenanlagen werden vor allem per Hand (Scheibenblüten, stark nektarbildende Blüten,
arbeit gepflegt. Die Wiesenflächen werden ma lange Blütenröhren und so weiter), die über
ximal ein- oder zweimal pro Jahr per Balken einen möglichst langen Zeitraum verfügbar
mäher gemäht, die Themenbeete werden sehr sind, um ein großes Spektrum an Bestäubern
spät und nur einmalig im Jahr mit der Sense ge anzusprechen. Ebenso wichtig sind Überwinte
schnitten, um sicherzustellen, dass die Blüten rungsplätze für viele Tiere. Dazu braucht es
pflanzen aussamen können. Angeflogener Ge „wilde Ecken“. Viele heimische Pflanzenarten
hölzaufwuchs wird entfernt, um die angestrebte bieten zur richtigen Jahreszeit für viele Tierar
Vegetation zu erhalten und die gewünschten ten die nötigen Ressourcen. In diesem Sinne
Rohbodenstandorte offen zu halten. Viel Zeit kann der Klostergarten sicher als Anschauungs
fließt in den fachgerechten Obstbaumschnitt beispiel und Referenz für andere Grünanlagen
von Spaliergängen und Streuobstbestand. Der dienen. Er kann ganzjährig kostenfrei besichtigt
Baumbestand wird regelmäßig von Baumgut werden.
achtern besichtigt und nach Bedarf beschnitten.
Totholz wird – wann immer möglich – belassen Literatur
und nur bei objektiver Gefahr entfernt. Hopfenmüller, S., Hoiẞ, B., Neumayer, J. et al. (2021):
Zweitnachweis von Anthophora crinipes
Smith, 1854 für Deutschland (Hymenoptera,
Anthophila). – Nachrichtenblatt der Bayerischen
Autoren Entomologen 70(3): 128–131.
Mandery, K., Bausenwein, D., Voith, J. et al. (2003):
Dr. Bernhard Hoiß, Rote Liste gefährdeter Goldwespen
Jahrgang 1981. (Hymenoptera: Chrysididae) Bayerns.
Studium der Biologie in Regensburg. Nach Weber, K., Voith, J., Mandery, K. et al. (2003):
Rote Liste gefährdeter Faltenwespen
kurzer Zeit in einem Planungsbüro Promo
(Hymenoptera: Vespidae) Bayerns.
tion und wissenschaftlicher Mitarbeiter
an den Universitäten Bayreuth und Würz Westrich, P. (2018): Die Wildbienen Deutschlands. –
burg zu Pflanzen-Bestäuber-Interaktionen. First Edition, Eugen Ulmer Verlag, Stuttgart: 821 S.
Anschließend Biodiversitätsbeauftragter an Wiesbauer, H. (2017): Wilde Bienen: Biologie – Lebens
der Regierung von Schwaben. Seit 2016 an raumdynamik am Beispiel Österreich – Artenport
der ANL mit den Schwerpunkten Biodiversität räts. – First Edition, Eugen Ulmer Verlag, Stuttgart:
376 S.
und Öffentlichkeitsarbeit.
Wiesbauer, H., Rosa, P. & Zettel, H. (2020): Die Gold
Bayerische Akademie für Naturschutz wespen Mitteleuropas – Biologie – Lebensräume –
Artenportäts. – First Edition, Eugen Ulmer Verlag,
und Landschaftspflege (ANL)
Stuttgart.
+49 8682 8963-53
bernhard.hoiss@anl.bayern.de Witt, R. (2009): Wespen. – Second Edition, Oldenburg,
Vademecum Verlag.
Hannes Krauss,
Jahrgang 1972.
+49 8682 8963-58
hannes.krauss@anl.bayern.de Zitiervorschlag
Hoiẞ, B., Krauss, H. & Sturm, P. (2022):
Peter Sturm, Biologische Vielfalt im Garten – Das ehemalige
Jahrgang 1957. Kapuzinerkloster in Laufen als Beispiel. –
+49 8682 8963-56 ANLiegen Natur 44(1): 61–64, Laufen;
peter.sturm@anl.bayern.de www.anl.bayern.de/publikationen.
64 ANLIEGEN NATUR 44(1), 2022Sie können auch lesen