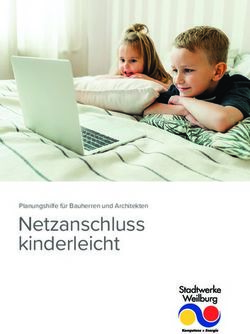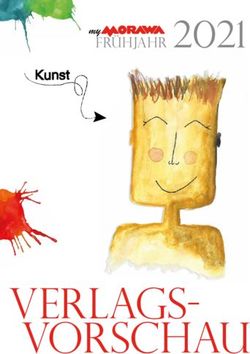Crashkurs im Arbeitsrecht Sommersemester 2020 - Gliederung und Fälle 20.07.- 23.07.2020 - Universität ...
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Prof. Dr. Stephan Weth
Universität des Saarlandes
Crashkurs im Arbeitsrecht
Sommersemester 2020
20.07.- 23.07.2020
jeweils 10.00-13.00 und 14.00-17.00 Uhr
Gliederung und FälleCrashkurs im Arbeitsrecht Sommersemester 2020
Gliederung
A. Individualarbeitsrecht
I. Das Arbeitsverhältnis
Fall 1: Feststellung der Arbeitnehmereigenschaft
Fall 1a: Der Null-Stunden-Vertrag
(BAG, Urt. v. 15.02.2012, NZA 2012, 733 ff.)
Fall 2: derzeit unbesetzt
II. Begründung des Arbeitsverhältnisses
1. Abschlussfreiheit
Fall 3: Die „Mode für Gruftis GmbH“
2. Form
Fall 4: Doppelte Schriftformklausel
(BAG, Urt. v. 20.05.2008, NZA 2008, 1233 ff.)
3. Willenserklärung beschränkt Geschäftsfähiger
Fall 5: „Markus losgelassen“
4. Gleichbehandlung
Fall 6: Entschädigung wegen geschlechtsbezogener Diskriminierung
(BAG, Urt. v. 05.02.2004, NZA 2004, 540 ff.)
Fall 6a: Auskunftsanspruch eines abgelehnten Bewerbers
(BAG, Urt. v. 25.04.2013, NJOZ 2013, 1699 ff.)
5. Mängel des Arbeitsverhältnisses
Fall 7: Falsch gefragt
Fall 7a: Der nichtmehr vorbestrafte Arbeitnehmer
(BAG, Urt. v. 20.03.2014, NZA 2014, 1131- 1136)
Fall 8: Arzt ohne Approbation
(BAG, Urt. v. 03.11.2004, NZA 2005, 1409 ff.)
III. Inhaltskontrolle von Arbeitsverträgen
Fall 9: Wirksamkeit von Widerrufsvorbehalten in Formulararbeitsverträgen
(BAG, Urt. v. 12.01.2005 – 5 AZR 364/04, NJW 2005, 1820 ff.,
auch: BAG, Urt. v. 01.03.2006, 5 AZR 511/05)
Fall 10: Freiwilligkeitsvorbehalt bei Weihnachtsgeld
2Crashkurs im Arbeitsrecht Sommersemester 2020
Fall 11: Zulässigkeit einer Vertragsstrafenabrede in einem
Formulararbeitsvertrag
(BAG, Urt. v. 04.03.2004, NZA 2004, 727 ff.)
Fall 12: Zweistufige Ausschlussfrist in AGB
(BAG, Urt. v. 19.03.2008, NZA 2008, 757 ff.)
Fall 12a: Rückzahlung von Fortbildungskosten
IV. Pflichten aus dem Arbeitsverhältnis
1. Pflichten des Arbeitnehmers
a) Zeit der Arbeitsleistung
Fall 13: Geänderte Arbeitszeiten
Fall 14: Bestimmung der Lage der Arbeitszeit durch den Arbeitgeber
(BAG, Urt. v. 23.09.2004, NZA 2005, 359 ff.)
Fall 15: Arbeit auf Abruf – Inhaltskontrolle von AGB
(BAG, Urt. v. 07.12.2005, NZA 2006, 423 ff.)
Fall 15a: Arbeitszeit der Werksfeuerwehr
(BAG, Urt. v. 23.06.2010, 10 AZR 543/09, BB 2011, 506 ff.)
Fall 15b: Die jederzeitige Erreichbarkeit des Arbeitnehmers
b) Ort der Arbeitsleistung
c) Direktionsrecht
Fall 16: Arbeitspflicht einer Schauspielerin
(BAG, Urt. v. 13.06.2007 – 5 AZR 564/06, NJW 2008, 780)
Fall 16a: Unwirksame Weisung
(BAG, Beschl. v. 14.09.2017 – 5 AS 7/17 – NZA 2017, 1452; BAG, Urt. v.
22.02.2012 – 5 AZR 249/11, NZA 2012, 858-86)
2. Pflichten des Arbeitgebers
a) Lohnzahlungspflicht – Gleichbehandlung – Gratifikation
Fall 17: Sittenwidriges Arbeitsentgelt
(BAG, Urt. v. 27.06.2012, 5 AZR 496/11; BAG, Urt. v. 22.04.2009, 5 AZR
436/08, NZA 2009, 837)
Fall 18: Weihnachtsgeld und Elternzeit
Fall 18a: Betriebliche Übung: Raucherpause
(LAG Nürnberg, Urt. v. 05.08.2015, 2 Sa 132/15)
b) Tarifliche Lohnzahlung
Fall 19: Der renitente Albert
c) Mindestlohn
Fall 19a: Sonderzahlungen und Mindestlohn
(BAG, Urt. v. 25.05.2016, 5 AZR 135/16; LArbG Berlin-Brandenburg, Urt. v.
12.01.2016, 19 Sa 1851/15, NZA-RR 2016, 237)
d) Sicherung und Verfall des Lohnanspruchs
Fall 20: Der arme Hannibal
3Crashkurs im Arbeitsrecht Sommersemester 2020
Fall 21: Kostenlast bei Lohnpfändungen
(BAG Urt. v. 18.07.2006, 1 AZR 578/05, NZA 2007, 462)
Fall 22: Verwirkung des Anspruchs auf übertarifliche Zulage bei Untätigkeit
des Arbeitnehmers
(BAG, Urt. v. 14.02.2007, 10 AZR 35/06, NZA 2007, 690)
e) Lohn ohne Arbeit
aa) Vorübergehende Verhinderung § 616 BGB
Fall 23: Und er spuckt immer noch
bb) Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall
Fall 24: Der Beinbruch
cc) Lohnnachzahlung
Fall 24a: Nachzahlung des Lohns bei unwirksamer Kündigung
(BAG, Urt. v. 09.04.2014, NZA 2014, 719)
f) Verringerung der Arbeitszeit
Fall 25: Antrag auf befristete Verringerung der Arbeitszeit
(BAG, Urt. v. 12.09.2006, NZA 2007, 253-255)
V. Leistungsstörungen im Arbeitsverhältnis
1. Pflichtverletzung des Arbeitnehmers
Fall 26: Die anstrengende Feier
2. Pflichtverletzung durch den Arbeitgeber
a) Nichterfüllung der Lohnzahlungspflicht
Fall 27: Der einbehaltene Lohn
Fall 27a: – Verzugskostenpauschale
(angelehnt an BAG, Urt. v. 25.09.2018 – 8 AZR 26/18, NZA 2019, 121ff.)
b) Annahmeverzug
Fall 28: So ein Pech!
Fall 28a: Nachtdienstuntauglichkeit
Fall 29: Anrechnung von unterlassenem Erwerb
Fall 29a: Annahmeverzug und Streik
(BAG, Urt. v. 17.07.2012, NJW 2012, 3676-3677)
Fall 29b: Annahmeverzug bei rückwirkend begründetem Arbeitsverhältnis
(BAG, Urt. v. 27.01.2016, 5 AZR 9/15, NZA 2016, 691)
c) Zurückbehaltungsrecht
Fall 29c: Ohne Moos nix los!
d) Mobbing
Fall 29d: Der gemobbte Arbeitnehmer
(BAG, Urt. v. 24.04.2008, NJW 2009, 251-255)
4Crashkurs im Arbeitsrecht Sommersemester 2020
VI. Haftung des Arbeitnehmers
1. Mankohaftung (Fall 30)
2. Haftung für Sach- und Personenschäden an Dritten
Fall 31: Die Haftung des Arbeitnehmers für Sach- und Personenschäden
an Dritten
3. Haftung für Beschädigung von Arbeitgebereigentum
Fall 31a: Verdammte Technik
(BAG, Urt. v. 28.10.2010, 8 AZR 418/09, NZA 2011, 345-349)
4. Haftung gegenüber anderen Arbeitnehmern
Fall 31 b: Der Gabelstaplerzwick
(LArbG Schleswig-Holstein, Urt. v. 26.04.2016, 1 Sa 247/15)
VII. Beendigung des Arbeitsverhältnisses
1. Zeitablauf
Fall 32: Der befristete Arbeitsvertrag
Fall 32a: Sachgrund oder nicht Sachgrund - das ist hier die Frage
(BAG, Urt. v. 29.06.2011, 7 AZR 774/09, NZA 2011, 1151 - 1155)
Fall 32b: Immer diese Befristungen
(BAG, Urt. v. 29.06.2011, 7 AZR 6/10, NZA 2011, 1346-1350.)
Fall 32c: Liebesschwank-Tournee-Theater
Fall 32d: Missbrauchskontrolle bei Vertretungsbefristung
(BAG, Urt. v. 18.07.2012, 7 AZR 443/09, NZA 2012, 1351)
Fall 33: Schriftformerfordernis bei Befristung eines Arbeitsvertrags
(BAG, Urt. v. 16.04.2008, 7 AZR 1048/06, BB 2008, 1959)
Fall 33a: Auslegung einer Befristungsabrede - Schriftform
(BAG, Urt. v. 14.14.2016, 7 AZR 797/14, NZA 2017, 638 -643)
Fall 34: Wiedereinstellungsanspruch nach Befristung
(BAG, Urt. v. 20.02.2002, 7 AZR 600/00, NJW 2002, 2660)
Fall 35: Wirksamkeit einer einseitigen Verlängerungsoption in einem
Fußballprofivertrag
(ArbG Nürnberg, Urt. v. 04.06.2007, 3 Ga 32/07, SpuRt 2007, 213-215)
Fall 35a: Aufhebungsvereinbarung im Profifußball
(BAG, Urt. v. 25.04.2013, 8 AZR 453/12, NZA 2013, 1206)
Fall 35b: Befristung Profifußball
(BAG, Urt. v. 16.01.2018 – 7 AZR 312/16, NZA 2018, 703)
2. Kündigung
a) Die Kündigung
aa) Kündigungserklärung
Fall 36: „Gut gesprochen“
Fall 37: derzeit unbesetzt
5Crashkurs im Arbeitsrecht Sommersemester 2020
Fall 38: Kündigung versehentlich weggeworfen - Nachträgliche Zulassung
der Kündigungsschutzklage?
(Beschl. d. LAG Mainz; 11 Ta 217/06)
Fall 39: Schriftform der Kündigungserklärung
(BAG, Urt. v. 16.09.2004, NZA 2005, 162 ff.)
Fall 40: derzeit unbesetzt
Fall 40a: Ohne Vertretungsmacht erklärte Kündigung
bb) Kündigungsgrund
Fall 41: Kündigungsgründe
cc) Anwendbarkeit des Kündigungsschutzgesetzes
Fall 42: Die verflixte Wartezeit
(LAG Köln, Urt. v. 15.12.2006, 9 Ta 467/06, NZA-RR 2007, 293)
Fall 42a: Privathaushalt als Betrieb
(LAG Düsseldorf, Urt. v. 10.05.2016, 14 Sa 82/16)
b) Die Personenbedingte Kündigung
Fall 43: Alkoholprobleme
(BAG, Urt. v. 20.03.2014, 2 AZR 565/12, NZA 2014, 602-606)
Fall 44: Krankheitsbedingte Kündigung
(BAG, Urt. v. 29.04.1999 – 2 AZR 431/98, NZA 1999, 978 ff.; BAG Urt. v.
12.04.2002 – 2 AZR 148/01, NJW 2002, 3271)
Fall 45: derzeit unbesetzt
c) Die Betriebsbedingte Kündigung
Fall 46: derzeit unbesetzt
Fall 46 a: Anwendbarkeit des AGG bei betriebsbedingter Kündigung
Fall 47: derzeit unbesetzt
Fall 48: derzeit unbesetzt
Fall 49: Der Domino-Effekt
(BAG, Urt. v. 09.11.2006, BB 2007, 1393ff.)
Fall 50: Bildung von Altersstufen bei der Sozialauswahl
(BAG, Urt. v. 06.09.2007, 2 AZR 387/06, NZA 2008, 405-407)
Fall 51: Unerwartete Kündigung
Fall 52: derzeit unbesetzt
d) Die Verhaltensbedingte Kündigung
Fall 53: Das Kopftuch
Fall 54: derzeit unbesetzt
Fall 55: „whistle – blower“
(BAG, Urt. v. 03.07.2003, NZA 2004, 427 ff.)
Fall 56: derzeit unbesetzt
e) Die Abmahnung (Fall 57)
Fall 58: Abmahnung wegen Minderleistung
f) Die Änderungskündigung
Fall 59: Die Änderungskündigung
Fall 60: derzeit unbesetzt
Fall 61: Vorrang der Änderungskündigung vor einer Beendigungskündigung
6Crashkurs im Arbeitsrecht Sommersemester 2020
(BAG, Urt. v. 12.04.2005, NZA 2005, 1289 ff.)
Abwandlung: Ausnahme vom Vorrang der Änderungskündigung vor der
Beendigungskündigung in „Extremfällen“
(BAG Urt. v. 21.09.06, 2 AZR 607/05, NJW-Spezial 2007,274-275)
Fall 62: derzeit unbesetzt
g) Die Außerordentliche Kündigung
Fall 63: Außerordentliche Kündigung bei Androhung einer Erkrankung bei
Nichtgewährung von Urlaub
(BAG, Urt. v. 17.06.2003, NZA 2004, 564 ff.)
Fall 63a: Außerordentliche Kündigung aufgrund mehrerer Arbeitsverhältnisse
(BAG Urt. v. 05.11.2009, 2 AZR 609/08, NJW 2010, 955)
Fall 64: Kündigung eines LKW-Fahrers wegen Drogenkonsums
(BAG Urt. v. 20.10.2016 – 6 AZR 471/15, NZA 2016, 1527 ff.)
Fall 64a: Kündigung nach Beleidigung des Arbeitgebers durch Betätigung des
„gefällt-mir-Buttons“ bei Facebook
(ArbG Dessau-Roßlau, Urt. v. 21.03.2012, 1 Ca 148/11)
h) Die Verdachtskündigung
Fall 65: Abgrenzung Tatkündigung zur Verdachtskündigung,
Beweisverwertungsverbot
Fall 66 - 77: derzeit unbesetzt
3. Die Beendigungsvereinbarung
Fall 78: Anfechtung und Widerruf einer Beendigungsvereinbarung
(BAG, Urt. v. 27.11.2003, NZA 2004, 597 ff.)
Fall 78a: Abwicklungsvertrag und vorzeitiges Ausscheiden
(BAG, Urt. v. 17.12.2015, 6 AZR 709/14, NJW 2016, 2138 ff.)
4. Pflichten anlässlich der Beendigung des Arbeitsverhältnisses
Fall 79: Das qualifizierte Zeugnis
(BAG, Urt. v. 14.10.2003, DB 2004, 1270 ff.)
Fall 79a: Urlaubsabgeltung
(BAG, Urt. v. 20.10.2015, 9 AZR 224/14, NJW 2016, 587)
5. Der Streitgegenstandbegriff der Kündigungsschutzklage
Fall 79b: Streitgegenstandsbegriff
VIII. Besondere Arbeitsverhältnisse
1. Der Übergang der Arbeitsverhältnisse auf den Betriebsnachfolger
Fall 80: Lilly’s Brautmoden
Fall 80a: Karla Koch vs. Bestspeis GmbH
2. Das Gruppenarbeitsverhältnis
Fall 81: Das verdächtige Heimleiterehepaar
7Crashkurs im Arbeitsrecht Sommersemester 2020
B. Kollektives Arbeitsrecht
I. Tarifrecht
1. Abschluss von Tarifverträgen
Fall 81a: Stellvertretung bei Abschluss des Tarifvertrages
(BAG Urt. v. 12.12.2007, 4 AZR 996/06, NZA 2008, 892 ff.)
2. Wirkungen von tariflichen Normen
a) Adressat der normativen Wirkung
Fall 82: Der verflixte Firmentarifvertrag
b) Verweisungsklauseln
Fall 83: arbeitsvertragliche dynamische Verweisung auf Tarifvertrag
(BAG, Urt. v. 18.04.2007, 4 AZR 653/05)
c) Das Günstigkeitsprinzip (Fall 84)
d) Nachwirkung
Fall 85: Tarifgebundenheit
e) Verbandsaustritt
Fall 86: Rechtsfolgen des Verbandsaustritts
Fall 87:Austritt aus Arbeitgeberverband, Nachbindung an einen Tarifvertrag,
Ablösung eines nachwirkenden Tarifvertrags, andere Abmachung i.S.d. § 4
Abs. 5 TVG
(BAG, Urt. v. 01.07.2009, 4 AZR 250/08, NZA-RR 2010, 30 ff.)
f) Tariffähigkeit
Fall 88: Rückwirkende Unwirksamkeit von Tarifverträgen bei fehlender
Tariffähigkeit der tarifschließenden Gewerkschaft
(BAG, Urt. v. 15.11.2006, 10 AZR 665/05, NZA 2007, 448.)
3. Differenzierungsklauseln
Fall 89: Zulässigkeit einfacher Differenzierungsklauseln
(BAG, Urt. v. 18.03.2009, 4 AZR 64/08, NZA 2009, 1228 ff.)
4. Die Burda-Entscheidung (Fall 90)
5. Grundrechtsbindung der Tarifvertragsparteien (Fall 91)
Fall 92: Negative Koalitionsfreiheit – Drittwirkung eines Grundrechts
(BAG, Beschl. v. 19.09.2006, NJW 2007, 622-623)
6. Gewerkschaftliche Mitgliederwerbung (Fall 93)
7. Tarifpluralität und Tarifeinheit
Fall 94: Das Tarifeinheitsgesetz
8Crashkurs im Arbeitsrecht Sommersemester 2020
8. Mindestlohn
Fall 95: Postmindestlohn
(OVG Berlin-Brandenburg, Urt. v. 18.12.2008)
9. Rückwirkung von Tarifverträgen
Fall 95a: Wer hätte das geahnt…
(BAG, Urt. v. 11.10.2006, 4 AZR 485/05, BAGE 119, 375)
Fall 95b: Altersdiskriminierung im Tarifvertrag (EuGH, Urt. v. 08.09.2011 –
C-297/10 [Sabine Hennigs/Eisenbahnbundesamt], C-298/10 [Land
Berlin/Alexander Mai]; BAG, Urt. v. 20.03.2012, 9 AZR 529/10, NZA 2012,
803-808.
Fall 95c: Benachteiligungsverbot wegen des Alters
(BAG, Urt. v. 14.05.2013 – 1 AZR 43/12, NZA 2013, 1160-1162)
9Crashkurs im Arbeitsrecht Sommersemester 2020
II. Arbeitskampfrecht
1. Rechtmäßigkeit von Arbeitskämpfen
a) Voraussetzungen eines rechtmäßigen Streiks
Fall 96: Rechtmäßig oder nicht?
Fall 96a: Streikteilnahme eines Betriebsratsmitglieds
Fall 96b: Streikmobilisierung auf Firmenparkplatz
(BAG, Urt. v. 20.11.2018 – 1 AZR 189/17, NZA 2019, 402-407)
Fall 97: Streik um Firmentarifvertrag gegen verbandsangehörigen Arbeitgeber
(BAG, Urt. v. 10.12.2002, BB 2003, 1125 ff.)
Fall 97a: Arbeitskampf und Tarifeinheit
b) Zulässiges Kampfziel
Fall 98: Rechtmäßigkeit eines Unterstützungsstreiks
(BAG, Urt. v. 19.06.2007, 1 AZR 396/06, NZA 2007, 1055)
2. Folgen von Arbeitskämpfen
a) Auswirkungen auf den eigenen Arbeitgeber (Fall 99)
b) Aussperrung (Fall 100)
c) Arbeitskampfrisikolehre (Fall 100a)
III. Betriebsverfassungsrecht
1. Die Betriebsvereinbarung (Fall 101)
Fall 102: Tarifvorbehalt und Betriebsvereinbarung
2. Betriebsratswahl (Fall 103)
3. Ladung zur Betriebsratssitzung ohne Tagesordnung (Fall 103a)
4. Mitbestimmungsrechte des Betriebsrates
Fall 104: Versetzung und Beteiligung des Betriebsrates
Fall 104a: Mitbestimmung des Betriebsrates bei Kleidungs- und
Verhaltensvorschriften
5. Unterlassungsanspruch des Betriebsrates (Fall 105)
6. Abmahnung Betriebsrat (Fall 105a)
(BAG, Beschl. v. 09.09.2015, 7 ABR 69/13, NZA 2016, 57)
7. Geschäftsführung des Betriebsrates
Fall 106: Der teure Betriebsrat
Fall 107: Das verflixte Weihnachtsgeld
(BAG, Urt. v. 05.08.2009 – 10 AZR 483/08, NZA 2009, 1105-1107)
Fall 107a: Schulungskosten Betriebsrat
10Crashkurs im Arbeitsrecht Sommersemester 2020
Fälle
Fall 4: Doppelte Schriftformklausel
(BAG, Urt. v. 20.05.2008 – 9 AZR 382/07 – NZA 2008, 1233 ff.)
Der Kläger war vom 02.05.2002 bis zum 31.06.2006 für die Beklagte als Büroleiter im
Ausland mit dortigem Wohnsitz beschäftigt. Die Beklagte erstattete ihm und den anderen dort
beschäftigten Mitarbeitern die Mietkosten. Im schriftlichen Arbeitsvertrag findet sich zur
Mietkostenerstattung nichts. Ab August 2005 verweigerte sie dem Kläger die Fortsetzung
dieser Übung unter Berufung auf die im Arbeitsvertrag enthaltene Schriftformklausel. Nach
dem Formulararbeitsvertrag bedürfen Änderungen und Ergänzungen des Vertrages sowie der
Verzicht auf das Schriftformerfordernis der Schriftform. Wörtlich heißt es in dem Vertrag:
„Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages sind, auch wenn sie bereits mündlich
getroffen wurden, nur wirksam, wenn sie schriftlich festgelegt und von beiden Parteien
unterzeichnet worden sind. Dies gilt auch für den Verzicht auf das
Schriftformerfordernis.“
Der Kläger begehrt die Fortsetzung der Mieterstattung. Insoweit ist er der Auffassung, die
Vereinbarung über die Mieterstattung habe Vorrang gegenüber der Klausel aus dem
Arbeitsvertrag.
Fall 6: Entschädigung wegen geschlechtsbezogener Diskriminierung bei Einstellung
(BAG, Urt. v. 5.2.2004, NZA 2004, 540 → Rspr. zu § 611a BGB a.F., gilt aber sinngemäß
auch nach Einführung des AGG)
▪ Der Beklagte (B) betreibt eine Rechtsanwaltskanzlei
▪ mit Schreiben vom 15.3.2007 bewarb sich der Kläger (K), der zwei juristische
Staatsexamen in Bayern abgelegt hat, auf eine Stellenausschreibung
Beschreibung Volljuristin bzw. Anwältin zur Einarbeitung.
Sicheres Auftreten, vorwiegend zivilrechtlicher Bereich,
Unfallregulierung, Mietrecht, einfache zivilrechtliche
Streitigkeiten, Textverarbeitung, auch Wiedereinsteigerin
Betriebsart Rechtsanwälte - Steuerberater
Arbeitsort R
Arbeitszeit Teilzeit
Gehalt/Lohn nach Vereinbarung
Frei ab sofort
Befristet nein
Führerschein
Alter gleich
Stellenzahl 1
▪ Mit Schreiben vom 25.3.2007 teilte B dem K auf seine Bewerbung mit, dass die Stelle
als Volljuristin durch jemand anderen besetzt worden sei
11Crashkurs im Arbeitsrecht Sommersemester 2020
▪ Es sei eine Anwältin eingestellt worden, die in beiden juristischen Staatsprüfungen
bessere Ergebnisse als K erzielt habe. Letzteres ist unstreitig.
▪ K verlangt nunmehr von B Schadensersatz wegen einer Geschlechtsdiskriminierung in
Höhe von 4.601,63 Euro
▪ Dazu führt er aus: aus der Stellenausschreibung im Internet und dem
Ablehnungsschreiben ergebe sich die Vermutung, dass B ausschließlich eine
Mitarbeiterin gesucht habe und seine Bewerbung aus diesem Grunde abgelehnt worden
sei; die Ausschreibung sei auch von B selbst und nicht vom Arbeitsamt verfasst
worden, aufgrund der detaillierten Beschreibung der Stelle müsse nämlich
angenommen werden, dass der Sachbearbeiter des Arbeitsamtes die genannten
Kriterien von den Beklagten übernommen habe; zudem müsse berücksichtigt werden,
dass in der Kanzlei nur Mitarbeiterinnen beschäftigt seien; von einer Entscheidung über
die Stellenbesetzung auf Grund der Examensnoten, sicherem Auftreten,
Textverarbeitungskenntnissen, Promotionsabsicht oder der bayerischen Herkunft dürfe
nicht ausgegangen werden, denn diese Kriterien seien in der Ausschreibung nicht
genannt worden
▪ B wendet dagegen ein: das Geschlecht des Bewerbers habe bei der Einstellung keine
Rolle gespielt; dies ergebe sich daraus, dass die Kanzlei weitere Männer beschäftige
bzw. beschäftigt habe, so bestehe eine Zusammenarbeit mit einem männlichen
Rechtsanwalt in Salzburg. Auch sei einmal ein Rechtsanwalt zur Probe eingestellt
gewesen und aus anderen Gründen wieder ausgeschieden. Im Übrigen sei er für die
Formulierung der Ausschreibung des Arbeitsamtes im Internet trotz der detaillierten
Angaben der Anzeige nicht verantwortlich. Das Arbeitsamt sei nicht beauftragt worden,
ausschließlich eine Volljuristin zu suchen. Das ergebe sich auch aus einem späteren
Schreiben an das Arbeitsamt. Auswahlkriterium sei in erster Linie die sich aus den
Examensnoten ergebende bessere Qualifikation gewesen. Die Bezeichnung des Klägers
als Volljuristin im Ablehnungsschreiben vom 25. März 2007 beruhe auf einem
Schreibversehen einer Bürokraft.
▪ Hat K gegen B auf Grundlage des AGGs einen Anspruch auf Zahlung der 4.601,63
Euro?
Fall 9: Wirksamkeit von Widerrufsvorbehalten in Formulararbeitsverträgen
(nach BAG, Urt. v. 12.01.2005 – 5 AZR 364/04 – NJW 2005, 1820; auch: BAG Urt. v.
01.03.2006, 5 AZR 363/05; BAG Urt. v. 11.02.2009 – 10 AZR 222/08; BAG Urt. v.
20.04.2011 – 5 AZR 191/10)
▪ Der Kläger (K) ist bei der Beklagten (B) als Elektroinstallateur beschäftigt
▪ Seinem Arbeitsvertrag liegt ein von B standardmäßig verwendetes Vertragsformular
zugrunde
▪ Danach richtet sich das Arbeitsverhältnis nach den für die Arbeiter der Eisen-, Metall-
und Elektroindustrie Nordrhein-Westfalens geltenden tariflichen Bestimmungen
▪ § 2 des Arbeitsvertrages lautet u.a.:
▪ Entsprechend seiner Tätigkeit wird der Arbeitnehmer in die
Lohngruppe 7/NRW eingestuft. Als Arbeitsentgelt erhält er einen festen
Monatslohn von € 1.751,69 € sowie eine außertarifliche Zulage von
€ 227,72.
▪ ...
▪ Die Firma behält sich vor, alle übertariflichen Bestandteile in seinem
Lohn - gleich, welcher Art - bei einem Aufrücken in eine höhere
12Crashkurs im Arbeitsrecht Sommersemester 2020
Altersstufe in der Lohngruppe oder in eine höhere Tarifgruppe
teilweise oder ganz anzurechnen. Abgesehen davon hat die Firma das
Recht, diese übertariflichen Lohnbestandteile jederzeit unbeschränkt zu
widerrufen und mit etwaigen Tariferhöhungen zu verrechnen. Auch
jede andere Leistung, die über die in den Tarifverträgen festgelegten
Leistungen hinausgeht, ist jederzeit unbeschränkt widerruflich und
begründet keinen Rechtsanspruch für die Zukunft.
▪ mit Schreiben vom 11.04.2005 widerrief B unter Bezugnahme auf den
arbeitsvertraglichen Widerrufsvorbehalt die übertarifliche Zulage zum Monatsentgelt
▪ sie begründete den Widerruf mit ihrer wirtschaftlichen Situation
▪ gleich lautende Schreiben erhielten alle Arbeitnehmer
Ist der Widerruf wirksam?
Fall 10: Freiwilligkeitsvorbehalt bei Weihnachtsgeld
I.
A war bei B aufgrund eines im Dezember 2004 geschlossenen Arbeitsvertrages beschäftigt. In
dem vorformulierten Arbeitsvertrag hieß es unter anderem:
㤠5
Als Sonderleistung zahlt das Unternehmen als Urlaubsgeld zum 1. Juli
und als Weihnachtsgeld zum 1. Dezember eines jeden Jahres jeweils
50 Prozent des vereinbarten Brutto-Monatsverdienstes, ohne
Berücksichtigung eines etwaigen Entgeltes für zusätzliche
Arbeitsleistungen. Die Zahlung von Sonderleistungen, Gratifikationen,
Prämien und ähnlichen Zuwendungen liegt im freien Ermessen des
Unternehmens und begründet keinen Rechtsanspruch, auch wenn die
Zahlung wiederholt ohne ausdrücklichen Vorbehalt der Freiwilligkeit
erfolgt.“
Nachdem B im Jahr 2006 kein Weihnachtsgeld zahlte, fragt A, ob er auf die Zahlung einen
Anspruch hat.
II.
Nachdem sich der bisherige § 5 des Arbeitsvertrags von A als unwirksam herausgestellt hat,
schließen A und B einen neuen vorformulierten Arbeitsvertrag. Dort heißt es nun unter der
Überschrift „Weihnachtsgeldanspruch“ in § 6:
„Als freiwillige Leistung – ohne jeden Rechtsanspruch – wird in Abhängigkeit von der
Geschäftslage und der persönlichen Leistung im November festgelegt, ob und in
welcher Höhe der Arbeitnehmer ein Weihnachtsgeld gezahlt wird. Auch bei
wiederholter Zahlung besteht hierauf kein Rechtsanspruch.
13Crashkurs im Arbeitsrecht Sommersemester 2020
Der Arbeitnehmer verpflichtet sich, das Weihnachtsgeld unverzüglich zurückzuzahlen,
falls sein Anstellungsverhältnis mit B vor dem 1. April des jeweils folgenden Jahres
durch eigene Kündigung oder durch Kündigung von B aus Gründen, die in der Person
des Arbeitnehmers liegen, beendet wird.“
B kündigte das Arbeitsverhältnis betriebsbedingt wegen Arbeitsmangel mit Schreiben vom
25. Juli 2008 zum 30. September 2008. Im November 2008 zahlte B an die ihr verbleibenden
Mitarbeiter, die Anspruchsvoraussetzungen erfüllten, ein Weihnachtsgeld in Höhe eines
halben Bruttomonatsverdienstes. Steht das auch A zu?
Fall 24a: Annahmeverzug bei unwirksamer Kündigung
A ist seit 15 Jahren bei der B-GmbH zu einem monatlichen Bruttolohn von 2.100 Euro
beschäftigt. Die B-GmbH beschäftigt 100 Arbeitnehmer. Mit Schreiben vom 30.04., Zugang
am gleichen Tag, erklärt der Personalchef der B-GmbH die außerordentlichen Kündigung
wegen Geschäftsschädigung der B-GmbH. Hiergegen erhebt A fristgerecht
Kündigungsschutzklage vor dem Arbeitsgericht. Daraufhin fordert ihn der Personalchef
schriftlich auf, ab dem 01.06. für die Dauer des Kündigungsschutzverfahrens die Arbeit
wieder aufzunehmen. A lehnt das ab.
Für die Monate Juli und August bezieht A Arbeitslosengeld (jeweils 1.100 Euro). In der Zeit
ab dem 01.09. bis zum 30.11. konnte A eine befristete Beschäftigung bei der C-AG finden.
Dort verdiente er monatlich 2.500 Euro brutto. Das Gericht stellt auf die mündliche
Verhandlung vom 30.11. hin die Unwirksamkeit der Kündigung fest. A verzichtet auf ein
Rechtsmittel und nimmt ab dem 01.12. wieder seine Tätigkeit bei der B-GmbH auf.
A verlangt von der B-GmbH nun die Nachzahlung seines Lohns vom 01.05. bis zum 30.11.
i.H.v. insgesamt 14.700 Euro. Die B-GmbH lehnt ab; sein Verhalten habe gezeigt, dass er
nicht bereit gewesen sei, während des Kündigungsschutzverfahrens bei ihr zu arbeiten.
Zumindest müsse er sich den anderweiten Verdienst (7.500 Euro) sowie das für Juli und
August bezogene Arbeitslosengeld (jeweils 1.100 Euro) anrechnen lassen.
Wie ist die Rechtslage?
Fall 29b: Annahmeverzug bei rückwirkend begründetem Arbeitsverhältnis
(vgl. dazu BAG, Urt. v. 27.01.2016, 5 AZR 9/15, NZA 2016, 691-694)
K war seit 2001 bei B beschäftigt. Im Jahre 2015 beendeten K und B mittels
Aufhebungsvertrag ihr Arbeitsverhältnis einvernehmlich zum 31. Dezember 2015. Zugleich
sicherte B dem K einzelvertraglich ein Rückkehrrecht zu. Mit Schreiben vom 10. Dezember
2017 kündigte K an, von diesem Gebrauch zu machen und verlangte, ab 01.01.2018 wieder
beschäftigt zu werden. Diesbezüglich bot er dem B den Abschluss eines Arbeitsvertrages zum
01.01.2018 an. B lehnte dies ab, ohne einen vernünftigen Grund anzugeben.
In der Folge reichte K beim Arbeitsgericht Klage ein mit dem Antrag, B zur Annahme des
Angebots zu verurteilen.
Das Arbeitsgericht gab der Klage statt und verurteilte B am 31.05.2018 rechtskräftig zur
Annahme des Angebots.
14Crashkurs im Arbeitsrecht Sommersemester 2020
K verlangt nun von B die Zahlung von Lohn für die Monate Januar bis einschließlich Mai
2018. Er ist der Ansicht, dass ab dem 01. Januar 2018 ein Arbeitsverhältnis bestand und B
sich seitdem im Annahmeverzug befunden habe. B ist hingegen anderer Auffassung. Ein
Vergütungsanspruch wegen Annahmeverzugs könne bei einem rückwirkend begründeten
Arbeitsverhältnis nicht entstehen.
Stehen K die geltend gemachten Ansprüche zu?
Fall 31a: Verdammte Technik
(BAG, Urt. v. 28.10.2010 – 8 AZR 418/09, NZA 2011, 345-349)
Susi Sausewind ist seit vielen Jahren als Reinigungskraft in der radiologischen Praxis des Dr.
Heiner Heilsam (H) angestellt, zuletzt gegen ein monatliches Bruttoentgelt in Höhe von 320
Euro. Die Praxis verfügt über einen sog. Magnetresonanztomographen (MRT), dessen
Reinigung nicht zu Susis Aufgaben gehört. An einem Sonntag im Januar 2006 besuchte Susi
eine über den Praxisräumen des H wohnende Freundin. Bei Besuchsende nahm sie auf dem
Weg zur Haustür in der Praxis einen Alarmton wahr. Susi ging in die Praxisräume, stellte fest,
dass der Alarm vom MRT ausging und wollte an der Steuereinheit des Geräts den Alarmton
ausschalten. Die fest an der Wand montierte Steuereinheit besitzt fünf Schaltknöpfe, vier
davon sind in blauer Farbe gehalten und mit „host standby“, „alarm silence“, „system off“
und „system on“ überschrieben. Oberhalb von diesen im Quadrat angeordneten blauen
Schaltknöpfen befindet sich ein deutlich größerer roter Schaltknopf, der mit der weißen
Aufschrift „magnet stop“ versehen ist. Dieser rote Schalter ist hinter einer durchsichtigen
Plexiglasklappe, die vor der Betätigung des Schalters angehoben werden muss, angebracht.
Um den Alarm auszuschalten, drückte Susi statt des hierfür vorgesehenen blauen Knopfes
„alarm silence“ den roten Schaltknopf „magnet stop“ und löste hierdurch einen sog. MRT-
Quench aus. Dabei wird das im Gerät als Kühlmittel eingesetzte Helium in wenigen Sekunden
ins Freie abgeleitet, was das elektromagnetische Feld des Gerätes zusammenbrechen lässt.
Die nach dieser Notabschaltung fällige Reparatur kostete 30.000 Euro. Susi verfügt über eine
freiwillig abgeschlossene Privathaftpflichtversicherung.
Diese Reparaturkosten fordert H nun von Susi zurück. Er ist der Auffassung, das Handeln der
Susi stelle sich als gröbst fahrlässig dar. Eine Haftungsprivilegierung scheide daher aus. Da
zudem die Privathaftpflichtversicherung der Susi einstandspflichtig sei, wirke sich die
Geltendmachung des vollständigen Schadensersatzanspruchs für sie auch nicht
existenzgefährdend aus.
Susi ist der Meinung sie müsse den Schaden nicht bezahlen. Schließlich habe sie sich
lediglich im angenommenen Interesse des H verpflichtet gefühlt, den Alarmton auszuschalten.
Dass sie dabei den falschen Knopf betätigt habe, sei versehentlich erfolgt. Grob fahrlässig
habe sie nicht gehandelt, schließlich habe sie nicht einmal die Möglichkeit des eingetretenen
Schadens gesehen.
Wie ist die Rechtslage?
15Crashkurs im Arbeitsrecht Sommersemester 2020
Fall 32a: Sachgrund oder nicht Sachgrund - das ist hier die Frage
(BAG Urt. v. 29.06.2011 – 7 AZR 774/09, NZA 2011. 1151 – 1155)
Susi Sausewind wurde durch am 06. Juni 2006 geschlossenen Arbeitsvertrag ab dem 17. Juli
2006 als Sachbearbeiterin im Versicherungsunternehmen der „Sicher-AG“ eingestellt. Im
Arbeitsvertrag heißt es u.A.:
„wird folgender aus sachlichem Grund
befristeter Arbeitsvertrag
geschlossen:
…
§2 Befristung/Probezeit/Beendigung des Arbeitsverhältnisses
Das Arbeitsverhältnis endet mit Ablauf des 16.07.2008, ohne dass es einer
ausdrücklichen Kündigung bedarf.
Die Befristung erfolgt aus folgendem Grund:
Der Arbeitnehmer wird für die Dauer von zwei Jahren zur Probe eingestellt, um dem
Arbeitnehmer die Übernahme in eine dauerhafte Beschäftigung zu erleichtern…“
Gemäß § 3 des anwendbaren Manteltarifvertrags gelten die ersten sechs Monate als Probezeit,
es sei denn, dass im Arbeitsvertrag auf eine Probezeit verzichtet oder eine kürzere Probezeit
vereinbart wird.
Susi, die als alleinerziehende Mutter schon lange nach einem Job gesucht hat, will sich gegen
die Befristung wehren und erhebt am 2. Juli 2008 beim zuständigen Arbeitsgericht Klage. Sie
ist der Auffassung, die Befristung des Arbeitsverhältnisses sei unwirksam. Nach § 2 des
Arbeitsvertrags sei eine Befristung zur Erprobung vereinbart worden. Eine Probezeit von zwei
Jahren sei aber zu lang. Weil nur der Befristungsgrund der Erprobung im Arbeitsvertrag
genannt sei, kämen andere Gründe für die Rechtfertigung oder Zulässigkeit der Befristung
nicht in Betracht.
Die Sicher-AG ist der Ansicht, das Arbeitsverhältnis sei jedenfalls nach § 14 Abs. 2 TzBfG
zulässig befristet worden. § 2 des Arbeitsvertrags stehe dem nicht entgegen.
Ist die zulässige Klage begründet?
16Crashkurs im Arbeitsrecht Sommersemester 2020
Fall 33: Schriftformerfordernis bei Befristung eines Arbeitsvertrags
(BAG, Urt. v. 16.04.2008, 7 AZR 1048/06, BB 2008, 1959)
Susi Sorglos (S) wurde von der R-GmbH zu einem Vorstellungsgespräch für eine Stelle als
KFZ-Mechanikerin geladen. Dieses fand Anfang März 2005 statt. Am 06.03.2005 erstellte der
Personalchef der R-GmbH einen Arbeitsvertrag mit einem Anschreiben an S. Der Text des
Anschreibens lautete auszugsweise wie folgt:
„Wir stellen Sie als KFZ-Mechanikerin ein. Das Arbeitsverhältnis beginnt am 01.04.2005 und
endet am 31.03.2008, ohne, dass es einer Kündigung bedarf. Die Einstellung erfolgt befristet
nach § 14 Abs. 1 des Teilzeit- und Befristungsgesetzes, auf Grund des Besuches der
Technikerschule eines unserer Mitarbeiter.
Beiliegenden Vertrag erhalten Sie in doppelter Ausfertigung. Schicken Sie uns bitte die Kopie
möglichst bald unterschrieben zurück.“
Am 01.04.2005 trat S ihre Arbeit an und übergab ein von ihr unterzeichnetes Exemplar des
Arbeitsvertrages dem Personalbüro der R-GmbH. Mit ihrer am 14.04.2008 beim
Arbeitsgericht eingegangenen Klage macht S die Unwirksamkeit der zum 31.03.2008
vereinbarten Befristung geltend. Sie behauptet, den Arbeitsvertrag erst am 01.04.2005 nach
Arbeitsbeginn unterzeichnet zu haben.
Ist ihre Klage begründet?
17Crashkurs im Arbeitsrecht Sommersemester 2020
Fall 89: Zulässigkeit einfacher Differenzierungsklauseln
(BAG, Urt. v. 18.03.2009, 4 AZR 64/08, NZA 2009, 1228 ff.; s. auch JuS 2012, 560)
A ist seit dem 1.6.1999 bei B als Pflegekraft beschäftigt. Sie ist nicht Mitglied der
Gewerkschaft G. Der zwischen A und B geschlossene Arbeitsvertrag lautet auszugsweise wie
folgt:
.....
Tarifvertragliche Regelungen:
Im Übrigen gelten die Bestimmungen des anzuwendenden Tarifvertrages in seiner jeweils
gültigen Fassung.
...
Der Tarifvertrag enthielt u.a. folgende Regelung:
„....
§ 3 Ausgleichszahlung für G-Mitglieder
(1) Als Ersatzleistung wegen des Verzichts auf die Sonderzahlungen gem. § 19 des
Haustarifvertrages der A-Gruppe erhalten die G-Mitglieder der A-Gruppe in jedem
Geschäftsjahr zum 31.7. eine Ausgleichszahlung in Höhe von 535 Euro Brutto je Vollzeitkraft
gemäß tariflicher Wochenarbeitszeit.
...
(2) Die Ausgleichszahlung erhalten Beschäftigte, die ihre Mitgliedschaft in der G-
Gewerkschaft für die zurückliegenden drei Monate bis zum Auszahlungstag glaubhaft zum
30.6. nachgewiesen haben.
§ 4 Ergebnisabhängige Sonderzahlung
(1) Als weitere Ersatzleistung erhalten die Beschäftigten der A-Gruppe jährlich eine
ergebnisabhängige Sonderzahlung gem. §§ 5 – 7, wenn die finanzielle und wirtschaftliche
Lage dies ermöglicht.”
A hat im Jahre 2006 keine Sonderzahlung und keine Ausgleichszahlung nach § 3 TVAstD
von B erhalten.
A möchte wissen, ob sie einen Anspruch auf Zahlung der Ausgleichszahlung für Mitglieder
der G in Höhe von 535 Euro hat.
18Crashkurs im Arbeitsrecht Sommersemester 2020
Fall 90: Unterlassungsanspruch der Gewerkschaften bei tarifwidrigen betrieblichen
Regelungen (Burda-Entscheidung)
(BAG, Beschl. v. 20.04.1999 – 1 ABR 72/98, NZA 1999, 887 ff.)
Die B-AG ist ein großes Unternehmen in der Druckbranche mit über 2000 Mitarbeitern. Die
B-AG ist Mitglied des regionalen Arbeitgeberverbandes. Bei der B-AG besteht ein
Betriebsrat.
Die zuständige Gewerkschaft (G) hat mit dem regionalen Arbeitgeberverband einen
Manteltarifvertrag (MTV) geschlossen, welcher für die AN der B-AG einschlägig ist.
In dem MTV sind insbesondere Zuschläge für Nachtarbeit und Abgeltung von Überstunden
sowie die Dauer der wöchentlichen Arbeitszeit auf 35 Stunden geregelt. Aufgrund der
schlechten Konjunkturlage gerät die B-AG in eine wirtschaftliche Schieflage. Die
Geschäftsführung beschloss Einsparungen mit einem Jahresvolumen von 40 Mio €. Nach
Verhandlungen mit dem Betriebsrat wurde am 29.02.2013, unter Abschluss einer
Betriebsvereinbarung, das Sparvolumen auf lediglich 30 Mio € beschränkt. Die
Betriebsvereinbarung soll bis 31.12.2017 gelten.
In dieser Betriebsvereinbarung heißt es unter anderem:
- Die AN, welche ihre schriftliche Zustimmung abgeben, erhalten bis zum Ablauf
der Betriebsvereinbarung eine uneingeschränkte Beschäftigungsgarantie.
- Die Zuschläge für Überstunden werden um 50% reduziert.
- Die wöchentliche Arbeitszeit wird auf 39 Stunden erhöht. Ausbezahlt werden
lediglich 37 Stunden monatlich.
Für diese Änderungen holten sich der Betriebsrat und die B-AG die schriftliche Zustimmung
fast aller AN ein. Diese lautete wie folgt:
„Ich erkläre, dass die am 29.02.2013 unterschriebene Vereinbarung für mich nicht nur als
Betriebsvereinbarung, sondern auch ganz persönlich für mich als Inhalt meines persönlichen
Arbeitsvertrages gelten soll. Die sich daraus ergebenden Änderungen meines
Arbeitsvertrages kenne ich aufgrund der ausführlichen Erläuterungen durch die
Geschäftsführung und Mitglieder des Betriebsrats."
Am 03.05.2013 wurde eine weitere Vereinbarung getroffen, in welcher anerkannt wurde, dass
die o.g. Vereinbarung vom 29.02.2013 nur für die AN gelten soll, welche auch zugestimmt
haben.
Im April des Jahres 2013 versuchte die G einen Firmentarifvertrag mit der B-AG zu
schließen, was jedoch erfolglos blieb. Die G ist nunmehr der Auffassung, sie könne von der
B-AG verlangen, die Durchführung der Vereinbarung vom 29.02.2013 zu unterlassen, soweit
diese im Widerspruch zu dem Manteltarifvertrag steht.
Ist dies Auffassung richtig?
19Crashkurs im Arbeitsrecht Sommersemester 2020
Fall 96b: Streikmobilisierung auf Firmenparkplatz
(BAG, Urt. v. 20.11.2018 – 1 AZR 189/17, NZA 2019, 402-407)
Die Klägerin (K) ist ein Unternehmen der Versandhandelsbranche. Das von ihr genutzte
Betriebsgebäude sowie der dazugehörige Firmenparkplatz befinden sich auf einem Gelände,
welches die Klägerin angemietet hat.
Der Betrieb der Klägerin wurde am 21. und 22. September zulässigerweise bestreikt. Zum
Streik aufgerufen hatte die Gewerkschaft ver.di (B) mit dem Ziel, mit dem bislang nicht
tarifgebundenen Arbeitgeber (also der Klägerin) einen Tarifvertrag abzuschließen. Zu diesem
Zweck bauten Gewerkschafter der ver.di (also der Beklagten) auf einer kleinen Fläche auf
dem Firmenparkplatz vor dem Haupteingang Stehtische und Sonnenschirme auf. Dort
sprachen sie die vorbeikommenden Arbeitnehmer an und forderten diese auf, sich am Streik
zu beteiligen.
Der Haupteingang des Betriebsgebäudes der Klägerin ist nur vom Firmenparkplatz aus
erreichbar, die Arbeitnehmer müssen diesen auf dem Weg in das Betriebsgebäude überqueren.
Die Einmündung zum Firmenparkplatz befindet sich direkt an einer öffentlichen Straße.
Am 21. September erschienen Vertreter der Klägerin auf dem Firmenparkplatz und forderten
die Gewerkschafter auf, diesen zu verlassen. Dieser Aufforderung kamen die Gewerkschafter
jedoch nicht nach. Die Klägerin verklagte die Beklagte in der Folge auf Unterlassung der
Parkplatznutzung.
Zu Recht?
Fall 97a: Arbeitskampf und Tarifeinheit
Albert Allwissend (A) betreibt ein großes Luftfahrtunternehmen und beschäftigt derzeit etwa
2 000 Arbeitnehmer, von denen lediglich 175 nicht gewerkschaftlich organisiert sind. Im
Betrieb des Allwissend gelten zwei kollidierende Firmentarifverträge über Lohn, der der
Gewerkschaft Sonnenflug (GS) und der der Gewerkschaft Mondlandung (GM). Da der
Tarifvertrag zwischen A und der GM zum 31.01.2016 endet, plant die Gewerkschaft bereits
im alten Jahr die Führung neuer Tarifverhandlungen mit dem Ziel von Lohnerhöhungen. A
lehnt jegliche Verhandlungen über einen neuen Firmentarifvertrag über Lohn ab. Zur
Begründung führt er an, es gebe doch da jetzt so ein „neues Gesetz“, nach dem im Falle
kollidierender Tarifverträge derjenige Tarifvertrag der Gewerkschaft vorrangig sei, der die
meisten Mitglieder aufweise und das sei ganz klar die Gewerkschaft Sonnenflug. Die
Sonnenflug-Gewerkschaft weise aktuell nämlich 920 Mitglieder auf, während die
Mondlandung-Gewerkschaft lediglich 905 Mitglieder zähle.
Die GM ist empört und will sich damit nicht abfinden. Sie sieht in dem Verhalten des A eine
Verletzung ihrer verfassungsmäßig garantierten Rechte. Da sich A trotz mehrerer Versuche
der GM nicht umstimmen lässt, ruft diese nach zuvor ordnungsgemäß erfolgtem
Verbandsbeschluss ihre Mitglieder auf, vom 01. bis 08.03.2016 ihre Arbeit niederzulegen.
Dies geschieht sodann nach zuvor erfolgter ordnungsgemäßer Benachrichtigung an
Allwissend.
Aufgrund des angekündigten Streiks muss A etliche Flüge streichen. Insgesamt entsteht ihm
so ein Schaden in Höhe von 300 000 €. A ist der Meinung, die Mondlandung-Gewerkschaft
habe als Minderheitsgewerkschaft kein Recht zum Streik gehabt, da ihr Tarifvertrag schon
nicht zur Anwendung gekommen wäre. Einen solchen Tarifvertrag zu erstreiken, sei von
20Crashkurs im Arbeitsrecht Sommersemester 2020
vornherein sinnlos gewesen. Die MG ist dagegen der Ansicht, sie habe sehr wohl streiken
dürfen.
A möchte nun wissen, ob er von der MG Ersatz des entstandenen Schadens in Höhe von
300.000 € verlangen kann.
Fall 105: Unterlassungsanspruch des Betriebsrates bei der Anordnung von Arbeit
während festgelegter Pausenzeiten
(BAG, Beschl. v. 07.02.2012 - 1 ABR 77/10, NJW Spezial S. 338)
Die Arbeitgeberin Susi Sausewind betreibt ein Luftverkehrsunternehmen. Sie hat mit dem
Betriebsrat für das Bodenpersonal eine Betriebsvereinbarung geschlossen, in der die Dauer
und Lage der Pausenzeiten der Mitarbeiter geregelt sind. Die Pausenzeiten müssen demnach
im Voraus in Schichtplänen verbindlich festgeschrieben werden.
In der Vergangenheit kam es in mindestens 36 Fällen dazu, dass Mitarbeiter die vorgesehenen
Pausen nicht einhalten konnten, sondern während dieser Zeit arbeiten mussten. Die
Ruhepause entfiel vollständig und wurde auch nicht zu einem späteren Zeitpunkt gewährt.
Susi unterrichtete den Betriebsrat hierüber jeweils nachträglich durch sog.
„Überstundenmitteilungen“. Nachdem der Betriebsrat von Susi verlangte sicherzustellen, dass
die Arbeitnehmer die festgelegten Pausen in Anspruch nehmen können, wies diese ihre
Beschäftigten an, die Pausenzeiten einzuhalten. Zudem stellte sie weitere Mitarbeiter in dem
Tätigkeitsbereich ein, in dem überwiegend die Pausenzeiten nicht eingehalten wurden.
In der Folgezeit kommt es dennoch immer wieder dazu, dass Pausenzeiten durch einzelne
Mitarbeiter nicht eingehalten werden. Der Betriebsrat verlangt daher vor dem Arbeitsgericht,
Susi Sausewind aufzugeben, die Anordnung oder Duldung von Arbeit während der
festgelegten Pausenzeiten zu unterlassen.
Kann der Betriebsrat vor Gericht verlangen, dass Susi die Unterlassung der Anordnung oder
Duldung von Arbeit während der Pausenzeiten aufgegeben wird?
Fall 105a: Abmahnung Betriebsrat
(BAG, Beschl. v. 09. September 2015 – 7 ABR 69/13)
Die Sauber GmbH (S) ist im Saarland mit der Müllentsorgung und der Stadtreinigung betraut.
In ihrem in Dudweiler ansässigen Betrieb ist ein Betriebsrat gebildet, dessen Vorsitzender
Frank Feger (F) ist. S gehört dem Neu-Konzern (N) an. In dem dort gebildeten
Konzernbetriebsrat ist F ebenfalls Mitglied. Im Mai 2011 schloss S mit dem Betriebsrat eine
Betriebsvereinbarung über den Einsatz von Leiharbeitnehmern ab. Diese schickte F im
Dateianhang einer E-Mail vom 9. Dezember 2011 an alle Arbeitnehmer des Konzerns und
schrieb dazu, die angehängte Betriebsvereinbarung solle eine mögliche Hilfestellung für alle
Betriebsräte des Konzerns sein. F will zudem auch zukünftig Mails mit Anregungen und
Anhängen verschicken. Mit Schreiben vom 14. Dezember 2011 erteilte S dem F eine
„Abmahnung als Betriebsrat“, die zu dessen Personalakte genommen wurde. Darin heißt es:
„Sehr geehrter Herr F,
am 09.12.2011 haben Sie sich mit einer E-Mail an alle Mitarbeiter des N Konzerns
gewandt. Hierbei haben Sie die BV Leiharbeit versandt.
Ihr Verhalten stellt einen Verstoß gegen die vertrauensvolle Zusammenarbeit dar.
Aufgrund ihrer Position sind Sie lediglich berechtigt, sich an Mitarbeiter der S zu
wenden. Ferner sind Sie nicht berechtigt, Betriebsvereinbarungen der S an Mitarbeiter
21Crashkurs im Arbeitsrecht Sommersemester 2020
außerhalb der S zu versenden. Hierbei handelt es sich um externe Dritte, selbst wenn
sie dem N Konzern angehören.
Für Ihr Fehlverhalten mahnen wir Sie hiermit ab. Sollten Sie erneut gegen das
Prinzip der vertrauensvollen Zusammenarbeit verstoßen und sich in entsprechender
Art und Weise pflichtwidrig verhalten, müssen Sie damit rechnen, dass wir Ihren
Ausschluss als Betriebsratsmitglied beim Arbeitsgericht beantragen werden (§ 23
BetrVG). Gegebenenfalls könnte sogar eine Kündigung des Arbeitsverhältnisses in
Betracht kommen.
Hochachtungsvoll S“
Dagegen stellen sowohl der Betriebsrat, der seine Arbeit durch die Abmahnung gestört sieht,
als auch F selbst einen Abmahnungsentfernungsantrag bei dem zuständigen Arbeitsgericht.
Sind die Anträge begründet?
Fall 107a: Schulungskosten Betriebsrat
In dem in Völklingen ansässigen Krankenhausbetrieb des Valentin Valente (V) ist ein
neunköpfiger Betriebsrat gebildet. Dieser möchte die allgemeinen Unsicherheiten um das
2015 verabschiedete Tarifeinheitsgesetz zum Anlass nehmen, um seine Mitglieder über die
gesetzliche Tarifeinheit zu schulen. Immerhin sind im Betrieb des V zwei konkurrierende
Gewerkschaften, namentlich der Gießener Bund und ver.mi, vertreten. Als der Betriebsrat
erfährt, dass ver.mi im August 2016 eine unter dem Titel „Olé, olé, 4a TVG: Schulung zu den
Auswirkungen der gesetzlichen Tarifeinheit in der Betriebspraxis“ angepriesene, dreitägige
Schulung in Saarlouis veranstaltet, melden sich nach ordnungsgemäßer Beschlussfassung drei
der neun Betriebsratsmitglieder für diese Schulung an und nehmen teil. Die Schulungskosten
belaufen sich dabei auf 500 € pro Teilnehmer, wobei ver.mi nach Abzug ihrer Kosten pro
Teilnehmer einen Gewinn von 50 € verbuchen kann. Als der Betriebsrat im Folgenden an V
herantritt und von ihm die ausgelegten Schulungskosten erstattet haben möchte, verweigert
dies V. § 4a TVG sei eine Norm des Tarifrechts und habe mit der Tätigkeit des Betriebsrats
gar nichts zu tun. Jedenfalls rechtfertige die Norm keine mehrtägige Schulung für so viele
Betriebsratsmitglieder, die außerdem noch viel zu teuer gewesen sei. Es wäre ja auch noch
schöner, wenn er kurz vor Ablauf des ver.mi-Tarifvertrages dieser noch so viel Geld in den
Rachen werfen müsste. Wenn der Betriebsrat sich hätte zu dem Thema schulen wollen, hätte
er sich an den in Trier ansässigen, privaten Schulungsanbieter Norbert Neutrali (N) wenden
sollen, der eine vergleichbare Schulung für 485 € pro Person angeboten hätte.
Kann der Betriebsrat gleichwohl Erstattung der angefallenen Kosten verlangen? Und wenn ja,
in welcher Höhe?
22Sie können auch lesen