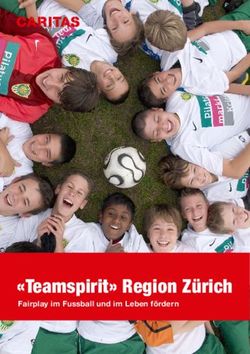Der gesellschaftliche Kontext Mexikos: Grenze, Transgression, Gewalt
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
3. Der gesellschaftliche Kontext Mexikos:
Grenze, Transgression, Gewalt
Das vorliegende Kapitel widmet sich den vielfältigen innergesellschaftlichen und
diskursiven, d. h. nicht nur räumlichen Grenzen Mexikos und untersucht, welcher
Zusammenhang mit den aktuell hohen Gewaltraten besteht. Es ist auffällig, dass
die Forschungsliteratur häufig metaphorisch auf die Konzepte der ‚Grenze‘ und
‚Transgression‘ rekurriert, um diese Gewalt zu beschreiben. 1 Raummetaphern
dienen dazu, Machtkonstellationen aufzudecken, wie Vittoria Borsò anhand von
Michel Foucault zeigt (Borsò 2004, 18). Werden sie innerhalb des wissen-
schaftlichen Textes verwendet, deuten sie auf die Beziehung zwischen Wissen und
Macht hin (ebd.). Dass die von Forschung und Presse zum gesellschaftlichen Kon-
text Mexikos eingesetzten Raummetaphern die spezifische Form der ‚Grenze‘ und
‚Transgression‘ annehmen, zeugt davon, so meine These, dass rund um das Thema
der Gewalt um Deutungshoheit gestritten wird, und die Frage nach eindeutigen
Definitionen und wissenschaftlichen Erklärungen noch auszuhandeln ist. Im Fol-
genden werden die von diesen Metaphern dominierten Themenbereiche miteinan-
der in Beziehung gesetzt. Das Kapitel leitet die von einer extremen Gewalt
geprägte Krisensituation Mexikos in den 2000er Jahren aus dem Kontext histori-
scher Grenzziehungen her und analysiert die Kontinuitäten von Gewalt und sozia-
ler Marginalisierung, die sich seit der Kolonialzeit in die mexikanischen
Gesellschaftsstrukturen eingeschrieben haben. Anhand der institutionell nicht auf-
gearbeiteten Menschenrechtsverletzungen aus der Zeit des PRI-Regimes wird
gezeigt, wie umkämpft das kulturelle Gedächtnis 2 ist, das keine stabile Grundlage
bildet, um die aktuelle Gewalt erfolgreich zu bewältigen.
Mexiko kann als ein Land der Schwelle par excellence bezeichnet werden: Es
gehört geographisch zu Nordamerika, unterscheidet sich aber sprachlich – in Fol-
ge des Kolonialismus – von den anglophonen USA sowie dem franko-anglopho-
nen Kanada. Mexiko gehört zu dem spanischsprachigen Teil Lateinamerikas,
Hispanoamerika. Auch aus ökonomischer Perspektive befindet es sich als sog.
‚Schwellenland‘ (rising power, país emergente) in einer Zwischenposition, die die
Binarität zwischen Globalem Norden und Globalem Süden herausfordert. 3 Doch
1
Die Beispiele finden sich sowohl in der spanischsprachigen, als auch in der englischen und
deutschen Literatur und Presse: Die taz titelt „Aus der Schusslinie“ (Henkel 2012); es ist die
Rede von „blurry battle lines“ (Esch 2018, 181).
2
Maurice Halbwachs’ Konzept der mémoire collective weiterentwickelnd, differenziert Jan
Assmann zwischen dem ‚kommunikativen‘ und dem ‚kulturellen‘ Gedächtnis. Diese Unterschei-
dung hilft nachzuvollziehen, dass nicht alle Ereignisse im diskursiv dominanten Gedächtnis
präsent bleiben, da es institutionell geformt wird, organisiert ist und normativ wirkt (vgl. Ass-
mann 1988, 14f.).
3
Die Terminologie beruht auf der 1980 von der Brandt Kommission gemachten Feststellung,
dass die wirtschaftlich dominanten Länder der Weltordnung im Norden angesiedelt sind, wäh-
rend der Süden aus ärmeren Staaten besteht (vgl. Bullard 2012, 724f.). Schwellenländer entwi-
© Der/die Herausgeber bzw. der/die Autor(en), exklusiv lizenziert durch
Springer-Verlag GmbH, DE, ein Teil von Springer Nature 2020
J. Augustin, Gewalt erzählen, Prolegomena Romanica. Beiträge
zu den romanischen Kulturen und Literaturen,
https://doi.org/10.1007/978-3-662-62205-6_354 3. Der gesellschaftliche Kontext Mexikos: Grenze, Transgression, Gewalt obwohl die Auswirkungen der Globalisierung die Rigidität staatspolitischer Gren- zen in Frage stellen, bleiben Ungleichheiten bestehen und die Trennlinien des North-South-Divide verlagern sich ins Innere des Landes, wie anhand der asym- metrischen sozioökonomischen Entwicklungen innerhalb Mexikos zu zeigen sein wird. Das Land, in dem die großen weltpolitischen Themen, Globalisierung, Mig- ration und Sicherheitspolitik, ausgehandelt werden, gleicht einem pars pro toto, das regional die Auswirkungen der komplexen Weltpolitik nachvollziehbar macht. 4 Mit den USA als wichtigem Global Player im Norden und dem Triángulo Norte (Guatemala – Honduras – El Salvador), der ärmsten und von Gewalt am stärksten betroffenen Region Lateinamerikas (vgl. Mackenbach und Maihold 2015, 1f.) im Süden, bildet Mexiko den einzigen Landweg zwischen den beiden Extremen des Globalen Nordens und Globalen Südens. Dabei wird ganz Mexiko mitunter als ‚Grenze‘ bezeichnet: „[T]odo México es una frontera vertical“ (Basail Rodríguez 2005, 243). Dies gilt für die USA, die Mexiko sicherheitspolitisch als verlängerte, zweite Außengrenze des eigenen Landes erachten (vgl. Marengo Camacho 2015, 23f.), ebenso wie für den Süden: hier betrachten die mittelameri- kanischen Transmigranten Mexiko auf ihrem Weg in die USA als das Grenzland, das sie durchqueren müssen (Basail Rodríguez 2005, 243). 3.1 Historische Grenzziehungen 3.1.1 Kolonialzeit und Unabhängigkeit: Castas, caciques, caudillos Die Geschichte des heutigen Mexiko beginnt lange Zeit vor der Eroberung durch die Spanier, denn seit der präklassischen Periode (ca. 2500 BC-200 AD) leben in Mesoamerika unterschiedliche Hochkulturen. 5 Als Anfang des 16. Jahrhunderts ckeln sich wirtschaftlich stärker und sind politisch präsenter als die Länder des Globalen Südens (vgl. Nölke u.a. 2014, 8). 4 Vgl. z. B. „Considered a semi-peripheral country, Mexico lies on the great default line between the Global North and Global South. [...] Mexico provides a rich case study of the nexus between globalization and migration“ (Dickinson 2017, 58). „La Frontera Sur de México es […] [un] laboratorio de los procesos globales“ (Basail Rodríguez 2005, 239). Mit diesen Aussagen folgt die Forschungsliteratur einem durch die postkolonialen Studien initiierten Topos der Grenze als Kontakt- und Konfliktzone zwischen der Ersten und der Dritten Welt bzw. als Laboratorium: „The U.S.-Mexican border es una herida abierta where the Third World grates against the First and bleeds“ (Anzaldúa 2012, 25, Hervorhebung i. O.), „[E]sta ciudad [Tijuana] […] es uno de los mayores laboratorios de la posmodernidad“ (García Canclini 2010, 286). Vgl. hierzu Fußnote 43 des vorliegenden Kapitels. 5 Die prähispanische Geschichte Mexikos kann hier nur in groben Zügen behandelt werden. Bei einer Analyse der Epochen der Klassik (ca. 100/250-900 AD) und Postklassik (ca. 900-1521), sind drei Aspekte zentral: 1. sind die Kulturen als heterogen zu betrachten, 2. wechseln sich kulturelle Blütezeiten, dominiert von profunden landwirtschaftlichen, bautechnischen und astro- nomischen Entwicklungen, urbanen Zentren und regem Handel, mit Phasen der Instabilität, d. h. demographischen Einbrüchen, Kriegen und dem Zerfall ganzer Gesellschaften ab. Die Gewalt ist bereits vor Ankunft der Spanier auf dem Kontinent präsent. 3. nehmen Religion und Rituale einen zentralen Aspekt in der Gesellschaftsorganisation ein, weshalb die jeweils herrschenden
3.1 Historische Grenzziehungen 55
die spanischen Eroberer an Land gehen, beherrscht das Mexica-Reich 6 große Teile
des Territoriums. 7 So erachten Tlaxcala und Texcoco es als Möglichkeit, die
Vormachtstellung der Mexicas zu unterminieren, indem sie mit den Spaniern kol-
laborieren und maßgeblich dazu beitragen, dass diese unter Hernán Cortés im
Jahre 1521 Tenochtitlan einnehmen und die Mexicas besiegen (vgl. Escalan-
te Gonzalbo 2017, 144-146; García Martínez 2017, 176). Die Conquista, die eine
historische Zäsur markiert, legt den Grundstein für die Globalisierung, denn die
Auswirkungen des Kolonialismus beeinflussen bis heute die wirtschaftliche und
geopolitische Aufteilung der Welt (vgl. Mignolo 2000, 236f.). 8
Im 16. Jahrhundert hat dies für die indigenen Völker Mexikos ganz konkrete,
fatale Konsequenzen. Aufgrund der überlegenen Waffentechnologie der Spanier
und der aus Europa eingeschleppten Krankheiten, die in Amerika noch unbekannt
sind, kommt ein Großteil der Bevölkerung um. 9 Die Sozialstrukturen zerfallen, die
Landwirtschaft bricht ein, die Spanier beuten die Ressourcen aus (vgl. Gar-
cía Martínez 2017, 194f.). Da sich die spanische Vorherrschaft allerdings nicht un-
mittelbar flächendeckend auszubreiten vermag, was sich allein schon durch die
Größe des zu verwaltenden Territoriums erklärt, bleiben einige Strukturen aus
prähispanischer Zeit bestehen. Viele Mitglieder des indigenen Adels werden stra-
tegisch eingesetzt, indem sie zwar der spanischen Herrschaft unterstehen, aber auf
lokaler Ebene die Verantwortung über Besitztümer und die tributzahlende Bevöl-
kerung behalten (vgl. ebd., 183). Die ursprünglichen Nuancierungen verlieren
innerhalb des Standes ihre Gültigkeit; unter dem Namen caciques entsteht eine
neue, homogenisierte Gesellschaftsgruppe (vgl. Villella 2017, 31f.). Ebenso etab-
liert sich das feudale encomienda-System, das die politische und wirtschaftliche
Verantwortung einzelner Regionen an die Konquistadoren delegiert. Die en-
comendores verwalten und christianisieren die Einwohner, im Gegenzug für Tri-
butzahlungen und Dienstleistungen (vgl. García Martínez 2017, 179). Von Beginn
an verbieten die Spanier die prähispanischen Religionen und führen die Inquisition
ein (vgl. ebd., 196f.). Der christliche Glaube dient ihnen dazu, Hierarchien und
Völker synkretistisch die existierenden religiösen Praktiken und Mythen übernehmen, um damit
die eigene Herrschaft zu legitimieren (vgl. Nalda 2017, 75, 93ff., 105f.).
6
Die vorliegende Arbeit verwendet das in der mexikanischen Wissenschaft gängige Mexicas
anstelle von ‚Azteken‘. Der Terminus aztecas etabliert sich erst im 19. Jahrhundert durch europä-
ische Forscher wie Humboldt, während ältere Schriften wie die Códices noch deren Selbstbe-
zeichnung als mexica benutzen (vgl. León-Portilla 2000, 309f.).
7
Die Mexicas gründen 1345 auf einer Insel im Texcoco-See die Stadt Tenochtitlan, das zukünf-
tige Mexiko-Stadt, und ab 1434 gelingt es ihnen in der sog. Triple Alianza, schrittweise die
Handelsrouten zu kontrollieren sowie andere Völker zu unterwerfen. Ab Mitte des 15. Jahrhun-
derts erlangt Tenochtitlan somit seine Hegemonie als Imperialmacht (vgl. Escalante Gonzalbo
2017, 139-144).
8
Vgl. Kapitel 2.1.4 dieser Arbeit zum Werk Walter Mignolos, der in Local Histories/Global
Designs. Coloniality, Subaltern Knowledges, and Border Thinking (2000) die These vertritt, dass
die Moderne auf Kolonialität beruhe. Neben ökonomischen geht es Mignolo dabei vor allem um
die epistemologischen Auswirkungen des Kolonialismus.
9
Die autochthone Bevölkerung im Gebiet des heutigen Mexiko minimiert sich um etwa 80%,
von ca. 17,8 Millionen Einwohnern im Jahre 1519 auf nur 3,5 Millionen im Jahre 1550 (Gar-
cía Martínez 2017, 194).56 3. Der gesellschaftliche Kontext Mexikos: Grenze, Transgression, Gewalt Gewaltanwendung zu legitimieren (vgl. Alcántara Granados 2014, 161f., 169f.). In vielen Fällen münden diese Organisationsstrukturen in Ausbeutung, Zwangsar- beit sowie in regionale Diskrepanzen, die sich in der neuen Gesellschaftsordnung verfestigen (vgl. García Martínez 2017, 195, 205). Dabei werden alle Indigenen unter der Kategorie indios subsumiert und bilden fortan eine klar abgegrenzte Unterschicht (vgl. Alcántara Granados 2014, 206). Diese terminologische Verein- heitlichung des neuen ‚Anderen‘ wird in der Kolonialzeit im sog. casta-System 10 institutionalisiert, das zwischen ethnisch begründeten Ständen unterscheidet und die koloniale Gesellschaft bis zu ihrem Ende streng hierarchisch organisiert. 11 Mit einem Rückgriff auf Walter Benjamins Zur Kritik der Gewalt kann man das casta- System als Ausdruck des ‚rechtsetzenden‘ Charakters von Gewalt identifizieren. Gesellschaftsordnungen konstituieren sich demnach in einem Akt der Gewalt, der eine bestimmte Rechtsnorm etabliert und in der Folge zu erhalten versucht (Ben- jamin 1977, 190; vgl. Honneth 2011, 196). Auch nach der Unabhängigkeit Mexikos im Jahre 1821 bleiben die asymmetri- schen Gesellschaftsstrukturen bestehen und das System der castas wirkt faktisch fort, obwohl es offiziell abgeschafft wird. 12 Die soziale Kluft zwischen den Be- völkerungsgruppen verhärtet sich. Darüber hinaus sieht sich das unabhängige Mexiko mit diversen politischen und wirtschaftlichen Problemen konfrontiert, ist international isoliert, der Handel minimiert sich und die produzierten Güter verlie- ren erheblich an Wert (vgl. González 2000, 97). Zudem sind 50% der arbeitsfähi- gen Bevölkerung während des Unabhängigkeitskrieges zu Tode gekommen (vgl. ebd.). Die fehlende Erfahrung in politischer Administration führt zu diversen bewaffneten Konflikten zwischen unterschiedlichen Interessengruppen und zur regionalen Machtübernahme durch caudillos (vgl. ebd., 98). Die Instabilität des Landes wird schon allein in der hohen Zahl von fünfzig unterschiedlichen Regie- rungen deutlich, die zwischen 1821 und 1850 in Mexiko jeweils kurz an der Macht sind (vgl. ebd., 105). Während sich Mexiko als Nationalstaat konsolidiert, entstehen im Norden und Süden Mexikos neue territoriale Grenzen (vgl. Fábregas Puig 2005, 34f.). Aller- 10 In diesem System befinden sich die Spanier an oberster Stelle, gefolgt von den auf amerikani- schem Boden geborenen Kreolen. Auf der darunterliegenden Position werden die Mestizen und Mulatten angesiedelt, während sich die Indigenen und die aus Afrika verschleppten Sklaven auf der untersten gesellschaftlichen Stufe befinden (vgl. Ruhl und Ibarra García 2000, 98). Ende des 17. Jahrhunderts differenziert sich das casta-System weiter aus, wie das Genre der pinturas de castas zeigt: Je nachdem, aus welcher Vereinigung die Kinder hervorgehen, werden sie z. B. als pardos oder zambos bezeichnet, ihre ethnische Zugehörigkeit und soziale Wertigkeit klassifiziert (vgl. Hausberger und Mazín 2017, 292). 11 Fast drei Jahrhunderte besteht das 1535 gegründete Virreinato de Nueva España und entwi- ckelt sich, bis zu den Unabhängigkeitskriegen ab 1810, zu Spaniens wirtschaftlich erfolgreichster und großflächigster Kolonie. Im 18. Jahrhundert ist Nueva España mehr als drei Mal so groß wie das heutige Mexiko und umfasst große Teile der heutigen USA, bis nördlich von San Francisco, sowie die Philippinen (vgl. Ruhl und Ibarra García 2000, 66). 12 Die Kontinuität der strukturellen Benachteiligung prägt bis heute die mexikanische Gesell- schaft: „[N]etworks, access to influence, power, and ressources in Mexico since Europeans conquered the Amerindians have been tied, in general, to race/ethnicity“ (González 2019, 36).
3.1 Historische Grenzziehungen 57 dings sind sie in den nur spärlich besiedelten Grenzregionen nicht eindeutig defi- niert und der Großteil der Bevölkerung lebt im Zentrum des Landes (vgl. González 2000, 97). Angesichts dieser problematischen Situation, die Terri- torialkonflikte begünstigt, bemüht sich die mexikanische Regierung mit wirt- schaftlichen Anreizen die peripheren Gebiete im Norden und Süden zu kolonisieren (vgl. ebd., 103). Bei den sich hier entwickelnden Prozessen nimmt die ‚Grenze‘ die Form einer Erschließungsgrenze an – das vermeintlich unberührte Land soll schrittweise nutzbar und bewohnbar gemacht werden. 13 Im Norden lassen sich vor allem anglophone Siedler nieder, die sich sprachlich, religiös und wirtschaftlich nicht an Mexiko gebunden fühlen und sich von der zentralen Regie- rungsgewalt lossagen, indem sie Texas 1836 zu einer unabhängigen Kolonie er- klären und 1845 der Union der Vereinigten Staaten Amerikas beitreten (vgl. Serrano Ortega und Vázquez 2017, 424, 432). Die US-amerikanische Regierung unterstützt die Aufständischen, da sie als Verfechter der sog. Manifest Destiny das Ziel verfolgt, den eigenen Einfluss bis zum Pazifik auszuweiten. 14 Nach Zu- sammenstößen mit den mexikanischen Truppen erklären die USA im Jahr 1846 Mexiko den Krieg und das US-amerikanische Heer erobert in der Folge nahezu das gesamte Land (vgl. ebd., 432-435). Als Mexiko 1848 das Friedensabkommen von Guadalupe Hidalgo unterzeichnet, sieht es sich gezwungen, mehr als die Hälfte seines Territoriums an die USA abzutreten. 15 Die Grenze zwischen den beiden Ländern wird an den Río Grande/Rio Bravo verlegt, an jene Linie, die auch den heutigen Verlauf markiert. 16 Diese Grenzverlagerung, bei der sich ihre Form von einer beweglichen Zone zu einer Linie wandelt, hat für die in der Region lebenden Menschen eine direkte Konsequenz: Während die mexikanischen Siedler auf dem Territorium bleiben und die US-amerikanische Staatsbürgerschaft an- 13 Vgl. die in Kapitel 2.1.1 dieser Arbeit anhand von Osterhammel (2001, 213) erläuterte ‚Expan- sionsgrenze‘, der die Idee eines Niemandslandes (terra nulius) zugrundeliegt, mithilfe dessen oftmals die bereits im Gebiet lebenden Menschen oder Lebewesen missachtet und die eigene Expansion legitimiert werden. 14 In den 1840er Jahren dient die Manifest Destiny dazu, die US-amerikanische Expansion my- thisch-religiös als Berufung zu legitimieren. Als rassistisch erscheint die dieser Doktrin inhärente Vorstellung, man müsse das mexikanische Territorium von der Herrschaft durch die Mexikaner befreien. Dabei werden die Mexikaner mit den negativen Stereotypen belegt, die vorher den Spaniern zugesprochen wurden (vgl. Erazo Heufelder 2018, 29, 33). 15 Mexiko verliert die Staaten Texas, Nuevo México und Nueva California, insgesamt 2.400.000 Quadratkilometer des Landes (vgl. González 2000, 105). – Heute erstreckt sich die frontera norte über 3.144 Kilometer (Gutzmer 2018, 5), entlang der Bundesstaaten Baja California, Sono- ra, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León und Tamaulipas. Auf der US-amerikanischen Seite sind Kalifornien, Arizona, New Mexico und Texas die an der Grenze liegenden Staaten. 16 Im „Tratado de Paz, amistad, límites y arreglo definitivo entre la República Mexicana y los Estados Unidos de América“ bekräftigen die USA, dass sie nicht vor Waffengebrauch zurück- schrecken werden, um das Land von ‚Wilden‘ zu befreien: „ocupada por tribus salvajes“ (Matute 1993, 459). Dieses Beispiel veranschaulicht, dass die US-Amerikaner das Territorium als ver- meintliches Niemandsland betrachten, das sie sich zu eigen machen dürfen, ohne dass die Indi- genen einen Daseinsanspruch hätten, da sie nicht als Rechtssubjekte gelten.
58 3. Der gesellschaftliche Kontext Mexikos: Grenze, Transgression, Gewalt
nehmen können, 17 werden die Indigenen, die auf besagtem Gebiet leben, offiziell
zu salvajes und Störenfrieden der neu etablierten Ordnung deklariert. Daran zeigt
sich, dass die Grenzziehung einen politischen Prozess darstellt, der sich sozial auf
die Menschen auswirkt, die davon unmittelbar betroffen sind, weil sie – wie in
diesem Fall die Indigenen – ihren bisherigen Lebensmittelpunkt aufgeben müssen.
So lassen sich an der frontera norte sowohl Ausgrenzung, Trennung als auch
Verbindungen sprachlicher und kultureller Art exemplarisch nachzeichnen. Die
Grenzverlegung und damit einhergehenden Veränderungen wirken bis heute im
kulturellen Gedächtnis Mexikos und jenem der USA fort, denn Musik, Kunst,
Literatur und soziale Bewegungen beziehen sich auf dieses Ereignis. 18 Da sie
mitunter die Grenzregion und ihre Bewohner metaphorisch zum stereotypen ‚An-
deren‘ deklarieren, zeigt sich, dass am Beispiel der Grenze diskursiv aufschluss-
reich Fragen der Identität und Alterität thematisiert werden.
Die südliche Grenze Mexikos, frontera sur 19, entwickelt sich etwa zeitgleich,
jedoch auf unterschiedliche Weise: Im Süden lassen sich Mitte des 19. Jahrhun-
derts als Reaktion auf die von der Regierung geschaffenen Anreize vor allem
deutsche Besitzer guatemaltekischer Kaffeeplantagen nieder, die billig Land er-
werben und den Anbau ausweiten (vgl. De Vos 2002, 53). Bereits seit Jahrhunder-
ten wird in der Region ein reger Austausch betrieben, über die kolonial errichteten
politischen Grenzen hinaus. So ist es nicht verwunderlich, dass sich nach der offi-
ziellen Grenzziehung im Jahre 1882 viele Guatemalteken regelmäßig auf die me-
xikanische Seite begeben, um dort als Tagelöhner auf den Plantagen zu arbeiten
(vgl. ebd., 52-57). Von Beginn an ist die Region also zum einen von transnationa-
ler Bewegung geprägt, zum anderen zeichnet sich aber eklatant eine Grenze zwi-
schen den sozialen und ethnischen Klassen ab (vgl. ebd., 58). 20 Aus diesem Grund
17
In Kalifornien werden jedoch im Zuge des Land Acts viele der mexikanischen Landbesitzer
enteignet, einige kehren nach Mexiko zurück, und der gesellschaftliche Einfluss dieser Gruppe in
den USA minimalisiert sich bis 1890 erheblich (vgl. Erazo Heufelder 2018, 40, 45).
18
Im Zeitraum nach 1848 wird die Grenze im mexikanischen Diskurs zum Inbegriff der „ruptu-
ra, la mutilación territorial, la herida abierta o la fractura. A estas imágenes subyace un senti-
miento de impotencia“ (Valenzuela Arce 2003, 33f., Hervorhebung i. O.). Der Autor legt dar,
wie sich das Bild der Grenzregion und die damit verbundenen Metaphern im Laufe der Jahrzehn-
te, analog zu soziokulturellen Entwicklungen der beiden Länder, beidseitig der Grenze verän-
dern. Eng verknüpft mit Fragen der Identität, verkörpern die Grenzregion und ihre Bewohner
dabei häufig den ‚Anderen‘. Während in Mexiko der pocho und pachuco als US-amerikanisierter
‚Verräter‘ gilt, verwendet man in den USA despektierlich die Bezeichnungen greaser oder wet-
backs für die Mexikaner, die über die Grenze kommen. Ende des 20. Jahrhunderts wird eine
Konzeption der Grenzregion als Zwischenraum beliebt, als transnationales Mexamérica (vgl.
ebd., 39f., 46f.), vgl. dazu Fußnote 43 des vorliegenden Kapitels.
19
Im Süden teilt Mexiko eine Grenze von insgesamt 1.149 Kilometern mit Guatemala (956 km)
und Belize (193 km) (vgl. Villafuerte Solís 2017, 20). Die Bundesstaaten Chiapas, Tabasco,
Campeche und Quintana Roo bilden die mexikanische Seite der Grenze, in der Forschung wird
Yucatán meist ebenfalls zur Grenzregion hinzugezählt (vgl. Villafuerte Solís und García Aguilar
2005, 129).
20
Die Grenzprozesse vollziehen sich zugunsten der Eliten, und perpetuieren neben sozialen
Unterschieden die Dichotomie zwischen ‚Zivilisation‘ und ‚Barbarei‘. Damit unterscheidet sich
diese Form der Erschließungsgrenze vom Turnerschen frontier-Mythos (vgl. Bernecker 2005,
13f.). Zum frontier-Konzept vgl. Kapitel 2.1.1 der vorliegenden Arbeit.3.1 Historische Grenzziehungen 59
herrscht in der Forschungsliteratur zur Südgrenze Mexikos das Bild einer Region
vor, die in sich diverse Grenzen vereint. 21
Die Beispiele der frontera norte und der frontera sur zeigen, dass das unabhän-
gige Mexiko von Anfang an eine wichtige geopolitische Position einnimmt. Die
Grenzen und die unterschiedlichen Akteure, die sich um sie herum positionieren,
machen globale Entwicklungen und Konfliktlinien sichtbar. Die USA bemühen
sich bereits frühzeitig darum, mit Mexiko zu kollaborieren und plädieren mit der
Monroe-Doktrin, die semantisch eine Verbundenheit der amerikanischen Länder
suggeriert, für eine regionale Kollaboration unter Vormachtstellung der USA. 22
Auch im 20. Jahrhundert, während des Zweiten Weltkriegs und des Kalten Krie-
ges nutzen die USA die geographisch vorteilhafte Position Mexikos, 23 wobei bis
heute die jeweilige innenpolitische und wirtschaftliche Situation der USA die
Mexiko gegenüber verfolgte Außenpolitik prägt. 24 Ohne zu bestreiten, dass die
Beziehung zu den USA mitgedacht werden muss, wenn es um wirtschaftliche
Entwicklungen, den Drogenhandel und die aktuelle Situation der Gewalt geht, löst
sich das vorliegende Kapitel von der territorialen Beschränkung auf die frontera
norte und frontera sur, da es erst diese Vorgehensweise möglich macht, die viel-
fältigen Grenzen innerhalb Mexikos herauszuarbeiten.
3.1.2 Das 20. Jahrhundert: ‚Dictablanda‘ und Dictadura
Im postrevolutionären 25 Mexiko des 20. Jahrhunderts dominiert das PRI-Regime.
1929 gelangt mit dem Partido Nacional Revolucionario jene Partei an die Macht,
die über siebzig Jahre hinweg ihre Position als herrschende Kraft aufrechterhalten
wird und nach zwei Namensänderungen seit 1946 als Partido Revolucionario
Institucional (PRI) fortexistiert. Nachdem 1920 die kriegerischen Phase der mexi-
kanischen Revolution endet, setzt zunächst ein Prozess der Konsolidierung ein
(vgl. Garciadiego und Kuntz Ficker 2017, 563). Die Partei wandelt sich von einer
21
Vgl. z. B. „[Las] múltiples dimensiones de las fronteras aluden al territorio y los territorios, a
la cultura y las culturas, a las comunidades de identificación, a las formas políticas y sociales, a
las cuestiones de género y etnicidad, así como a las de clase social“ (Fábregas Puig 2005, 32);
„[L]a diversidad de las fronteras que se entrecruzan en este espacio“ (Castillo und Kauffer Mi-
chel 2002, 12).
22
Während die Monroe-Doktrin sich an einer panamerikanischen Vorstellung der Western Hemi-
sphere orientiert und dafür plädiert, gegen die europäischen Kolonialmächte zu kooperieren, ist
sie ein früher Versuch der USA, die politische und wirtschaftliche Vormachtstellung in Amerika
zu erlangen (vgl. Kaltmeier 2013, 2f.).
23
Vor allem während des Kalten Krieges unterstützen die USA in Lateinamerika rechte Regie-
rungen und Aufstände, um linke Regierungen zu bekämpfen (vgl. Nolte 2017, 266). Diese Per-
spektive der USA, die Politik Lateinamerikas unmittelbar mit den eigenen Interessen in
Verbindung zu setzen, ist auch heute noch aktuell (vgl. Nolte 2018, 3).
24
Exemplarisch zeigt sich dies an der Diskrepanz zwischen dem Bracero Program, das rund um
den Zweiten Weltkrieg mexikanische Arbeitskräfte in die USA holen soll, und der ab 1953
verfolgten Operation Wetback, die ihren Fokus auf eine massive Abschiebung setzt (vgl.
Henderson 2011, 608ff.). Auch während der US-amerikanischen Wirtschaftskrise 2008/2009
werden vor allem lateinamerikanische Beschäftigte in den USA entlassen und abgeschoben (vgl.
Martínez Cuero 2014, 139).
25
Zur Mexikanischen Revolution, vgl. Garciadiego und Kuntz Ficker (2017).60 3. Der gesellschaftliche Kontext Mexikos: Grenze, Transgression, Gewalt militärischen zu einer zivilen Institution, die die unterschiedlichen sozialen Akteu- re unter ihre Vorherrschaft stellt (vgl. Piñeyro 2015, 30). Um die militärischen und paramilitärischen Gruppierungen zu kontrollieren, wird der Präsident zum Obers- ten Befehlshaber über die Streitkräfte ernannt und ist dies bis heute. 26 Zudem versucht man, die marginalisierten Bevölkerungsgruppen, die für die Revolution gekämpft haben, in die Nation zu integrieren und die Herrschaft der neuen Regie- rung zu legitimieren. Dazu werden diskursiv Gemeinsamkeiten evoziert, mit de- nen sich eine einheitliche kulturelle Identität der mexicanidad begründen soll (vgl. Pérez Montfort 2003, 150f.; Borsò 1994). Eine wichtige Rolle spielt dabei das Konzept des mestizaje, das sich zu Beginn des 20. Jahrhunderts von einem rassen- ideologischen zu einem kulturpolitischen Modell wandelt und als solches seit Beginn des 20. Jahrhunderts eine zentrale Rolle im offiziellen Identitätsdiskurs spielt (vgl. Borsò 1994, 115, 124). An den Schriften der Vertreter des Indigenis- mus wie Forjando Patria (1916) von Manuel Gamio oder José Vasconcelos’ Raza cósmica (1929) zeigt sich jedoch, dass die Indigenen weiterhin als das ‚Andere‘ gelten (vgl. Leinen 2000, 275). Die gesellschaftspolitischen und wirtschaftlichen Entwicklungen ab der Mitte des 20. Jahrhunderts sind davon geprägt, dass die mexikanische Regierung sich international darum bemüht, als moderner Staat wahrgenommen zu werden (vgl. Loaeza 2017, 654). Dies gelingt ihr, denn zwischen den 1940ern und 1960ern befindet sich die mexikanische Wirtschaft in einer Phase der Stabilität und des Wachstums – bezeichnet als milagro mexicano. Die PRI-Regierung do- miniert als hegemoniale Macht das nationale Geschehen (vgl. González 2019, 40). Das politische System behält einen demokratischen Anschein, da Wahlen abgehal- ten werden, es aufgrund der verbotenen Wiederwahl eine regelmäßige personale Fluktuation gibt und vereinzelte Oppositionsparteien zugelassen werden (vgl. ebd., 41). Allerdings verlaufen die Wahlen nicht einwandfrei, 27 und die Re- gierung kooperiert mit regionalen caciques, die bei den Wahlen Stimmen für die PRI beschaffen und dafür Privilegien erhalten (vgl. ebd., 141f.). Der Staat ist zent- ralistisch organisiert und beruht auf einem asymmetrischen Verhältnis zwischen dem autoritären Präsidenten als „jefe de gobierno“ gegenüber einer schwachen Legislative und Judikative (vgl. Loaeza 2017, 654f.). Der Zentralstaat hat das Gewaltmonopol inne, schaltet Gewerkschaften gleich, versucht Oppositionelle ins System zu integrieren und geht mit Gewalt gegen Aufständische vor (vgl. McCormick 2018, 263; González 2019, 41). Als sich in den 1960er Jahren, vergleichbar mit Europa und den USA, in Mexi- ko eine studentische Protestbewegung formiert, positioniert sie sich vor allem gegen das autoritäre System des Präsidenten Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970) und plädiert für eine partizipative Demokratie. Die mexikanische Regierung, die das internationale Großereignis der Olympischen Spiele 1968 in Mexiko stattfinden 26 Dies ist in Artikel 89 der mexikanischen Verfassung geregelt (vgl. Cámara de Diputados 2019). 27 Beispielsweise lässt die Comisión Federal Electoral im Jahre 1976 nur einen Kandidaten zur Präsidentschaftswahl zu (vgl. Rodríguez Kuri und González Mello 2017, 734).
3.1 Historische Grenzziehungen 61 lassen will, reagiert repressiv und setzt gezielt Polizei und Militär ein, um die Proteste niederzuschlagen (vgl. Loaeza 2017, 681). Am 2. Oktober, wenige Tage vor den Olympischen Spielen, versammeln sich Studierende auf der Plaza de las Tres Culturas 28, als verdeckte Scharfschützen des Batallón Olimpia unvermittelt das Feuer eröffnen und das Militär daraufhin die Demonstration gewaltsam auflöst (vgl. ebd., 691). 29 Da die damalige Regierung eine Aufklärung der Ereignisse verhindert, kann bis heute die genaue Zahl der Toten nicht präzise bestimmt wer- den. 30 Hunderte der Protestierenden befinden sich noch jahrelang in Haft (vgl. ebd., 692). Das sog. Massaker von Tlatelolco (La Masacre de Tlatelolco) bildet einen wichtigen negativen Referenzpunkt des kollektiven Gedächtnisses in Mexiko, an dem das fehlende Vertrauen der Bevölkerung in die staatlichen Institu- tionen und das PRI-Regime zum Ausdruck kommt. Die repressive Vorge- hensweise gegen Oppositionelle und Demonstranten rund um 1968 entkräftet das Selbstbild der Regierung als demokratische Vertretung einer vermeintlich homo- genen Nation (vgl. auch Borsò 2012b, 68). Dennoch finden ab dem 12. Oktober die Olympischen Spiele statt und wenig später, im Jahre 1970, wird die Fußball-WM in Mexiko abgehalten. Der fehlende internationale Druck erleichtert es dem Regime, hart gegen seine Gegner vorzuge- hen. Als der ehemalige Innenminister Luis Echeverría, der bereits maßgeblich an den Ereignissen vom 2. Oktober 1968 beteiligt ist, 1970-1976 das Amt des Präsi- denten übernimmt, führt er die repressive Politik fort (vgl. Rodríguez Kuri und González Mello 2017, 729, 731). 31 Bis heute werden die Ereignisse innerhalb des 28 Auf der Plaza de las Tres Culturas vereinen sich drei Epochen mexikanischer Geschichte: Bereits in der prähispanischen Zeit nimmt der Ort als Tempel und Marktplatz eine wichtige Rolle ein; die Spanier errichten nach der Conquista auf und mit den Ruinen die Iglesia de Santiago Tlatelolco (vgl. Matos Moctezuma 2008, 39). In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wird das Gebiet im Zuge städteplanerischer Modernisierungen zum Standort der Hochhäuser des Conjunto Habitacional Nonoalco-Tlatelolco. Das Erdbeben von 1985 lenkt erneut die Aufmerk- samkeit auf Tlatelolco, da dort die eingestürzten Hochhäuser die Bewohner unter sich begraben. Die Plaza de las Tres Culturas ist ein bedeutsamer Erinnerungsort Mexikos, den bis heute diver- se Protestbewegungen aufsuchen, um wirtschaftliche und politische Probleme anzuklagen. 2007 wird mit dem Memorial del 68 erstmals ein Museum eröffnet, das sich einem Ereignis nach der Revolution widmet. Hier offenbart sich die besondere Symbolkraft der Plaza de las Tres Cultu- ras, wenn sich die Frage nach der historischen Deutungsmacht stellt. Vgl. Allier Montaño (2018, 217, 219, 225, 234f.). 29 Diese paramilitärischen Akteure gehören zu den sog. porros, die der Staat seit den 1950ern einsetzt, um soziale Bewegungen zu unterwandern. Da sie in einer Grauzone agieren und nicht offiziell als staatliche Akteure zu identifizieren sind, entlasten sie das öffentliche Bild von Poli- zei und Militär (vgl. Pansters 2018, 44f.). Die Opfer können zudem die erlittene Gewalt nicht offiziell anklagen. Dass das Problem der porros noch immer aktuell ist, zeigt sich zuletzt im Sommer 2018 bei Protesten an der UNAM (vgl. Redacción BBC News Mundo 2018). 30 Es ist nicht geklärt, wie viele Menschen an diesem Tag sterben. Während offizielle Zahlen von 30 Toten sprechen, reichen heutige Schätzungen von mehreren hundert bis zu über 1000 Toten (vgl. Allier Montaño 2018, 218; Borsò 2012b, 70). 31 Am Jueves Corpus 1971 werden erneut Studentenproteste in Mexiko-Stadt blutig niederge- schlagen (vgl. Rodríguez Kuri und González Mello 2017, 731). Diese Ereignisse sind nicht annä- hernd so präsent wie die von 1968, werden jedoch vom Oscar-prämierten Spielfilm Roma (Cuarón 2018) ins kulturelle Gedächtnis gerufen, vgl. z. B. Nájar (2018).
62 3. Der gesellschaftliche Kontext Mexikos: Grenze, Transgression, Gewalt offiziellen wie wissenschaftlichen Diskurses sehr unterschiedlich bewertet. Einige Autoren übernehmen etwa die offizielle Perspektive, dass Mexikos Regierung eine lateinamerikanische ‚Sonderrolle‘ eingenommen habe – und bezeichnen das Re- gime als sog. dictablanda, in Abgrenzung zur dictadura. 32 Die meisten Beiträge erwähnen zwar, dass Oppositionelle unterdrückt und verfolgt wurden, oftmals bezeichnen sie dies aber lediglich als represión (z. B. Rodríguez Kuri und González Mello 2017; González 2019). Da dieser Begriff suggeriert, der Staat sei einmalig und defensiv gegen die Oppositionellen vorgegangen, laufen die Autoren Gefahr, die Ereignisse verkürzt wiederzugeben. So stellen sie zum Beispiel das Massaker von Tlatelolco meist als tragischen Einzelfall dar, der aus einer ansons- ten friedlichen Gesellschaftsordnung heraussteche. 33 Diese Sichtweise wird in den letzten Jahren jedoch verstärkt in Frage gestellt und durch den Begriff der sog. guerra sucia ersetzt (vgl. Scherer und Monsiváis 2004; Illades und Santiago 2014; Rangel Lozano und Sánchez Serrano 2015; Pensado und Ochoa 2018). 34 Obwohl dieser Terminus nicht unproblematisch ist, stellt seine Verwendung innerhalb der Erinnerungspolitik Mexikos ein wichtiges Statement dar, setzt er doch die Aktivitäten der mexikanischen Regierung in einen lateinamerikanischen Kontext und parallelisiert sie mit denen der Militärdikta- turen, beispielsweise in Argentinien oder Chile, die systematisch gegen Op- positionelle vorgingen. 35 Auf vergleichbare Weise kommt es auch in Mexiko im 20. Jahrhundert zu erheblichen Menschenrechtsverletzungen, wobei der Staat sich einer Taktik des Verschwindenlassens, der illegalen Gefängnisse und sog. vuelos de la muerte bedient (vgl. Rangel Lozano 2015, 16). Die als guerra sucia bezeich- nete Phase beginnt bereits in den 1940ern und reicht, mit ihrem Höhepunkt in den 1960ern und 70ern, bis in die 1980er hinein (vgl. Pensado und Ochoa 2018a, 10; 32 Gillingham und Smith verwenden diesen Terminus in Dictablanda: Politics, Work, and Cul- ture in Mexico, 1938–1968, um die PRI-Regierung als eine Form des „soft authoritarian regime“ zu bezeichnen. Bereits etymologisch ist dieser Neologismus aber irreführend, da er das Verb „dictar“ (von der Real Academia Española 2014, 794 definiert als „Dar, expedir, pronunciar leyes, fallos, preceptos“) mit dem Adverb „blando“ („Blandamente, con suavidad“, ebd. 316) verbindet. Dadurch geht jegliche Semantik eines autoritären Regimes verloren, wie sie im spani- schen dictadura, von lat. dictatura, enthalten ist (vgl. ebd., 794). 33 Dies zeigen Pensado und Ochoa (2018b, 275f.), deren Sammelband den Blick über 1968 und eine männliche, urbane Perspektive hinaus eröffnet. 34 Die Real Academia Española (2014, 1141) defininiert guerra sucia wie folgt: „Conjunto de acciones que se sitúan al margen de la legalidad y combaten a un determinado grupo social o político“. Es handelt sich also nicht um einen ‚regulären‘ Krieg, sondern um Aktionen, die in einer legalen Grauzone oder illegal vollzogen werden. Der Begriff versucht, die fehlende Ach- tung der Menschenrechte und die Überschreitung der Grenzen ‚regulärer‘ Kriegsführung auszu- drücken (vgl. Crandall 2014, 6f.). Problematisch ist, dass die Bezeichnung eines Krieges als ‚schmutzig‘ stark semantisch wertend ist und die Dichotomie rein vs. unrein, zivilisiert vs. bar- barisch perpetuiert. Außerdem umfasst der Begriff eine breite Spanne, Andrés Manuel López Obrador bezeichnet beispielsweise Medienkampagnen gegen ihn in den 2000er Jahren als guerra sucia (vgl. CNN Español 2018). Diese Aussage wirkt in Hinblick auf die Verschwundenen entdifferenzierend. Um die semantische Problematik und begriffliche Unschärfe zu vermeiden, ist es wichtig, die Taten aufzuarbeiten und konkret zu benennen, um das genaue Ausmaß der staatlichen Gewalt gegen Oppositionelle fassen zu können. 35 Vgl. dazu Allier Montaño und Crenzel (2016).
3.1 Historische Grenzziehungen 63 Pansters 2018, 43). Neben den bereits erwähnten Eingriffen in die Studentenpro- teste im urbanen Raum, agiert der Staat vor allem in ländlichen Regionen (vgl. Pensado und Ochoa 2018a, 5). Dort leben trotz des wirtschaftlichen Aufschwungs weiterhin viele Menschen in Armut und sind der Waffengewalt der caudillos aus- gesetzt, was die soziale Kluft zwischen Zentrum und Peripherie deutlich macht (vgl. Pansters 2018, 40, 42). 36 In diesen Gebieten formieren sich teils bewaffnete subversive Gruppen, die heterogene Interessen sozialer und politischer Art verfol- gen (vgl. Pensado und Ochoa 2018a, 3f.). Der Staat geht mit Gewalt gegen die Aufständischen vor und legitimiert das militärische Vorgehen mit dem Plan de Defensa Nacional DN-II, der bis heute vorsieht, das Militär für die innere Sicher- heit einzusetzen (Piñeyro 2015, 33f.). Indem die Oppositionellen zu Feinden der inneren Ordnung deklariert werden, gelten sie nicht mehr als heterogene, soziale Bewegung sondern als ‚Kriminelle‘ (vgl. ebd., 36; Mendoza García 2015, 112). Dennoch bewertet die Mehrheit der mexikanischen Bevölkerung in den 1940er- 60er Jahren die Geschehnisse nicht als guerra sucia, da die sich auf die ländlichen Regionen beschränkenden illegalen Gefängnisse eine geringe Sichtbarkeit haben und nicht alle Bürger von der Gewalt betroffen sind (vgl. Rangel Lozano 2015, 52, 64). 37 Um die Verantwortung des Staates 2001, dreißig Jahre später, öffentlich anzu- erkennen, ordnet der Präsident Vicente Fox (2000-2006, PAN) an, die Geheim- dienst-Archive zu öffnen (vgl. Rangel Lozano und Sánchez Serrano 2015, 273). Doch die zur Aufarbeitung gebildete Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Polítícos del Pasado (FEMOSPP) wird nach kurzer Aktivität aufgelöst, ohne Erfolge aufweisen zu können. Nichtstaatliche Menschenrechtsgruppierungen und Wissenschaftler kritisieren, dass es sich um eine staatliche Institution und nicht um eine unabhängige Wahrheitskommission handelte. Zudem wird der von der FEMOSPP verfasste Bericht nie offiziell veröffentlicht. 38 Die erhoffte Aufklärung 36 „Guerrero, Morelos, Oaxaca y estados circunvecinos, o […] Chihuahua, Hidalgo y Baja Cali- fornia“ (Piñeyro 2015, 39). Es handelt sich um Bundesstaaten, die auch heute noch durch hohe Gewaltraten auffallen. Dabei wird eine Kontinuität des wirtschaftlichen und sozialen Ungleich- gewichts zwischen dem urbanen Zentrum und besagten Regionen deutlich. 37 Da wenige Quellen erhalten und viele der Dokumente nicht öffentlich zugänglich sind, ist die Zahl der Opfer nicht eindeutig bestimmbar, für die Phase 1964-1982 liegen Schätzungen bei „approximately seven thousand people tortured, at least three thousand political prisoners, and more than three thousand disappeared or killed“ (McCormick 2018, 256). Nähme man die 1940er und 50er Jahre in die Rechnung hinzu, müssten die Zahlen entsprechend nach oben korrigiert werden. 38 Ein Entwurf des Berichts gelangt dennoch in Umlauf, da er der Website The National Security Archive zugespielt wird, vgl. The National Security Archive (2006). Der Bericht bestätigt, dass der mexikanische Staat und das Militär mit Mitteln der guerra sucia gegen Oppositionelle vor- gegangen sind und dabei die Menschenrechte missachtet haben (vgl. Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado 2005, 1). Solange der Staat diesen Bericht nicht offiziell akzeptiert, bleibt jedoch die Anerkennung der Opfer und die Verurteilung der Täter rein hypothetisch. Einen Sonderfall stellt der des Aktivisten Rosendo Radilla Pacheco aus Guerrero dar, der in den 1970er Jahren verschleppt wird. Im Jahre 2009 erklärt die Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) den mexikanischen Staat für schuldig, „por el delito de desapa- rición forzada“ und schafft damit einen Präzedenzfall (vgl. Sánchez Serrano 2015, 207).
64 3. Der gesellschaftliche Kontext Mexikos: Grenze, Transgression, Gewalt
und offizielle staatliche Anerkennung ist, von Einzelfällen abgesehen, bis zum
heutigen Tag ausgeblieben (vg. Márquez und Meyer 2017, 780). Die Archive
werden im Jahre 2015 unter der wiedergewählten PRI-Regierung sogar erneut für
den öffentlichen Zugang gesperrt (vgl. Pensado und Ochoa 2018, XII). Hier zeigt
sich, dass in Mexiko noch immer umstritten ist, wie die Vergangenheit gedeutet
werden soll.
In den 1970er Jahren beginnt der mexikanische Staat außerdem, den Anbau
von Marihuana und Schlafmohn im sog. Triángulo Dorado (Sinaloa, Durango,
Chihuahua) zu bekämpfen (Aviña 2018, 135). Alexander Aviña verdeutlicht die
sozialen Auswirkungen dieser Operationen:
These militarized counternarcotics programs – including the novel use of dangerous
defoliant herbicides sprayed from helicopters and airplanes – resembled, in practice, what
counterinsurgent military units had practiced in Guerrero […]: brutal attacks on rural
highland peasant communities that left behind a trail of tortures, razed homes, disappeared
campesinos, destroyed agricultural harvest, and environmental damage.
Two Mexican ‚wars‘, one ‚dirty‘ and the other against drugs, and the multiple ways in
which they intimately intersect historically during the 1970s, reveal […]: they were wars
directed against poor people intended to reassert state control. For the PRI, the boundary
between drug control and political control, between popular political protest and drug
criminality, became usefully permeable (ebd., 135f.).
Dieses Zitat illustriert, dass das Militär mit den gleichen Mitteln gegen Oppo-
sitionelle und gegen den Drogenanbau vorgeht. Das in der sog. Operación Cóndor
ab 1975 eingesetzte Militär übt starke Gewalt aus, ohne etwaige ökologische oder
menschliche Verluste zu berücksichtigen. Auch hier sind die Kleinbauern die
Leidtragenden, da sie aufgrund der zerstörten Existenzgrundlage ihre Heimatorte
verlassen müssen, während die transnational agierenden Drogenbosse nicht nen-
nenswert beeinträchtigt werden (vgl. Illades und Santiago 2014, 53). Daher stellt
sich die Frage, wie effektiv diese Form der militärischen Einsätze ist, die zwar die
Marihuana-Felder vernichtet, zugleich aber regionale Gemeinschaften dauerhaft
schädigt und das Gefälle zwischen Zentrum und Peripherie verfestigt. Da in Me-
xiko der angestiegene Drogenkonsum national negative Schlagzeilen macht, ist es
der Regierung leichter möglich, ihre militärische Gewalt zu rechtfertigen
(vgl. Aviña 2018, 135). Die Frage nach etwaigen Menschenrechtsverletzungen
während der Einsätze erscheint vor diesem Hintergrund nicht dringend. Die oppo-
sitionellen Akteure in den betroffenen Bundesstaaten können problemlos des Dro-
genanbaus bezichtigt und kriminalisiert werden. Dies erklärt die zeitlichen und
personalen Überschneidungen im Kampf gegen Oppositionelle und im Kampf
gegen den Drogenanbau (vgl. Illades und Santiago 2014, 53).
In den 1980er Jahren spitzen sich die politischen, sozialen und wirtschaftlichen
Konflikte zu, die auch im Zentrum sichtbarer werden: Ein weiterer Referenzpunkt
des kulturellen Gedächtnisses ist das Erdbeben am 19. September 1985 in Mexi-
ko-Stadt, Michoacán, Guerrero, Jalisco und Colima, bei dem zwischen 10.000 und
60.000 Menschen sterben (vgl. Márquez und Meyer 2017, 752). Die fehlenden
Hilfeleistungen der Regierung nach dem Erdbeben führen dazu, dass sich soziale3.1 Historische Grenzziehungen 65
Spaltung und Misstrauen verschärfen (vgl. ebd., 752). 39 Vor dem Hintergrund
einer mangelhaften staatlichen Informationspolitik nehmen Intellektuelle wie
Carlos Monsiváis eine entscheidende Rolle dabei ein, die hier erwähnten Ereignis-
se aufzuarbeiten (vgl. Borsò 2012b, 70ff.). 40 Beispielsweise gelingt es Elena Poni-
atowska in La noche de Tlatelolco (1971) im Kontrast zur offiziellen Bericht-
erstattung die Perspektive der Opfer von 1968 hörbar zu machen. Und José
Agustíns dreiteilige Tragicomedia Mexicana enttarnt ironisch die Kontinuität der
Gewalt, auf der das vermeintliche Gleichgewicht der mexikanischen Gesellschaft
beruht. 41 An den hier genannten Texten zeigt sich exemplarisch, dass die Kultur-
schaffenden eine wichtige diskursive Funktion einnehmen, da sie, oftmals auf der
Schwelle zwischen Fiktionalität und Faktualität, gesellschaftspolitische Themen in
Mexiko öffentlich thematisieren. In der Romananalyse wird zu zeigen sein, inwie-
fern die acht ausgewählten, zeitgenössischen mexikanischen Romane die Kon-
fliktlinien des kollektiven Gedächtnisses aufgreifen, wie sie die Vergangenheit
bewerten und ob sie die nicht aufgearbeiteten Menschenrechtsverletzungen sicht-
bar machen.
3.1.3 An der Schwelle zum 21. Jahrhundert: „Two-Speed Economy“
Um einen Ausweg aus der politischen und wirtschaftlichen Krise bemüht, initiie-
ren die Präsidenten De la Madrid (1982-1988) und Salinas (1988-1994) wirt-
schaftliche Transformationen, die sich vom Protektionismus abwenden, den Markt
neoliberal in Richtung USA öffnen und staatliche Betriebe privatisieren (vgl.
Vidal 2014, 11). Die bereits seit dem bilateralen Programa de Industrialización
Fronteriza (1965) in der nördlichen Grenzregion Mexikos installierten sog.
maquiladoras werden nach Inkrafttreten des NAFTA-Freihandelsabkommens mit
den USA und Kanada 1994 ausgebaut. 42 Seit den 1990er Jahren exemplifiziert die
39
Am 19. September 2017 erschüttert erneut ein starkes Erdbeben Mexiko, bei dem über 200
Menschen sterben. Auch hier beklagen Menschenrechtsorganisationen eine mangelnde staatliche
Unterstützung für die Opfer (vgl. Mancera und Ferri 2018).
40
Bis zu seinem Tod im Jahre 2010 ist Monsiváis eine prägende Figur des mexikanischen Dis-
kurses. Dem Thema der guerra sucia widmet er sich mit Julio Scherer García in Los patriotas.
De Tlatelolco a la guerra sucia (2004). Scherer wertet die neu geöffneten Geheimdienst-Archive
aus, macht die Verantwortung des Staates und die Geschichten der Opfer sichtbar (vgl. ebd., 7-
139). Der Begleit-Essay Monsiváis’ stellt die These einer Kontinuität der Gewalt in Mexiko auf
(vgl. ebd., 141-199). Bereits der Titel verrät ihre deutliche Positionierung („guerra sucia“). An
diesem Buch zeigt sich das Engagement der beiden Intellektuellen, die die Archive dem Publi-
kum zugänglich und verständlich machen wollen und damit die Opfer ins kulturelle Gedächtnis
integrieren.
41
So bezeichnet er beispielsweise die Regierung von Díaz Ordaz als Periode einer „paz social
mediante macanazos“ (Agustín 1991, 227). Die zunächst harmonische Semantik des öffentlichen
Friedens wird gebrochen, da die „macanazos“ metonymisch auf die Gewalt verweisen, mit der
die Ordnung sich aufrechterhält. – Vgl. auch Agustín (1992; 1998).
42
Die USA sichern sich mit dem North American Free Trade Agreement, span. Tratado de Libre
Comercio de América del Norte, die eigene wirtschaftliche Vormachtstellung nach Ende des
Kalten Krieges. Die mexikanische Regierung erhofft sich ein Wirtschaftswachstum und den
Anschluss an die Länder der Ersten Welt (vgl. Oropeza García 2014, 13, 15f.). Während Waren
und Kapital zirkulieren, sieht das NAFTA-Abkommen diese Freizügigkeit nicht für Personen vor
(vgl. Martínez Cuero 2014, 134, 136). NAFTA hilft den USA sogar, die Migration einzudäm-66 3. Der gesellschaftliche Kontext Mexikos: Grenze, Transgression, Gewalt
Forschungsliteratur am Beispiel des gemeinsamen NAFTA-Raumes die Entwick-
lungen des globalisierten Kapitalismus und zeigt, wie sich die Konzeption der
‚Grenze‘ an der Schwelle zum 21. Jahrhundert aufgrund transnationaler Prozesse
ausdifferenziert. 43 Auf Druck der Trump-Administration erarbeiten Mexiko, Ka-
nada und die USA ab Ende 2018 ein Nachfolgeabkommen, das unter dem Namen
USMCA im Juli 2020 in Kraft tritt (vgl. Swanson und Tankersley 2020). Bis heute
unterscheidet sich Mexiko durch seine engen wirtschaftlichen Beziehungen mit
den USA und Kanada von den südamerikanischen Ländern, die sich um eine von
den USA unabhängige Wirtschaftspolitik bemühen (vgl. Nolte 2017, 260, 269).
Doch während das maquiladora-System einerseits, gemessen am BIP, die öko-
nomische Entwicklung der nördlichen Bundesstaaten Mexikos verstärkt, wird es
andererseits bis heute dafür kritisiert, dass es eine nachhaltige Entwicklung behin-
dere – beklagt werden fehlende Umweltbestimmungen, schlechte Arbeitsbedin-
gungen und ein Kapitalfluss, bei dem die Gewinne in multinationale Unternehmen
fließen, anstatt die lokale Wirtschaft zu stärken (vgl. Fernández-Kelly 2012,
1111). 44 Innerhalb Mexikos begünstigt das NAFTA-Abkommen eine asymmetri-
sche Entwicklung, die sich in einer wachsenden Ungleichheit zwischen einzelnen
Regionen und innerhalb der Bevölkerung äußert. 45 Einige Forscher gehen von
einer wirtschaftlichen Spaltung in Gewinner und Verlierer aus, einer „two-speed
men, da die Arbeiter der maquiladoras kein US-amerikanisches Territorium betreten (vgl. Berndt
2004, 89f.). Die nach Mexiko importierten Rohmaterialien werden vor Ort verarbeitet, um das
fertige Produkt danach zollfrei zu exportieren. Die Firmen profitieren davon, dass sie niedrigere
Löhne zahlen können sowie weniger strenge Arbeitsschutzgesetze und Umweltregularien vorfin-
den (vgl. Fernández-Kelly 2012, 1110f.).
43
Sowohl die US-amerikanische als auch die lateinamerikanische postkoloniale Theorie bezieht
sich auf die US-mexikanische Grenzregion, um kulturelle Prozesse zu illustrieren, die sich jen-
seits von Binaritäten und einer homogenen Identität ansiedeln (vgl. García Canclini 2010, 286-
297; Bhabha 2004, 9f.; Soja 1996, 127-134). Soja (1996, 127-134) und Mignolo (2000, 227ff.)
berufen sich dabei auf das Werk Gloria Anzaldúas, das die Grenzen zwischen den Sprachen und
Genres überschreitet sowie die Gender-Binarität aufbricht. Vgl. Kapitel 2.1.4 der vorliegenden
Arbeit zur Problematik von Anzaldúas Vorgehen. Ebenso zweifelhaft ist, dass die Konzepte der
‚Hybridität‘ (Bhabha) und ‚Hybridisierung‘ (García Canclini) einen biologischen Terminus mit
einer problematischen Begriffsgeschichte auf kulturelle Prozesse übertragen.
44
Dass trotz Grenzüberschreitungen und partiellen Grenzverwischungen konkrete Ungleichhei-
ten bestehen bleiben, zeigt Lawrence Herzog (2003) exemplarisch am Raum Tijuana/San Diego.
Trotz des transnationalen Konsums bleibt die Spaltung zwischen Arm und Reich rigide (vgl.
ebd., 123f., 131) und die Grenzübergänge als militarisierte „spaces of conflict“ (ebd., 135f.)
rufen die trennenden Merkmale der Grenze in Erinnerung. Vgl. zudem Gewecke (2013, 277), die
darlegt, dass neben Prozessen der ‚Deterritorialisierung‘, wie sie in der Theorie propagiert wer-
den, literarische Texte der frontera norte viel eher Versuche einer ‚Reterritorialisierung‘ erken-
nen lassen, sich also auf den Raum und die trennenden Faktoren von Grenzen rückbesinnen.
45
Zeitgleich mit dem Inkrafttreten des Abkommens macht die EZLN 1994 mit Aufständen
international auf die Benachteiligung der südlichen, ländlichen Regionen aufmerksam sowie auf
die fehlende soziale Absicherung der ärmeren, meist indigenen Bevölkerung. Die mediale Reso-
nanz und der internationale Druck auf die Regierung münden in die 1996 beschlossenen Acuer-
dos de San Andrés, die die Rechte der Indigenen anerkennen. Dass die Regierung diese
Abkommen jedoch nicht als bindend erachtet, führt 2001 und 2006 zu weiteren Aufständen
(vgl. Márquez und Meyer 2017, 759, 778).Sie können auch lesen