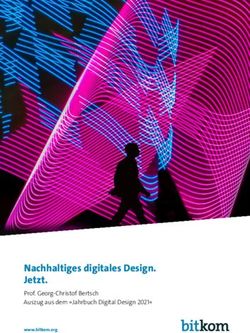Der Mehrwert des Interaction Design Werbung
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Der Mehrwert des Interaction Design in der Werbung Masterthesis im Studiengang: Gestaltung, Interaction Design vorgelegt von: Ricardo Göldner, Matrikelnummer: 598208 am 18. Juli 2014 an der HAWK Hildesheim Prüfer: Prof. Stefan Wölwer, Robert Jähnert 1
Der Mehrwert des Interaction Design
in der Werbung
Masterthesis im Studiengang: Gestaltung, Interaction Design
vorgelegt von: Ricardo Göldner, Matrikelnummer: 598208
am 18. Juli 2014 an der HAWK Hildesheim
Prüfer: Prof. Stefan Wölwer, Robert Jähnert
2Inhalt
Vorwort – 4 2.2. Interaktive Trends – 37
2.2.1. Soziale Verflechtung – 37
1. Definitionen – 5 2.2.2. Point of Sale – 38
2.2.3. Mobile – 39
1.1. Interaktion – 5 2.2.4. Digital Out-of-Home – 42
1.2. Design – 7 2.2.5. Geotargeting – 42
1.2.1. Prozess – 8 2.2.6. Smart-TV – 43
1.2.2. Form Follows Function – 9 2.2.7. Wearables – 43
1.3. Interaction Design – 10 2.2.8. Smart Car – 44
1.3.1. Methoden im Interaction Design – 10 2.2.9. Smart Home – 45
1.3.2. Soziale Interaktionsgestaltung – 12 2.3. Social Media – 46
1.3.3. Emotionale Interaktionsgestaltung – 12 2.3.1. Kuration – 46
1.3.4. User Interface Design – 13 2.3.2. Leitmedium – 47
1.3.5. User-Experience – 13 2.3.3. Qualität – 47
1.3.6. Vier-Phasen-Prozess – 16 2.3.4. Virale Videos – 48
1.4. Service Design – 17 2.3.5. Interaktive Videos – 48
1.5. Werbung – 20 2.4. Multichannel – 49
1.5.1. Werbeform – 21 2.4.1. Customer-Journey – 49
1.5.2. Psychologische Werbeziele – 22 2.4.2. Second Screen – 50
1.5.3. Methoden in der Werbung – 23 2.4.3. E-Mail – 50
1.5.4. Digitale Werbung – 25 2.4.4. Touchpoints – 51
1.5.5. Werbeagentur – 25
1.5.6. Konsument – 26 3. Moderne Werbung – 52
1.6. Emotion – 27
1.7. Verführung – 28 3.1. Das Unternehmen wird zum Medium – 52
3.2. Markenführung im 21. Jh. – 54
2. Digitale Revolution – 30
4. Mehrwert von Interaction Design
2.1. Digitale Trends – 31 in der Werbung – 55
2.1.1. Storytelling – 31
2.1.2. Unternehmensphilosophie – 32 4.1. Fazit – 58
2.1.3. Big Data – 33
2.1.4. Echtzeit – 33 5. Begriffserklärung – 59
2.1.5. Zielperson – 34
2.1.6. Personalisierung – 34 6. Quellen – 62
3Vorwort
Anfang des 20. Jh. entstand infolge des Computers und
der Digitalisierung die Digitale Revolution. Im Vergleich zu
der Industriellen Revolution, 200 Jahre zuvor spricht Kunst
historiker Heinrich Klotz von einer „Zweiten Moderne“ (Klotz,
1999, 22 – 24). Innerhalb von weniger als 10 Jahren geschah
ein Umbruch der Technik und (fast) allen Lebensbereichen.
Maschinen und Menschen leben so eng zusammen, wie noch
nie. Deshalb kommunizieren wir nicht mehr nur von Mensch
zu Mensch, sondern mit und über elektronische Geräte. Für die
reibungslose Kommunikation zwischen Mensch und Maschine
ist in den 1990er-Jahren die Designdisziplin „Interaction
Design“ geschaffen worden. Was verbirgt sich hinter diesen
Begriff ? Gibt es einen Zusammenhang zu dem, im selben Jahr
veröffentlichen Bestseller „Experience Economy“ (James / Pine,
1999)? Die Autoren stellen folgende Hypothese auf: „die Ver-
führung kann nur durch intelligent inszenierte Erlebniswelten,
welche alle fünf Sinne ansprechen, erfolgen.“
In meiner Arbeit untersuche ich die Methoden und
irkungsweisen der Kommunikation zwischen Mensch und
W
System. Ich untersuche, welche interaktiven Möglichkeiten die
Werbebranche durch den technologischen Fortschritt gewin-
nen kann und welche Konsequenzen diese Ergebnisse auf die
Werbetreibende haben.
Im Mittelpunkt meiner Arbeit steht inwieweit Interaction
Design klassische Werbung ergänzt, unterstützt und zuneh-
mend im Zentrum der Werbeaktivitäten steht.
41. Definitionen
1. 1. Interaktion
Claudio Baraldi, Giancarlo
Um die Bezeichnung „Interaction Design“ zu definieren, Gesamtsituation, das emergente System (Luhmann: 1984, 196 – Corsi, Elena Esposito:
betrachte ich zunächst die zwei Begriffe „Interaction“ (zu 199; 2002, 292). Somit ist die Kommunikation eine Einheit, die GLU: Glossar zu Niklas
Luhmanns Theorie sozialer
Deutsch: Interaktion) und „Design“ separat voneinander. Mitteilen, Informieren und Verstehen auf mehreren Seiten Systeme, Frankfurt/Main,
einschließt. Kommunikation beginnt deshalb logisch mit dem Suhrkamp, 1997
Interaktion beschreibt, ein „aufeinander bezogenes Verstehen und nicht, wie oft angenommen wird, mit einer Mit- Niklas Luhmann: Soziale
andeln zweier oder mehrerer Personen“ sowie die „Wechsel
H teilung (ebenda, 195 – 199). Systeme, Frankfurt/Main,
Suhrkamp, 1984
beziehung zwischen Handlungspartnern“ (Duden, 1990, 350
– 354). Bei der sozialen Interaktion handeln Individuen e iner Aufgrund dieser deutlichen Unterscheidung beschreibt Luh- Niklas Luhmann: Die
Wissenschaft der Gesell-
Gesellschaft oder einer Gruppe wechselseitig bedingt für mann dieses Verstehen, innerhalb dem kommunizierenden schaft, Aufl. 1, Berlin,
eine Abstimmung des Verhaltens oder für das konkrete Han- System als etwas anderes als ein psychisches Verstehen. Eine Suhrkamp, 1990
deln der Kooperations partner. Demzufolge ist Interaktion Mitteilung und eine Information werden unterschieden und zu- Niklas Luhmann: Einfüh-
ein Gesichtspunkt der sozialen Wechselwirkung. Das soziolo- geschrieben. Verstehen heißt nicht, die Gefühle, Motivationen rung in die Systemtheorie,
gische Verständnis von Kommunikation ergibt sich nicht aus oder Gedanken des Anderen zu erfassen (Luhmann, 1990, 25). Heidelberg, Carl-Auer-
Systeme, 2002
sich heraus, sondern wird durch die Nutzung der Medien und
deren ökonomischen und technischen Voraussetzung ge Luhmann bezieht sich mit der Dreiteilung auf die drei Dr. Konrad Duden, Duden
– Rechtschreibung der
steuert. In der Systemtheorie nach Niklas Luhmann entsteht ein Funktionen des sprachlichen Zeichens im Organon-Modell deutschen Sprache und
Interaktionssystem aus dem aufeinander bezogenen Verhalten Karl Bühlers sowie auf die Typologie der Sprechakte bei der Fremdwörter, 19.
Aufl., Bibliographisches
von Anwesenden. Der Kommunikationsbegriff beschreibt in Austin und Searle. Luhmann bezieht das, was Bühler als die Institut & F. A. Brockhaus
der soziologischen Systemtheorie u. a. die Kommunikation als Darstellungsfunktion der Sprache bezeichnete, auf die Selek- AG Mannheim, 1990
Informationsübertragung. Luhmann beschreibt Kommunika- tivität der Information, die Ausdrucksfunktion auf die Selekti-
tion als eine Einheit dreier S elektionen: „Information, Mittei- on der Mitteilung und die Appellfunktion auf die Erwartung,
lung und Verstehen“ (Luhmann, 1984, 203). Diese drei Bereiche dass verstanden wird und sich weitere Kommunikationen an-
bilden ein soziales System – so lange wie die Kommunikation schließen können („die E rwartung einer Annahmeselektion“)
stattfindet. Dadurch entsteht eine unbestimmte Menge von (Luhmann, 1984, 196 – 199; 2002, 292).
Möglichkeiten.
In diesem Zusammenhang verfügt die Kommunikation über
Auf einer Seite erfolgt die Selektion der Mitteilung, dies führt drei Merkmale: Anschluss, Auswahl und Fehlerkorrektur. Die
auf der anderen Seite zu der Selektion des Verstehens. Als se- weitere Prüfung, Bestätigung oder Korrektur kann nur durch
lektive Unterscheidung von Verstehen und Mitteilung entsteht sich selbst anschlussfähig bleiben (Luhmann, 1984, 195 – 199). In
im kommunizierenden System die Selektion der Information. Form von wechselseitigen Erwartungen und durch unbestimmt
Wenn etwas verstanden wird, wird zugleich die Tatsache an- vielen Möglichkeiten neuer Bezugspunkte schreitet eine Kom-
genommen, dass etwas mitgeteilt wurde. Die Kommunikation munikation voran. Unterbrochen wird die Kommunikation,
führt so von dem Ausgangspunkt einzelner Selektionen zweier wenn sich eine Selektion abgrenzen würde, z. B. wenn sie inad-
Seiten zu einer komplexeren, sich selbst stabilisierenden neue äquat, falsch oder ungewollt eintritt.
5Zum Symbolischen Interaktionismus wurden 1981 von Dem zu urteilen „zeigt“ zum einen der Handelnde sich Herbert Blumer:
Symbolic Interaction:
erbert Blumer Grundannahmen aufgestellt (Blumer, 1969).
H
selbst die Gegenstände an, auf die er sein Handeln ausrichtet, Perspective and Method,
Hierbei orientierte sich Blumer vor allem an den Überlegun- er macht sich auf die Dinge selbst aufmerksam, die eine Bedeu- Englewood Cliffs,
New Jersey, 1969
gen von George Herbert Mead (1863 – 1931) zur stammes tung für ihn haben; dieses „Anzeigen“ ist ein internalisierter
geschichtlichen (phylogenetischen) Bildung des Bewusstseins sozialer Prozess, in dem der Handelnde mit sich selbst interagiert Herbert Blumer: Der
und persönlichen (ontogenetischen) Entwicklung der Identität (Kommunikationsprozess mit sich selbst) (ebenda, 103). Und zum methodologische Stand-
ort des symbolischen
unter Verwendung einer gemeinsamen Sprache: „ Logisches anderen ist die Interpretation (der Bedeutung des Dinges) durch Interaktionismus, in:
Universum signifikanter Symbole“. Blumer war ein Schüler diesen Kommunikationsprozess ein formender, kein automati- Arbeitsgruppe Bielefelder
Soziologen (Hrsg.),
des Sozialphilosophen und frühen Sozialpsychologen George scher Prozess: Der Handelnde „sucht [...] die Bedeutungen aus, Alltagswissen, Interaktion
Herbert Mead: prüft sie, stellt sie zurück, ordnet sie neu und formt sie um“ und gesellschaftliche Wirk-
lichkeit, Bd. 1, Reinbek bei
. „Menschen handeln gegenüber Dingen auf der Grundlage (ebenda). Hamburg, Rowohlt, 1973
der Bedeutungen, die diese Dinge für sie besitzen.
. Die Bedeutung der Dinge entsteht durch soziale Interaktion. Durch den symbolischen Interaktionismus lassen sich kom-
. Die Bedeutungen werden durch einen Prozess; „den inter- plexe gesellschaftliche Vorgänge auf seine jeweils kleinste
pretativen Prozess“ verändert, in dem selbstreflexive Einheit, das Individuum herunterbrechen. Dabei ist immer
Individuen symbolisch vermittelt interagieren. der Verlauf eines Prozesses von gegenseitig interpretierenden
. Menschen erschaffen die Erfahrungswelt in der sie leben. Interaktionen das Ergebnis. In Bezug auf das menschliche Zu-
. Die Bedeutungen dieser Welten sind das Ergebnis von Inter- sammenleben ist die Interaktion eine Wechselbeziehung, wo-
aktionen und werden durch die von den Personen jeweils bei sich mind. zwei Personen in ihrem Verhalten aufeinander
situativ eingebrachten selbstreflexiven Momente mitge- beziehen. A reagiert mit dem, was er / sie sagt oder tut, auf
staltet. B und B reagiert ebenso auf A (Duden, 1990, 350 – 354). Die
. Die Interaktion der Personen mit sich selbst ist mit der sozia- persönliche Begegnung von (mindestens) zwei Menschen
len Interaktion verwoben und beeinflusst sie ihrerseits. gilt als Paradebeispiel einer Interaktionssituation. In der
. Formierung und Auflösung, Konflikte und Verschmel - Interaktion werden einerseits Erwartungen gefestigt, indem
zungen gemeinsamer Handlungen konstituieren das sie angenommen werden, worauf die Reaktion auf erwartende
soziale Leben der menschlichen Gesellschaft. Weise erfolgt. Anderseits kann die Erwartung auch abgelehnt
. Ein komplexer Interpretationsprozess erzeugt und prägt die werden, wodurch sich das Verhalten verändert, um andere
Bedeutung der Dinge für die Menschen.“ (ebenda) Erwartungen zu wecken oder diese nicht zu bedienen. D adurch
beschreibt die Interaktion eine Handlungslinie, bestehend aus
Diesen Ausarbeitungen zur Folge besteht, lt. Blumer die Ak- der gegenseitigen aufeinanderfolgenden Abstimmung der Be-
tivität der Menschen darin, „ (...), dass sie einem stetigen Fluss teiligten. Indessen ist der einzigartige Charakter der gemein-
von Situationen begegnen, in denen sie handeln müssen, und samen Handlung nur durch sich selbst induziert – unabhängig
dass ihr Handeln auf der Grundlage dessen aufgebaut ist, was von dem was verknüpft wird.
sie wahrnehmen, wie sie das Wahrgenommene einschätzen
und interpretieren und welche Art geplanter Handlungslinien Das gemeinsame Handeln, welches Blumer auch als das
sie entwerfen (...) “ (Blumer, 1973, 96). Außerdem hat Blumer „verbundene Handeln der Gesamtheit“ beschreibt, ist somit
drei Prinzipien des Handelns entwickelt: immer die Gesamtheit der Verkettungen, also das aufeinander
Abstimmen einzelner Handlungen der Individuen. Deshalb ist
I. Menschen handeln Dingen gegenüber auf Grund der das Ergebnis dieser komplexen Verkettung eine fortwährend
Bedeutung, die diese Dinge für sie haben. ablaufende, niemals abgeschlossene Entwicklung (Blumer,
II. Diese Bedeutung entsteht in einem Interaktionsprozess. 1973, 103).
III. Die Bedeutung wird von der Person in Auseinander-
setzung mit den Dingen selbst interpretiert, daraufhin
entsprechend gehandhabt und geändert.
61. 2. Design
Design geht sprachgeschichtlich von dem italienischen Be- mehr sinnlose Produkte auf den Markt bringen ließen. E benso Beat Schneider: Design
– eine Einführung, Basel,
griff „disegno“ hervor, zu Deutsch: Zeichnung (Hauffe, 1995, 10). kann die angebliche „Reduktion auf das Wesentliche“ eine Birkhäuser, 2005
Im Englischen und Französischen wird Design mit den Wörtern Triebfeder der Überflussgesellschaft sein“ erklärt Mateo Kries,
im Interview von Silke Hohmann, Monopol-Magazin für Kunst Thomas Hauffe
„Gestaltung“ oder „Entwurf“ übersetzt. Im Gegensatz zu dem
Schnellkurs Design,
italienischen „disegno“ und spanischen „ diseño“, welches nicht und Leben, am 20.05.2010 1. Köln, Dumont, 1995
nur gestalterische Aspekte berücksichtigt, sondern auch einen
Uta Brandes, Michael
technische bis konzeptionelle Anteile der „Gestaltung“ berück- Im Gegensatz zu eindeutigen Wissenschaften ist der Begriff Erlhoff, Nadine Schem-
sichtigt. Demzufolge bedeutet Design im ursprünglichen Sinne Design schematisch. Es kann die Perspektive, das Tätigkeits- mann: Designtheorie und
Designforschung. Design
sowohl Gestaltung, als auch ein zugehöriger, kontrollierter feld oder die Disziplin nicht auf einen anerkannten Nenner studieren. UTB,
Vorgang (Schneider, 2005, 12 – 16). Deutschland trat Anfang des gebracht werden. Zudem bildet die Theorie und Praxis bisher Paderborn, Fink, 2009
19. Jh. zum ersten Mal mit der Begriffsform von Design in Kon- keine Übereinstimmung. Ein praktisch agierender Designer Drosdowski, Günther:
takt. Der französische Begriff „Dessin“ ersetzte die deutsche arbeitet zwar frei von der Theorie, hält sich aber trotzdem Etymologie. Herkunfts-
wörterbuch der deutschen
Bezeichnung für Mustermacher. Die e nglische Form „Design“ an – auf Erfahrungen beruhenden Erkenntnissen, Konzepten Sprache; Die Geschichte
existierte seit den 1960er-Jahren. Dieser wurde ausschließlich und teils logischen Systemen. Hinzu kommt ein aus der Praxis der deutschen Wörter
und der Fremdwörter
in der Fachwelt angewandt und stand für den Prozess der be- wichtiges und nicht wegzudenkendes Element: die Intuition. von ihrem Ursprung bis
wussten Gestaltung. Vorher (bis 1945) wurden Begriffe, wie Also ein passiven Sinn von Eingebung – ohne bewusste Schluss- zur Gegenwart, Band7,
Mannheim, Dudenverlag,
z. B. industrielle Formgebung oder Produktgestaltung genutzt folgerung bzw. ohne Gebrauch des Verstandes – die Fähigkeit, 1997
(Hauffe, 1995, 11). Einsichten in Sachverhalte, Sichtweisen, Gesetzmäßigkeiten
oder die subjektive Stimmigkeit von Entscheidungen zu erlan- Andreas Dorschel
Gestaltung – Zur Ästhetik
Heute wird Design als Sammelbegriff für alle bewusst gen (Drosdowski, 1997, 310.) des Brauchbaren, Heidel-
berg, Universitätsverlag
gestalteten Eigenschaften eines realen oder virtuellen Ob- C. Winter, 2002
jektes, einer Dienstleistung oder Marke. Zudem wird es Die Theorie hingegen entwickelt Modelle, um die Design
meistens als Zusatzleistung aufgefasst, welche hauptsächlich praxis zu deuten. Daraus folgt, dass Design mit Hilfe der
Produkte verschönert oder ansprechender hervorbringen soll theoretischen Methoden meist praktischer ausgearbeitet wird.
(Brandes / Erlhoff / Schemmann, 2009, 21 – 23). Beziehe ich diese Erkenntnisse auf den Menschen, orientiert
sich Design am Mensch und seiner Umwelt. Design passt sich
Seit den 1980er-Jahren verbreitete sich das Wort welt- dabei vor allem den vielseitigen Bedürfnissen seiner Zielgruppe
weit in allen Lebensbereichen. Demzufolge ungenauer und an. Deshalb ist Design in erster Linie zweckorientiert (Dorschel,
missverständlicher wurde die Definition von Design. Kunst 2002, 21 – 23).
historiker und Chefkurator des Vitra Design Museums Mateo
Kries bezeichnet die 1980er-Jahre als Inflation für den Begriff
Design. „(…) nicht zuletzt, weil sich die Formel „Design“ her-
vorragend als Marketingargument eigne, mit der sich immer
1 http://www.monopol-magazin.de/artikel/20101636/Inflation-der-Gestaltung-In-Total-
Design-sehnt-sich-Mateo-Kries-nach-echter-Reduktion-auf-das-Wesentliche.html,
7
Zugriff am 1.6.20141. 2. 1. Prozess Design ist interdisziplinär Gui Bonsiepe: Erziehung
zur visuellen Gestaltung.
In: Zeitschrift der Hoch-
Die erste Phase im Designprozess ist die Analyse zur Für die meisten Designergebnisse ist ein vielseitiges schule für Gestaltung.
Heft Ulm 12/13, Ulm,
Problem erkennung. Hierbei werden Besonderheiten festge- issen notwendig, welches aus designtheoretischer Sicht
W
HfG, 1964,
legt und daraus die Aufgabe abgeleitet. Über Stimmungsbilder nicht s pezifisch für das Design ist. Aus diesem Grund arbeiten
(Moodboards) und erste Studien über die aktuelle Situation Designer oft in der Praxis als Team mit diversen Fachkräften Willard Van Orman
Quine: Theorien und
(„Ist“-Zustand) wird eine Anforderungsliste erstellt („Pflichten- zusammen, beispielsweise mit Technikern, Ingenieuren oder Dinge, übersetzt von
heft“) (Bonsiepe, 1964, 17 – 24). Marktstrategen, damit das Konzept in der Realität Bestand hat. Joachim Schulte,
Frankfurt, 1985
Hier zeigt sich, dass die Designpraxis vielfältigstes Wissen un-
Die zweite Phase widmet sich dem Konzept, welches verschie- terschiedlichster Herkunft nutzt (Heufler, 2004, 41). Prof. Dr. Sa- Charlotte, Peter Fiell:
Design des 20. Jahr-
dene Lösungsvarianten vorschlägt. Dabei prüft der D
esigner die bine Foraita1 (Foraita, 2005, 185) schlussfolgert: „Der Designer hunderts. Taschen-
Methoden, welche zur Zielerreichung als geeignet erscheinen entwickelt also nicht mehr nur einen Gegenstand an sich, buch, Köln 2002
(Quine, 1985, 24). Hier werden einzelne Funktionen gegliedert, sondern vor allem die damit verbundenen Handlungsabläufe Bernhard E. Bürdek:
übergeordnete Lösungen gesucht und einzelne Abschnitte und berücksichtigt dabei die Bezüge, die der Gegenstand Design – Geschichte,
Theorie und Praxis der
betrachtet. Zu den einzelnen Teilen und dem großen Ganzen zu anderen Gegenständen aufweist, seinen Handlungs- und Produktgestaltung, 3.
werden verschiedene Varianten ausgearbeitet. Anschließend Umgebungskontext.“ Neuaufl., Basel,
Birkhäuser, 2005
werden diese in (meist kleineren) Teams bewertet, um sich für
einen Aufbau zu entscheiden. Das Konzept beschreibt einen Theoretische Grenzen des Designs Gerhard Heufler:
Design-Basics.
Entwurfsplan und die mögliche Vorgehensweise. (Fiell C./ Fiell Von der Idee zum
P., Köln 2002, 28 – 32). Im Wesentlichen ist sich die Literatur darüber einig, dass Produkt, Niggli Ag,
Sulgen, 2004
sich Design am Menschen orientiert und mit Hilfe von inno-
In der dritten Phase entsteht der Entwurf, zur Problem vativen Konzepten, Systemen und Objekten einen Einfluss auf
lösung. Dafür werden als Erstes Skizzen angefertigt, später den Menschen ausübt. Die Theorien unterscheiden sich aber,
detailliert und ggf. maßstabsgetreu gezeichnet. Falls ein Modell ab wann in der Praxis und im Alltag von Design gesprochen
benötigt wird, wird dieses gebaut. Anschließend werden die werden kann.
Entwürfe ebenfalls in (meist kleinen) Teams bewertet, um sich
für einen finalen Entwurf zu entscheiden (Bürdek, 2005, 34). In der Literatur sind eine Vielzahl von Diskussionen, ab wann
von Design gesprochen werden kann, zu beobachten. Zum Teil
Zuletzt, in der vierten Phase, wird der Entwurf in die Umwelt wird anhand von quantitativer Vervielfältigung entschieden,
implementiert: er wird beispielsweise in industrieller Serien- ob bei einem zwei- oder dreidimensionalen P rodukt Design vor-
produktion hergestellt, vermarktet und verkauft. Dafür wird handen ist oder nicht. Somit werden Einzelstücke immer w ieder
das große Ganze optimiert und „feingeschliffen“, von Teams als Kunsthandwerk gesehen. Sinnvoller wäre aber m einer
bewertet und korrigiert. Anschließend werden Hinweise für Meinung nach, eine Definition über individuelle prozessuale
die Produktion, Vorgaben für die Technik und betriebswirt- Aspekte, wie z. B. Idee, Entwicklung, Perspektive und Wirkung.
schaftlichen Bestimmungen herausgearbeitet (Fiell, Köln 2002, Zum anderen gibt es Hinweise, Design an formaler und funk-
28 – 32). tionaler Qualität fest zu machen. Hierbei gibt es verschiedene
Designstufen, in Bezug auf Innovation, technischer Qualität
und formaler Höhe. Demzufolge gewinnen hier neuartige
moderne Objekte, gegenüber traditionellen Objekten, wie
z. B. Eichenholzmöbel. Desweiteren gibt es Theorien darüber,
ob die Designer eine besondere Gabe haben, kreativ zu den-
ken, unkonventionelle Wege einzuschlagen und Probleme zu
lösen. Allgemein und wenig elitär gilt, dass jeder Mensch ein
Designer ist. Dementsprechend wäre Design eine fundamenta-
le Kompetenz des menschlichen Handelns und Schaffens.
1 Prof. Dr. Sabine Foraita an der HAWK Hildesheim für „Designwissenschaft und
Designtheorie“
81. 2. 2. Form Follows Function Robert McCarter: Frank
Lloyd Wright, Schweden,
Random House, 2010
Die Problematik der Definition, was gutes Design ist, ist in der Einer der bekanntesten Gestaltungsleitsätze im Design ist:
Louis Sullivan: The tall
Theorie bisher noch nicht eindeutig beschrieben. Im Gegensatz form follows function (zu Deutsch wörtlich: [Die] Form folgt
office building artistically
zur Wirtschaft, wo Unternehmen oder Institutionen gegründet [aus der] Funktion). Demzufolge leitet sich die Form bzw. considered, Lippincott’s
werden, um unter eigenen Kriterien der Gesellschaft zu sagen, Gestaltung aus der Funktion bzw. aus dem Nutzungszweck
Magazine, März 1896
was gutes Design ist – mittels einem D esign-Award. Demnach ab. Das erste Mal wurde dieser Leitsatz vom amerikanischen Moggridge: Designing
ist es entscheidend welcher Award – also welches Unternehmen Bildhauer Horatio Greenough erwähnt (McCarter, 2010, 14). Interactions, West Sussex,
The MIT University Press
oder Institution den höchsten Einfluss auf den Designmarkt Anschließend hat Louis Sullivan, einer der ersten Hochhaus Group Ltd, 2006
hat. Salopp ausgedrückt, entscheiden hier führende Kräfte des architekten diesen Terminus aufgegriffen. Seine Fassaden
Wirtschaftsmarktes über die Designqualität. Der iF Design Award waren teilweise vollständig ornamentiert worden. „Es ist das
hat beispielsweise für die Design disziplin „Communication“ Gesetz aller organischen und anorganischen, aller physischen
folgende Bewertungs kriterien: Ziel gruppenansprache und und metaphysischen, aller menschlichen und übermenschlichen
Inhalt, Usability (Benutzerfreundlichkeit, Navigation, Funk- Dinge, aller echten Manifestationen des Kopfes, des Herzens
tion), „Look and Feel“ (Ästhetik, Screendesign, Animation), und der Seele, dass das Leben in seinem Ausdruck erkennbar
Uniqueness (Kreativität, Originalität, Innovation), Materialaus- ist, dass die Form immer der Funktion folgt.“ (aus Sullivans
wahl und Ausführung, Wirtschaftlichkeit, Kundenrelevanz 1. Aufsatz: „The tall office building artistically considered“, veröf-
fentlicht 1896 [Sullivan,1896, 111], hier zitiert er seinen P
artner
Dankmar Adler, der ihn von Henri Labrouste übernommen
hatte). Desweiteren erwähnt Sullivan diesen Gestaltungleit-
satz ein zweites Mal: „Whether it be the sweeping eagle in
his flight, or the open apple-blossom, the toiling work-horse,
the blithe swan, the branching oak, the winding stream at its
base, the drifting clouds, over all the coursing sun, form ever
follows function, and this is the law. Where function does not
change form does not change.“ (ebenda; Übersetzung Sullivan
1896: „Ob es der gravitätische Adler in seinem Flug oder die
geöffnete Apfelblüte, das sich abplagende Arbeitspferd, der
anmutige Schwan, die sich abzweigende Eiche, der sich schlän-
gelnde Strom an seiner Quelle, die treibenden Wolken, die
überall scheinende Sonne, die Form folgt immer der Funktion,
und das ist das Gesetz.“). Diese Definitionen wurden in der
Geschichte oft falsch verstanden. Sullivans Aussage zur Folge
ist auch Zierrat ein funktionales Element. Auf Grund dessen
beinhaltet das Gestaltungsparadigma „Funktion“ neben der
rein funktionalen ebenso die ästhetischen und symbolischen
Aspekte.
Demzufolge ist Design meiner Meinung nach definitiv
zweckorientiert. Das Grundprinzip lautet form follows f unktion
und orientiert sich an dem Benutzer und seiner Umwelt. Durch
diesen Entwicklungsprozess, bestehend aus interdisziplinären
Fachbereichen, löst Design Probleme des Menschens, wodurch
bei deren Nutzern ein postives Gefühl hervorgerufen wird.
1 iF Design Award, URL: http://www.ifdesign.de/awards_disziplinen_kategorien_index_d,
Zugriff am 01.06.2014
91. 3. Interaction Design
„Interaction Design“ beschreibt grundsätzlich einen Ent- 1. 3. 1. Methoden im Interaction Design Moggridge: Designing
Interactions, West Sussex,
wicklungsprozess einer Funktion oder eines Systems, inklusive The MIT University Press
deren Gestaltung. Der Ursprung von Interaction Design liegt Interaction Designer entwickeln immer individuelle benutz- Group Ltd, 2006
in der Informatikbranche, der Human Computer Interaction erzentrierte Lösungen. Dafür habe sie gewisse Methoden. Ein
(HCI) sowie in der Ergonomie und der Psychologie, der wichtiger Bestandteil ist es frühe Prototypen (z. B. Simulationen,
Human Factors. Interaction Design ging als eigenständige interaktive Demos oder Bedienteile) zu entwickeln. Um damit
Disziplin aus der grafischen Bedienoberfläche (Graphical User ihr Konzept mit Hilfe von Benutzern auf ihre Anwendbarkeit
Interface: GUI ) hervor. Bis sich dieser Arbeitsbereich als eine zu überprüfen. Für den Interaction Designprozess gibt es auf
eigenständige Design
disziplin herauskristallisiert hat, haben einanderfolgende Prozessphasen, welche je nach Benutzer-
z. B. Produktdesigner, wie Dieter Rams, Ex-Chefdesigner von Feedback und Häufigkeit der Iterationsstufen variieren können.
Braun, bereits seit den 50er Jahren Interaktionen bei ihren
Produkten (wie Taschenradio, Fernseher oder Plattenspieler) I. Research
selber gestaltet – ohne diese Tätigkeit dabei als Interaction De-
sign zu bezeichnen. Weil sich die Technologie kontinuierlich Um benutzerzentrierte Lösungen entwickeln zu können,
schnell weiterentwickelte und die Kommunikations systeme müssen Interactiondesigner ihre Benutzer erforschen und
immer komplexer wurden, stiegen demzufolge auch deren ihr Umfeld erkunden. Dafür sind folgende Vorgehensweisen
Anforderungen, wodurch die Entstehung einer darauf speziali- möglich: Fragebögen, Gespräche, Alltags-Analysen und ver-
sierten Designdisziplin notwendig wurde. gleichbare Anwendungen oder Produkte. Die Recherche ergibt
die Voraussetzung für eine benutzerzentrierte Designlösung
Bill Moggridge und Bill Verplank waren die ersten, wel- einer Problemstellung.
che den Begriff „Interaction Design“ aufführten (IBM,
2008 / Verplank, 2014). Verplank bezeichnete Interaction II. Conception
Design als Adaption des Begriffes „User Interface Design“. Für
Moggridge dagegen war es eine Verbesserung von „soft-face“, Nach der Recherche entwickeln Interaction Designer,
einem Begriff, den er 1984 für die Gestaltung von Produkten Ideen und erste Konzepte für z. B. neue Software-Anwendun-
mit integrierter Software nutzte (Moggridge, 2006). 1989 würde gen, Endgeräte, Services und Systeme. Diese Phase benötigt
der erste Master-Studiengang für Interaktionsprozesse geschaf- mehrere Durchgänge von Kreativitätstechniken, wie z. B.
fen. Gillian Crampton-Smith etablierte am Royal College of Art, „Brainstorming“, „Semantische Intuition“, sowie „Methode
London den Studiengang „computer-related design“, welcher 635“ und weitere. D
arauf folgen Diskussionen und Verbesse-
anschließend als „design interactions“ bekannt wurde. Zudem rungsvorschläge. Meist geschieht diese Kreativphase in kleinen
entstand 2001 in Italien das „Institute Ivrea“, eine Hochschule Teams. Um die Voraussetzungen und mögliche Einschränkun-
die sich ausschließlich mit Interaction Design beschäftigte. Das gen verstehen zu können, erstellen Interaction Designer ver-
populärste Produkt ist der Mikrocontroller „Arduino“. In den schiedene fiktive Benutzerprofile (Personas) mit jeweils einem
letzten zehn Jahren wurden immer mehr Interaction Design- passenden Szenarium. Anschließend werden Anwendungs-
Studiengänge weltweit verzeichnet. Somit bekommt der Be- fälle (Use Cases) definiert, wofür die geeignetsten Personas
griff eine fortführend weitreichendere Bedeutung. genutzt werden. Um den zukünftigen Interaktionsablauf des 10Nutzers mit der Anwendung oder dem Gerät zu verstehen, V. Interface Design
können die Abläufe einerseits als Mock-ups festgehalten oder
zum anderen als Animation greifbar gemacht werden. Interface Design ist die grafische Oberflächengestaltung
des Dialoges zwischen Mensch und Maschine. Auch hier wird
Nachdem die Analyse der Benutzeranforderungen ausführ- großen Wert auf eine benutzerzentrierte Gestaltung gelegt
lich mit allen Problemstellungen zusammengefasst wurden, (User Experience). Eine Interface Gestaltung ist i. d. R. nur
wird ein Vision Statement verfasst. Darin werden alle derzeiti- möglich, wenn eine Ein- oder Ausgabe mit Hilfe einer visuellen
gen und zukünftigen Projektziele definiert. Oberfläche geschieht.
III. Creation VI. Implementation
Darauf aufbauend wird eine klare Problemstellung be- Die Umsetzung erfolgt meistens durch Programmierer,
schrieben. Der Interaction Designer entwirft erste Prototypen edientechniker oder Elektroingenieure. Dabei müssen Inter-
M
(z. B. Screenflows oder Papierprototypen) mit verschiedenen action Designer weiter integriert bleiben, um die Richtigkeit
Variationen. Die geeignetesten Ergebnisse mit den meisten der Konzeption zu überwachen. Es ist möglich, dass sich während
erfüllten Anforderungen, werden in einer Lösung neu ange- der Umsetzung noch Änderungen ergeben. Wichtig ist, dass der
wendet. Zur Visualisierung der Zusammenhänge werden Tools, Interaction Designer über jede Änderung informiert
wie Hierarchische Modelle oder Klassendiagramme genutzt. wird.
IV. Prototyping VII. Testing
Zur Überprüfung eignen sich folgende Techniken: Bevor das System, Produkt oder Gerät für deren Zielgruppe
freigegeben wird, findet eine weitere Testrunde statt (Usabili-
. Aufgabe und ihre Funktion des Produktes projizieren; ty- und Bug-Testing). Der Interaction Designer muss auch hier
. „Look and Feel“ erlebbar werden zu lassen; den Prozess kontrollieren, um relevante Veränderungen vorzu
. Realisierbarkeit der Anwendung. nehmen.
Prototypen können eine horizontale oder vertikale Navi-
gation beinhalten. Wobei die Horizontale die Funktionsviel-
falt aufzeigt und die Vertikale die Anwendungstiefe. Bei dem
Prototyping ist die Gestaltung noch nicht wesentlich, deshalb
können Prototypen unterschiedlich detailliert ausgestaltet
sein: physisch, digital, skizzenhaft oder äußerst detailliert.
111.3.2. Soziale Interaktionsgestaltung 1.3.3. Emotionale Interaktionsgestaltung Helen Sharp, Yvonne
Rogers, & Jenny Preece:
Interaction Design
Social Interaction Design (SxD), als Schwerpunkt der Für den Interaction Designer liegt der Fokus des gesamten – beyond human-
computer interaction,
Interaktionsgestaltung, beschäftigt sich zum Einen mit der Designprozesses immer auf der benutzerfreundlichen
3. Aufl., West Sussex,
Interaktion zwischen Mensch und Maschine und zum Anderen Anwendbarkeit (Usability). Mindestens genauso viel Wert muss John Wiley & Sons, 2011
mit der Interaktion von den Nutzern untereinander. Aufgrund der Designer aber auch auf die Emotionen legen, d. h. nicht
John J. McCarthy und
der Digitalisierung, besonders der sozialen Vernetzung, nimmt nur die rationale Anwendbarkeit ist entscheidend, sondern Peter Wright: technology
die Soziale Interaktionsgestaltung zu. Menschen können heute, die Benutzerfreundlichkeit von Produkten, welche durch as experience framework,
West Sussex, John Wiley
mit Hilfe von z. B. mobilen Endgeräten, Navigations geräten emotionale Aspekte entscheidend beeinflusst wird (Sharp / & Sons, 2007
oder Spielkonsolen, jederzeit und überall mit anderen Perso- Rogers / Preece, 2011, 181 – 217).
Charles Eames und Ray
nen weltweit kommunizieren. Für den Interaction Designer Eames: Die Welt von
stellt sich dadurch die zwischenmenschliche Kommunikation Die Voraussetzung für eine positive emotionale Wahr- Charles und Ray Eames,
Berlin, Ernst & Sohn, 1997
als Herausforderung dar. nehmung ist die Usability (McCarthy, Wright, 2007). D arauf
aufbauend kann das Interface Design mit positiven,
moti
-
Daraus ergibt sich ein neues Kapitel für die Theorie der vierenden, assistierenden, lernenden, kreativen, sozialen und
rationalen Entscheidung von den Kognitionswissenschaften überzeugende Elementen. Hier kommt es auf die Details an.
und der Soziologie, Psychologie und Anthropologie. Bisher ist Für ein ausdrucksstarkes Interface Design haben sich z. B.
der Zusammenhang der sozial-vernetzten Technologien noch dynamische Icons, Animationen und Audioeinblendungen
unzureichend beschrieben. bewährt. Nur wenn diese Details, dem Nutzer seine Inter
aktionen nachvollziehbarer gestaltet, wird das System, Gerät
oder Service, begehrenswert erscheinen. Zusätzlich haben die
Designparameter wie z. B. Schriftart, Farbigkeit, Form, Größe
oder Helligkeit. einen großen Einfluss darauf, ob das Produkt
emotional positiv wahrgenommen wird. Der Designer Charles
Eames führt hierzu auf: „The details are not the details, the
details are the design“ (Eames C./Eames R., 1997).
121.3.4. User Interface Design 1.3.5. User Experience Donald A. Norman:
Aufmerksamkeit und
Gedächtnis: eine Einfüh-
Oft verbindet die Literatur das Interaction Design mit dem Die „User Experience“ priorisiert die Benutzerfreundlich- rung in die menschliche
Informationsverarbeitung,
„User Interface Design“. Dieses setzt sich mit der Entwicklung keit. Trotzdem ist das Produkt nicht allein emotional an
Weinheim, Basel,
des Dialoges zwischen Mensch und Maschine ausein ander. sprechend, wenn die Usability-Anforderungen befolgt w urden. Beltz, 1973
Wenn in einem Dialog eine grafische Benutzeroberfläche Donald A. Norman, Professor für Informatik und Gründer der
Rainer Dorau: Emotio-
(Interface) integriert ist, wird diese von dem Interaction- oder Firma Nielsen Norman Group, hat, den Begriff User-Experi- nales Interaktionsdesign,
Interface Designer gestaltet. Demzufolge kann Interfacedesign ence geprägt. Er wollte sich von dem Begriff „Usability“ lösen. Heidelberg, Springer,
2011
ein Teil des Interaction Designs sein. Im Gegensatz zur v isuellen „User Experience“ ist eine übergeordnete Bezeichnung für die
ist u. a. auch eine auditive oder haptische Eingabe möglich. Gesamtheit aller Erfahrungen, die ein Nutzer mit einer Inter
Hierfür gibt es i. d. R. keine Interfacegestaltung. Während des aktion macht. (Norman, 1973). Eine Interaktion soll nicht nur
gesamten Interactiondesignprozesses wird großer Wert auf fehlerfrei ans Ziel führen – sie muss begeistern. Somit wird aus
eine benutzerzentrierte Gestaltung gelegt (User Experience). der grauen Usability der bunte „Joy of Use“ (Dorau, 2011, 17).
Interaktivität muss nicht ausschließlich digital sein. Inter Ein Interactionsdesigner muss schon in frühen Phasen er
action Designer können ebenso Lösungen für Dienstleister und kennen, ob das Design funktioniert und die Anforderungen
Abläufe entwickeln. an ein emotionales Interaktionsdesign erfüllt. Die Heraus
forderung ist, dass der Designer nicht die Emotionen einstel-
len kann, sondern lediglich am Design Stellschrauben drehen
kann, um anschließend die gewünschte emotionale Wirkung
zu erhalten. Die methodische Vorgehensweise für eine gute
Usability und User-Experience sind folgende drei Punkte
(Dorau, 2011, 17):
I. Im Erscheinungsbild der Anwendugen ist der Anspruch an
eine gute Ästhetik zu erfüllen (ebenda). Hierbei ist zu be-
achten, dass Ästhetik nicht allein visuell sein muss, auch
das auditive Design und die Haptik kann hierbei eine Rolle
spielen. Die Ästhetik für einen Interaktionsdesigner ist ge-
nerell Design für die Sinne. (vgl. Punkt 1.3.5.,
I. Erscheinungsbild, 14)
II. Dem Anwender ein positives Bedienerlebnis zu verschaf-
fen (ebenda). (vgl. Punkt 1.3.5., II. Bedienerlebnis, 14)
III. Das Verständnis der Anwendung bestmöglich zu fördern
(ebenda) (vgl. Punkt 1.3.5., III. Verständnis, 15)
13I. Das Erscheinungsbild: II. Das Bedienerlebnis:
Ein attraktives Erscheinungsbild erhöht die Aufmerksam- „Das Bedienerlebnis [User Experience] bezieht sich hauptsäch-
keit des Nutzers und sein Interesse, sich mit dem Interface lich auf den Akt der Interaktion und auf die Wirkung auf den
auseinander zu setzen. Unbewusst schließt der User vom ersten Nutzer“, beschreibt Rainer Dorau, Senior-Informationsdesigner
Eindruck auf die gesamte Anwendung. Hierbei gelten die bei macio GmbH (2011, 20). Die User Experience entscheidet, ob
gleichen Gesetze, welche seit der Erfindung des Buchdruckes das Versprechen eines guten Interaktionsdesigns, welches von
entwickelt worden. Gestaltungsregeln für Layout, Farbgebung, dem Erscheinungsbild ausgelöst wird, eingehalten wird. Denn
Typografie etc. haben bei Bildschirmanwendungen nicht an User Experience lässt sich nicht auf den ersten Blick bewerten,
Bedeutung verloren. Deren Ziel ist das optimale Erfassen von sondern wirkt erst während seiner aktiven Nutzung. Ziel ist es
Informationen und eine bestmögliche Lesbarkeit. Bei Bild bei dem Nutzer eine positive Grundstimmung hervorzurufen.
schirmanwendungen kommt lediglich die Einschränkung der
Monitorwiedergabe oder die mit der erzeugenden Software Die Basis für das Bedienerlebnis ist eine gute Rechen
erreichbare Renderingqualität hinzu. Somit hat jedes Medium leistung. Mit langen Wartezeiten, ruckelnden Animationen
in der technischen Reproduktion ihre Besonderheit. und verspäteten Rückmeldungen ist eine schlechte Stimmung
bei dem Nutzer vorprogrammiert. Mit einer performanten
Ebenso sollte die Stilistik an der Zielgruppe und der Zweck- Darstellung von Prozessen und Zuständen und eine instan-
bestimmung der Anwendung angepasst sein. Wenn Dinge te Rückmeldung der Benutzereingaben verbindet der Nutzer
fotorealistisch oder ikonografisch dargestellt werden, wird das ein technisch zuverlässiges System. Das schafft Vertrauen in
Erscheinungsbild auch unterschiedlich wahrgenommen, z. B. Funktionstüchtigkeit und Robustheit des Systems. Der Nutzer
seriös oder verspielt. muss das Gefühl bekommen, dass sich das Produkt und des-
sen Interface gut anfühlen. Rainer Dorau erklärt: „Neben der
Wenn Musik oder Klänge mit der visuellen Darstellung technischen Zuverlässigkeit ist auch die logische Zuverlässig-
ombiniert wird, müssen diese auch auf ästhetischen Gesichts-
k keit von großer Bedeutung. Das System muss sich erwartungs
punkten ausgewählt oder komponiert werden. Die Klang konform verhalten, der Benutzer muss das Gefühl haben, dass
ästhetik muss zur visuellen Erscheinung passen. es das tut, was von ihm verlangt wird. Das Vertrauen in die
Zuverlässigkeit des Systems ist eine der wichtigsten Vorausset-
Innerhalb der ästhetischen Kategorie spielt, bei einer zungen für ein positives Bedienerlebnis.“
hysischen Bedienung, die Haptik eine bedeutende Rolle:
p
Form, Größe, Gewicht, Material, Temperatur und die Ober Ein wichtiger Bestandteil des Sicherheitskonzepts ist das
fläche haben großen Einfluss, ob die Berührung als angenehm Fehlbedienungsrisiko. Nutzer wissen zwar, dass der Computer
empfunden wird oder nicht. Die Oberflächensensibilität der kein Mensch ist, trotzdem verlangen sie von Anwendungen ein
menschlichen Haut empfindet Temperatur, Schmerz und me- menschenähnliches Verhalten. Weil Computer nur stur nach
chanische Reize. Der mechanische Sinn teilt sich in: Berührung, vorprogrammierten Algorithmen handeln, ist es oft der Nutzer,
Vibration, Druck, Spannung und Kitzel (Dorau, 2011, 20). der die Fehler bei der Bedienung macht. Es ist grundsätzlich
nicht schlimm und allgemein menschlich, Fehler zu m achen.
Deshalb müssen Interaktionsdesigner dieses Fehlerbedienungs-
risiko in ihrer Arbeit berücksichtigen. Die beste Reaktion auf
Fehler zu reagieren ist, dem User die Chance auf Korrektur zu
geben und ihm ggf. eine Hilfestellung anzubieten.
Demzufolge muss auch das Wording fokussiert werden.
Imperative Ermahnungen und Ausrufezeichen gehören der
Vergangenheit an. Das Wording einer Anwendung sollte
freundlich, aber bestimmt sein und nie maßregelnd oder be-
vormundend klingen (Dorau, 2011, 21).
14III. Das Verstehen
Verstehen bedeutet nach Wilhelm Dilthey, Theologe und Donald A. Norman, Professor für Informatik, beschreibt Friedrich Lenger:
Werner Sombart
Philosoph, aus äußerlich gegebenen, sinnlich wahrnehmbaren in seinem Buch Emotional Design: „Why we love (or hate) 1863 – 1941, 3. Aufl.,
Zeichen ein „Inneres“, Psychisches zu erkennen (Dilthey, 1938, everyday things“ (New York, Basic Books, 2003, 98) die Stel- München, Beck, 2012
212 – 213). Das inhaltliche Begreifen eines Sachverhalts, das lung der Form in den Dienst der Funktion als Selbstbeschrei-
Marcus du Sautoy: Die
nicht nur in der bloßen Kenntnisnahme besteht, sondern vor bungsfähig: „Ein Türgriff muss aussehen wie ein Griff.“ Musik der Primzahlen: Auf
allem durch eine intellektuelle Erfassung des Zusammenhangs, Wenn er das nicht tut, löst er Unverständnis aus und spricht den Spuren des größten
Rätsels der Mathematik,
in dem der Sachverhalt steht. Nach Werner Sombart, Soziologe nicht zu dem Nutzer. Somit muss auch der Button aussehen, München, C. H. Beck,
und Volkswirt, beruht das Verstehen auf der Identität des wie ein Button. Der Nutzer muss sehen, dass dieser Button 2004
Menschengeistes. Das Verstehen setzt Intelligenz bzw. Geist zum anfassen da ist. Eine Ausnahme besteht während der Karl R. Popper, Miller, A
voraus (Lenger, 2012, 171 – 174). Gesten steuerung. Gestische Interfaces vertrauen auf eine proof of the impossibility
of inductive probability,
Experimentierfreudigkeit der Nutzer. Demzufolge ist es hier- in: Nature 302, 1983
Der Begriff des Verstehens spielt in der Philosophie und der bei noch wichtiger Fehlbedienungen abzusichern. Geeignet
Hermeneutik eine wichtige Rolle. Z.B. ist der Ausruf Heureka sind dafür auch V orabvisualisierungen. Rainer Dorau (2011,
nach einer von Plutarch und Vitruv überlieferten Anekdote 23) rät: „Um eine für alle Bediener verständliche Visualisierung
berühmt geworden. Demzufolge soll Archimedes von Syrakus, zu finden, muss sich der Interaktionsdesigner in die Situation
ein griechischer Mathematiker, nachdem er in der Badewanne des Anwenders hineinversetzen und antisipieren, was dieser
das Archimedische Prinzip entdeckt hatte, unbekleidet und zu verstehen in der Lage ist und was nicht. […] Alle Design-
laut „Heureka!“ rufend durch die Stadt gelaufen sein (Kluge, entscheidungen unterliegen der Maßgabe: Ist die Information,
Seebold, 2002, 410). Seitdem wird Heureka als freudiger Ausruf die der Anwender zur Bedienung benötigt, zur rechten Zeit im
nach gelungener Lösung einer schwierigen Aufgabe verwen- Interface präsent, und ist das Mittel der Darstellung geeignet,
det und steht auch als Synonym für eine plötzliche Erkennt- verstanden zu werden? […] Ein gutes Informationsdesign wird
nis. Ebenso hat der berühmten Mathematiker Carl Friedrich vom Bediener als klare, unmissverständliche Benutzerführung
Gauß dieses Motto verwendet. Als er 1796 entdeckte, dass sich wahrgenommen.“
jede positive ganze Zahl als Summe von drei Dreieckszahlen
darstellen lässt, schrieb er die folgende Zeile in sein Notizbuch: Inwieweit das Interface verstanden wird, ist abhängig
„EYPHKA! num = Δ + Δ + Δ“ (Sautoy, 2004, 71). von Erfahrungen und dem Wissensstand des Nutzers. Ein
Interaktiondesigner kann nicht wissen, was die Anwender den-
Demzufolge löst eine per Geistesblitz gewonnene Erkennt- ken. Aber Designer wissen, wie sie denken. Menschen ziehen
nis Glücksgefühle aus. Neben dem praktischen Nutzen etwas Schlüsse aus ihren Handlungen und den Rückmeldungen des
schlauer geworden zu sein, werden eine Menge Emotionen Systems. Von persönlichen Erfahrungen und kulturellen Hin-
erlebt. User-Interfaces sind logische Gebilde. Ein Nutzer will tergründen weitgehend unabhängig sind logische Schluss-
sich nicht nur an deren Ästhetik erfreuen. Wenn mit der folgerungen, wie z. B. die Induktion und Deduktion. Indukti-
Anwendung ein praktischer Nutzen verbunden ist, will der
on bedeutet den abstrahierenden Schluss aus beobachteten
Bediener die logisch-funktionalen Zusammenhänge verstehen. Phänomenen auf eine allgemeinere Erkenntnis, z. B. einen
Damit er das nicht durch Ausprobieren erfahren muss, soll er allgemeinen Begriff oder ein Naturgesetz. Der Ausdruck wird
durch gutes Informationsdesign angeleitet werden. als Gegenbegriff zu Deduktion verwendet. Eine Deduktion
schließt aus gegebenen Voraussetzungen auf einen speziellen
Da Interface selbst erklärend sein muss, wird es zu ei- Fall (Popper / Miller, 1983, 687 – 688). Diese Schlussfolgerungs-
ner F ormulierungsaufgabe, welche sprachliche und grafische mechanismen erfolgen während des Verstehungsprozesses.
Komponenten, sowie deren Verhalten mit einschließt. Nach Dadurch schlussfolgern die Nutzer gewisse Regeln und Gesetz-
dem Designprinzip: „form follows function“ (vgl. Punkt 1. 2. 2. mäßigkeiten. Hat der User gelernt, wie ein Button aussieht und
Form Follows Function, 9)
15funktioniert, wird er diese Erkenntnis auf alle gleichaussehen- Wünsche, welche das Leben schöner machen und damit Wilhelm Dilthey:
Pädagogik: Geschichte
den Elemente übertragen. Rainer Dorau (2011, 25) fässt zusam- die Welt verbessern. Bill Verplank schreibt hier- und Grundlinie des
men: „Was gleich aussieht, verhält sich gleich. Hier schließt der zu: „These are brilliant concepts, the ideals that we Systems, Leipzig, B.G.
have for making the world wonderful.“ (ebenda) Teubner, 1938
Bediener vom E inzelfall auf eine allgemein gültige Gesetzmä-
ßigkeit (Induktion) und wendet diese Gesetzmäßigkeit wie- Donald A. Norman:
derum auf andere Einzelfälle an (Deduktion).“ Demzufolge II. „Meaning – metaphors and scenarios“ Aufmerksamkeit und
Gedächtnis: eine Einfüh-
geht eine Ausschlussformulierung hervor: Elemente, die unter- Um ein Problem und deren Lösung zu beschreiben, kön- rung in die menschliche
schiedlich aussehen, erwartet, dass sie sich auch unterschiedlich nen lange Erklärungen formuliert werden. Bill Verplank Informationsverarbeitung,
Weinheim, Basel, Beltz,
verhalten. Innerhalb des Interaktionsdesigns bedeutet das, dass bevorzugt hierfür eine einfache Metaphor. Nur ein Bild 1973
bestimmte logische Funktionen nur eine einzige Visualisierung oder ein Satz soll den gesamten Prozess erklären. Da-
Rainer Dorau: Emotio-
erhalten und diese nicht anders verwendet werden darf. durch wird die Konzeptentwicklung unterstützt und nales Interaktionsdesign,
überprüft (ebenda). Heidelberg, Springer,
2011
Damit der User das Interface verstehen kann, muss der
Interactionsdesigner sich der Orientierung widmen. Ansons- III.„Modes – models and tasks“ Moggridge: Designing
Interactions, West Sussex,
ten läuft der Nutzer die Gefahr, sich in dem großen Bauwerk Um ein Konzept zu entwickeln, muss der User analysiert The MIT University Press
des Systems zu verlaufen. Der Nutzer muss dabei nicht die ge- und verstanden werden. Die jeweilige Methode ist abhän- Group Ltd, 2006
samte Informationsarchitektur erfassen, sondern sich lediglich gig von der einzelnen Aufgabe und deren Ziel. Hierbei wird
ziel
sicher in der Navigationsstruktur bewegen. Demzufolge die Aufgabe daran definiert, wie der Weg von einer Metho-
müssen Mittel zur Orientierung bereitgestellt werden. Dabei de oder Modell zur anderen bzw. von einer Sphäre in die
stehen drei Fragen im Mittelpunkt (ebenda), wie z. B. „Wo bin andere ist. Bill Verplank beschreibt (ebenda): „How they can
ich?“, „Wie bin ich hierhergekommen?“, „Wie komme ich hier move from one mode or model to another, or from one en-
weg?“. Für jede der drei Fragen muss im Interface ein Aus- vironment to another, will then define the tasks.“ Dieses
drucksmittel zur Verfügung gestellt werden. tiefgreifende Verständnis darüber, was eine Person macht,
gibt Auskunft darüber, was die Aufgabe benötigt.
IV. „Mapping – displays and controls“
1. 3. 6. Vier-Phasen-Prozess Abschließend wird meistens eine Darstellung und deren
Bedienung entwickelt (abhängig von den Prozesspunkten
Bill Verplank bezeichnet Interaction Design als ein Vier- I. – III.). Diese Darstellung ist die Präsentation von Dingen,
Phasen-Prozess (Moggridge (2006, 130 – 134). Als erstes wird welche die Interaction Designer verhüllen. Trotzdem muss
der Designer durch ein Problem oder eine Idee angeregt, eine es möglich sein, die gesamte Bedienung in der Abbildung
Lösung zu kreieren. Dazu wird eine Metaphor (bildlicher Aus- aufzuzeigen. Solche Darstellungen können bei Arbeiten
druck) gesucht, die das Problem und deren Lösung darstellt. mit dem Computer sehr komplex werden. Vor allem, wenn
Anschließend werden Szenarien entwickelt, welche die Aufga- der Computer für einen Moment Elemente neu belegen
ben im einzelnen beschreiben. Zudem wird ein Konzept ent- kann, welche außergewöhnliche Aktionen hervorrufen,
wickelt, welche alle Aufgaben verknüpft und die Methoden wie beispielsweise alles auswählen oder alles löschen zu
beschreibt. Abschließend wird entschieden welche Darstellung können (ebenda).
sinnvoll ist und wie deren Bedienung erfolgt.
Schlussfolgernd hat beim Interaction Design die höchste
I. „Motivation – errors and ideas“ riorität der Nutzer und sein Verstehen. Wenn die Interaktion
P
Lt. Bill Verplank sollte Design aus einem verstandenden eine Lösung hervorruft, die nachvollziehbar (für deren Nutzer)
Problem und einem Wunschbild entstehen. Diese Proble- ist und mit Interface Design verknüpft wird, sind meines
me können im Alltag zu genügend beobachtet werden. Erachtens, sehr gute Voraussetzungen, geschaffen positive
Als weitere Anregung gelten allgemein gute Ideen und Emotionen auszulösen.
161. 4. Service Design
Im Rahmen meiner Ausarbeitung zu „Interaction Design“ In meiner Arbeit beschränke ich mich bei dem Service D esign Stauss B., International
Service Research: Status
habe ich Ähnlichkeiten sowie Überschneidungen zum „Service rein auf die Dienstleistung. Service Design is kein separates Feld Quo, Developments,
Design“ festgestellt. Diese ebenso junge Designdisziplin wurde für sich, sondern eine übergreifender Prozess. Zusammenfassend and Consequences for
the Emerging Services
1991 erstmals an der Köln International School of Design (KISD) ist Service Design eine Produktsprache. „Zur Produktsprache
Science, in: Stauss, B.
gelehrt (KISD, 2014). Darauffolgend wurde 2004 in Zusammen- gehören sehr verschiedene Ausdrucksformen wie z. B. Dimen- et al. (Hrsg.): Services
arbeit verschiedener Hochschulen und einer Agentur (KISD, sion, Form, physikalische Oberflächen struktur, Bewegung, Science: Fundamentals,
Challenges and Future
Carnegie Mellon University, Universität Linköping, Poliecnico di Materialbeschaffenheit, Art und Weise der Funktionserfüllung, Development, Berlin:
Milano, Domus Acadamy und die Agentur Spirit of Creation) das Farben und grafische Gestaltung der O berfläche, Geräusche Springer, 2008
„internationale Service Design Network“ gegründet, welches und Töne, Geschmack, Geruch, Temperatur, Verpackung, Spath, D., Ganz, W.,
heute weltweit Designexperten und -Beratungsunternehmen Widerstandsfähigkeit gegenüber Außeneinflüssen. Alle diese
Meiren T., Bienzeisler B.:
Service Engineering –
sowie Service-Design-Akademiker und -Fachleute miteinander Informationen wirken – positiv oder negativ – in starkem Maße A Transdisciplinary
verbindet. 2009 führte eine zweite deutsche Hochschule diesen auf den potentiellen Käufer ein.“ (Ellinger, 1966, zitiert nach Approach in Service
Research, in: Stauss, B.
Studiengang ein – die M acromedia Hochschule für Medien und Bürdek, 2005, 285). et al. (Hrsg.): Services
Kommunikation. Science: Fundamentals,
Challenges and Future
Diese von Ellinger beschriebenen Sinneseindrücke, sind Development, Berlin,
In der deutschsprachigen Literatur findet sich noch keine vor allem auf die Reize handfester Produkte ausgelegt. Bei Springer, 2008
allgemein akzeptierte Definition über Service Design. In Bezug genauer Betrachtung können aber Parallelen von tangiblen Bürdeck, B. E.: Design:
auf das Dienstleistungsmarketing findet sich dieser Begriff oft zu intangiblen Produkten gezogen werden. Beispiels weise Geschichte, Theorie und
Praxis der Produktgestal-
in der Management- und Marketingforschung wieder (Stauss, betrachte ich die Dienstleistung „Bildung“ an einer
Schule. tung, 3. vollständig über-
2008, 58). Hierbei wird vor allem auf Qualität und Kunden Die Oberflächenstruktur der Tools für die Wissensübertragung arbeitete und erweiterte
Aufl., Basel: Birkhäuser,
orientierung fokussiert. Desweiteren findet sich Service D
esign ist u. a. die Tafel und die dazugehörige Kreide. Wenn die 2005
ebenso unter einer anderen – thematisch eng verbundenen Kreide lautstark an der Tafel kratzt, löst es einen negativen
Mager, B. und Gais, M.:
Disziplin im ingenieurwissenschaftlichen Bereich wieder –
Eindruck über diese Dienstleistung aus. Ebenso kann die
Service Design. Stuttgart:
„Service Engineering“, welche sich mit der Entwicklung und Verpackung des zu übermittelten Wissens zum einen aus
UTB, 2009
dem Design von neuen Dienstleistungen befasst (Spath u. a., „bunten“
anschaulichen Beispielen oder aus langweiliger
2008, 46). Thematisch startete Service Engineering mit einer „grauer“ Theorie bestehen. Wie wichtig dabei die Temperatur
Prozessbeschreibung in Analogie zu Produkt- und Software ist, wird spätestens gemerkt, wenn der Raum gelüftet werden
entwicklung. Deren interdisziplinäre Themenschwer punkte muss. Anhand dieser alltagsnahen Beispiele lässt sich Design
sind laut Spath (ebenda, 47) die Gestaltung von Dienstleistungs- mit der Formgebung von Dienstleistungen identifizieren. Die
arbeit, Kundeninteraktion und emotionale Aspekte von Dienst- Gestaltung der Dienstleistungsprozesse und ihrer materiellen
leistungen. Bestandteile ist nun Gegenstand des Service Design. Und die-
se Gestaltung hat Funktionalität sowie Emotionalität zum Ziel
(Mager / Gais, 2009, 43).
17Sie können auch lesen