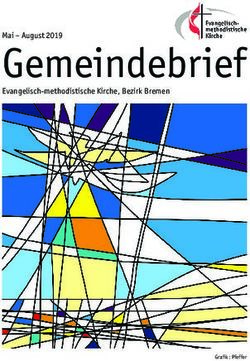Der Streit um den Fußball
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Der Streit um
den Fußball
Wie kaum ein zweites Thema sorgt das »Phä-
nomen Fußball« in der Waldorfschulbewegung
für Auseinandersetzungen und Streitigkeiten.
Die bevorstehende Fußball-Weltmeisterschaft
gibt Gelegenheit, die eigenen Positionen zu
überdenken.
Immer wieder ist erlebbar, dass das Bild der
Waldorfpädagogik in der Öffentlichkeit stark
gezeichnet wird von Vorurteilen, Etikettie-
rungen und »Absonderlichkeiten«, die der
Waldorfschule schnell als »Markenzeichen«
angeheftet werden: »An der Waldorfschule
darf man nicht Fernsehschauen, Comic lesen,
Cola trinken, Jeans tragen … und besonders
nicht Fußball spielen.«
So beginnt beispielsweise auch ein Artikel der
renommierten Zeitschrift »Sportpädagogik«
mit den Sätzen: »Die Alltagserfahrung vieler
Waldorfschüler und ihrer Eltern zeigen: Fuß-
ballspielen ist an Waldorfschulen verboten!
Begründungen dafür werden von Waldorfleh-
rern meist nicht gegeben oder so mystisch-
mysteriös formuliert, als hätten sie das Ziel,
Verwirrung statt Klarheit zu schaffen.« 1
Die an der Waldorfpädagogik interessierte
Öffentlichkeit stößt sich immer wieder an
zwei Punkten:
1. Die von Seiten der Waldorfschulen vorge-
brachten Argumente gegen das Fußball-
spiel werden als unverständlich und »fa-
denscheinig« erlebt.
2. Die offizielle Position der Waldorfschulen
gegen das Fußballspiel wird als antiquiert
und dogmatisch bewertet.
Argumente gegen das Fußballspiel
Eine komprimierte Zusammenstellung aller
bisher von Waldorfseite publizierten oder
zitierten Argumente gegen das Fußballspiel
lässt sich in sieben Bereiche einteilen:
688 Erziehungskunst 6/20061. Gewaltbereitschaft
Das Schüren von Gewalt stellt in Waldorf-
kreisen ein grundlegendes Gegenargument
dar und lässt sich auch durch Fakten aus der
Sportwissenschaft unschwer belegen.
Fußball nimmt statistisch bei der Berufsge-
nossenschaft in der Rangskala der verlet-
zungsträchtigen Sportarten einen vorderen
Platz ein. Wie kaum eine andere Sportart
zählt Fußball (obwohl es Damenfußball gibt)
zu den dominant maskulinen Disziplinen, in
denen sich psychische und soziale Formen der
Aggression und Gewalt (»Macho-Allüren«)
relativ ungehindert ausleben können.
Der spezifische Zungenschlag ist gewaltför-
mig und militant: »Nach dem Schlachtplan ih-
rer Generäle rollen da Panzer übers Spielfeld, 2. Reduktionen und Einseitigkeiten
belagern Stürmer den gegnerischen Strafraum, Das bekannteste waldorfpädagogische Argu-
werden Stoßkeile in die Deckung getrieben, ment gegen das Fußballspiel entstammt der
wird über die Flügel attackiert, das Tor mit anthroposophischen Anthropologie, welche
einer Dauerkanonade bestrichen, der Torhü- den Menschen in einen Kopfbereich mit dem
ter einem Bombenhagel ausgesetzt; da steht Nerven-Sinnes-System (Denken), den Brust-
der Vorstopper wie ein Turm in der Schlacht, bereich mit dem Rhythmischen System (Füh-
verfehlt ein Kopfball-Torpedo oder eine Frei- len) und einen dritten Bereich mit dem Stoff-
stoß-Granate ihr Ziel nur knapp, trifft ein wechsel-Gliedmaßensystem (Wollen) glie-
Querschläger plötzlich ins Schwarze, tritt eine dert. Was den Menschen primär vom Tier
Truppe mit dem letzten Aufgebot an, werden unterscheidet, ist die »Umbildung« des Stoff-
Wunderwaffen eingesetzt, um die Ladehem- wechsel-Gliedmaßensystems, das heißt, die
mung zu beheben.« Die Frage liegt nahe: Hat Umwandlung der beiden vorderen Beine in
der Fußball etwas mit wirklichen Konflikten Arme und Hände. Somit sind zwei Gliedmaßen
zu tun? Vielleicht sogar mit Kriegen?2 von der hauptsächlichen Funktion der Fortbe-
Nur der Fußballsport hat eine Fankultur er- wegung befreit worden und haben dadurch
zeugt, in der die Eskalation von Gewalt tagtäg- die »handwerklich«-technische und kulturelle
lich ist und als »normale Nebenerscheinung« Entwicklung des Menschen ermöglicht.
breite Akzeptanz genießt. Bekanntermaßen ist Beim Fußballspiel dagegen zeigt sich das
für viele Hooligans ein Fußballmatch der ge- entgegengesetzte Bild: Arme und Hände, das
suchte Anlass, um Stadion- und Straßenkämp- spezifisch Humane, sind ausgeschaltet und
fe, Randale und Krawalle zu inszenieren. Von verboten; stattdessen wird wie in keiner an-
Anfang an war das Fußballspiel belastet mit deren Disziplin eine bloße Kultur der Beine
Negativ-Rekordbilanzen: 1964 starben 350 gepflegt.
Fans in Lima, 1968 waren es 73 in Buenos Die Reduzierung der menschlichen Wesens-
Aires, 1969 fand der Fußballkrieg zwischen bestandteile geht dann so weit, dass auch der
Honduras und Salvador statt, 66 Tote 1971 in Kopf zu einem Gliedmaßenorgan umfunktio-
Glasgow, 1979 in Hamburg 62 Schwerverletz- niert wird: In seiner Möglichkeit, per »Kopf-
te, 38 Tote, zahllose Verletzte und Schwerver- stöße« zu agieren und Tore zu erzielen, erhält
letzte 1985 in Brüssel … er die Bedeutung eines dritten »Fußes«.
Erziehungskunst 6/2006 6893. Beutejägerinstinkte naissance im 15. Jahrhundert in Florenz auf-
Gerade das Fußballspiel birgt eine Fülle an kam. (Fußballspiel heißt ital. »calcio« = Fuß-
evolutiv alten Relikten, von Verhaltensmus- tritt.) Zur vollen Blüte gelangt das Fußballspiel
tern, die in prähistorischer Zeit angeeignet jedoch erst im England des 19. Jahrhunderts,
wurden. In den Augen der Verhaltensforscher wo das Spiel an den Eliteschulen (v.a. Eton
ist jeder Fußballclub wie ein eigener Stamm und Cambridge) stärker geregelt wurde und
aufgebaut, der analog aus Stammesterrito- im Jahr 1863 in London der erste Fußballver-
rium, Stammesältesten, Medizinmännern, band aus der Taufe gehoben wurde.
Helden, Schlachtenbummlern und anderen Fußballhistoriker kennen neben dieser pro-
Stammesmitgliedern besteht. Wie archaische fanen Entwicklungsgeschichte auch eine
Stämme unterscheiden sie sich durch lautstar- zweite Wurzel, die aus einer kultischen Tra-
ken Kriegsgesang, farbige Schaustellungen, dition herstammt. In den alten Hochkulturen
irrationalen Aberglauben, magische Riten und wurde der Ball als Symbol der Sonne ange-
kuriose Stammesgebräuche.3 sehen. Die kreisförmig aufgestellten Spieler
Der Grundgedanke dieser Theorie ist, dass der versuchten, den Ball möglichst lange in der
moderne Fußballspieler als »Torjäger« seine Luft, »am Himmel« zu halten. Die Spielidee
prähistorischen Instinkte als »Beutejäger« aus- aus der Antike, den Ball oben zu halten oder
lebt. Erstaunlicherweise beschreiben viele pro- ihn nach einem wilden Kampf an geheiligter
minente Fußballer, dass sie beim Spiel von un- Stelle (im Mittelalter waren die »Tore« oft
erklärlichen atavististischen Instinkten gepackt Kirchenportale oder Kultplätze) abzulegen,
werden und das Spiel wie eine Schlacht oder ging erst mit der aufkommenden Neuzeit
ein martialischer Kampf ums Überleben vor- verloren. Von nun an tauchte der Ball in die
überzieht. Im Leben eines Torjägers wird in Sphäre des Fußes ein, und gleichzeitig kippte
den 90 Minuten der Ball zur Waffe, mit der er seine Bedeutung: Er verlor den Symbolgehalt
auf die Beute (das Tor) zielt und schießt. Um als Kultgegenstand und wurde Waffe und Be-
den »Jagdgott gnädig zu stimmen«, werden sitzgegenstand – ein profanes Sportgerät, das
von Fußballern und ihren Anhängern eine Un- mit den Füßen traktiert wird.
zahl von abergläubischen Ritualen vollzogen. Ist nicht das Treten auf einen Gegenstand der
Beinahe wie in alten Stammeskulturen findet perfekte Ausdruck des Wunsches, die Dinge
auch in der Welt des Fußballs eine abgöt- von oben herab zu behandeln, geboren aus der
tische Heldenverehrung statt. Beispiel: Pelé. Lust, sich nicht bücken zu müssen, wie der
Im Laufe seiner Fußballkarriere ist er mit Autor Peter Handke meint? Steckt im Fußtritt
zehn Königen, zwei Päpsten und 38 anderen nicht die Geste der Verachtung, weil das Er-
Staatsoberhäuptern zusammengetroffen. Für niedrigendste, was einem Menschen angetan
Pelé hielten Nigeria und Biafra zwei Tage den werden kann, ihn mit den Füßen zu treten, im
Krieg an, damit beide Länder das Spiel des Stoß des Balles gleichermaßen versteckt wie
berühmten Fußballhelden sehen konnten. bewahrt ist?
Heute sind es jedoch auch die Spieler selbst,
die »gejagt« werden: Horrende »Ablösesum- 5. Fußball als Religionsersatz
men« (z.B. 70 Millionen Euro für den Spieler Schon längst schmücken sich die Fußballan-
des FC Barcelona Ronaldinho) machen die hänger damit, dass ihre Gemeinde und ihr
Fußballer nun selbst zu einer »Beute«. »Glauben« größer sei, als der irgend einer
Religion. Tatsächlich sind die Ereignisse, die
4. Kultische Tradition die größten Menschenmassen anziehen, we-
Es darf als gesichert angenommen werden, der religiöser noch politischer, wissenschaft-
dass das eigentliche Fußballspiel mit der Re- licher oder künstlerischer Art, sondern banale
690 Erziehungskunst 6/2006Fußballspiele und Olympiaden, wie das letzte
WM-Endspiel, das drei Milliarden Zuschau-
er verzeichnen konnte. Die Fußballgemeinde
zählt weltweit 240 Millionen Anhänger. Im
Hinblick auf die leeren Kirchen und vollen
Stadien ist es wohl mehr als eine perfide Me-
tapher, wenn vom »Umzug der Götter ins
Stadion« gesprochen wird. Wie Religionsso-
ziologen4 dargestellt haben, haben Fußball-
gemeinden wesentliche Merkmale mit Glau-
bensgemeinden gemeinsam: Fußball-Idole
als populäre »Heilige«, Mannschaften als
Gottheiten, Stadien als »heilige Stätten«, Ball
und Vereinsfahne als »heilige Gegenstände«
oder »Reliquien«, das Spiel als Gottesdienst
… Berühmt wurden z.B. die »Schalke-Mes-
sen«, als in einer Saison regelmäßig 40.000
Menschen im Stadion darum beteten, dass die sein – wie dies im »SPIEGEL-Special« be-
Mannschaft nicht absteige. Eigenartigerweise schrieben wurde: »Im Kalten Krieg galt ›der
ist eine Anzahl der Schlachtenbummlerlieder Russe‹ als böse. Irgendwie war in der Wahr-
direkt aus dem Gebetbuch übernommen. Wie nehmung des Westens jeder Russe ein klei-
die Ordensvertreter tragen auch die treuen ner Breschnew. Und dann kam Oleg Blochin
Fußballgläubigen eine »Kutte«, die sie als die und zauberte seine Tore. Plötzlich gab es
jeweiligen Vertreter einer Gemeinde ausweist, zwei ›Russen‹, Breschnew und Blochin, der
und kaum einmal fehlt der Aufnäher »Fußball eigentlich Ukrainer ist, aber das spielte da-
ist meine Religion!«. mals keine Rolle. Und wenn es zwei Russen
gibt, dann gibt es vielleicht sogar noch mehr.
6. Fußball und Rassismus Am Ende, dachte man, ist sogar jeder Russe
Der internationale Fußball ist gleichzeitig ein Individuum, und davon gibt’s ja, wie man
eine Triebfeder des Nationalgefühls und dabei wusste, böse und gute. Fußball hat die Welt
zur selben Zeit eine Bremse des Rassismus: deshalb nicht vor verheerenden Kriegen ge-
Während ein Fan der deutschen National- rettet, aber er hat dazu beigetragen, dass der
mannschaft lautstark den Gegner aus einem Hass nicht überbordend wurde. Was könnte
lateinamerikanischen Land beschimpft, ist es der Welt also Besseres passieren, als wenn die
vielleicht gerade einer der farbigen Spieler in großen Stars dieser WM ein Iraner und ein
der heimischen Nationalmannschaft, der das Amerikaner würden.«5
entscheidende Tor schießt.
Auf der einen Seite ist bekannt, dass die Ver- 7. Spirituelle Hintergründe
götzung des Fußballspiels bereits so weit ge- Von Seiten der Anthroposophie existiert noch
gangen ist, dass es in den letzten Jahrzehnten eine weiterführende Deutungsebene, welche
zu kleineren Völkerkriegen kam. Bekannt ist dem Aufstellungssystem und Spielgedanken
auch die Tatsache, dass die Fußball-Weltmeis- eine tiefere, »überzufällige« Bedeutung zu-
terschaft auf allen Kontinenten Öl ins Feuer schreibt. Dabei wird Bezug auf das früher
des Nationalstolzes gießen wird. allgemeingültige Aufstellungssystem der
Andererseits kann der Fußball jedoch auch Passpyramide genommen: Torwart, zwei Ver-
eine Brücke zwischen Staaten und Völkern teidiger, drei Läufer, fünf Stürmer. Analog zu
Erziehungskunst 6/2006 691den unterschiedlichen Funktionen und dem auf die Abendblätter. Auf was warteten Sie?
typischen Aktionsprofil von Verteidigern, Auf den Ausgang des Fußballspiels! […]
Läufern und Stürmern wurde ein frappieren- Ja, wofür interessieren sich heute die Men-
de Übereinstimmung mit den Bestandteilen schen? Also viel mehr als irgendein Ereig-
des menschlichen Seelengefüges festgestellt: nis, das mit Wohl und Wehe von Millionen
Die fünf Stürmer mit ihrem wendigen, ner- Menschen etwas zu tun hat, interessieren sich
vös-quirligen Erscheinungsbild entsprechen heute die Leute für diese Dinge, die nach und
dabei dem Nervensinnespol und gleichzeitig nach den physischen Leib wegziehen vom
auch der Anzahl der fünf Sinne. Die beiden Ätherleib, so dass der Mensch überhaupt nur
Verteidiger dagegen sind meist robust, mas- mehr ein Erdentier wird. Das ist der Grund,
sige, willensgestählte »Schränke«, für das warum den Bewegungen, die heute in aller
»Ausholzen« und den Spielaufbau von unten Welt gemacht werden und die immer weiter
zuständig und leicht als Vertreter des Stoff- und weiter sich verbreiten, andere entgegen-
wechsel-Gliedmaßentyps zu identifizieren. gesetzt werden müssen. Das sind die euryth-
Schließlich sind noch die drei Läufer das mischen Bewegungen. Die richten sich nach
mittlere, verbindende Glied, für den gleich- dem Ätherleib. […] Wenn Sie Sport sehen,
mäßigen Spielfluss unerlässlich, welche das werden Sie alle diejenigen Bewegungen seh-
rhythmische System repräsentieren«.6 en, die der physische Leib ausführt […] Zu-
Derjenige, der bereit ist, diesem Gedanken- gleich gibt es die Sehnsucht nach dem Sport.
gang zu folgen, wird in machen Ballspielen Ich will nun nicht gegen den Sport im Allge-
ein verblüffend getreues, miniaturisiert nach- meinen reden. Der Sport ist natürlich, wenn er
gestelltes Abbild des Weges der Höherent- betrieben wird von Menschen, die außerdem
wicklung des Menschen wiederfinden. Und arbeiten, ganz gut, denn in der Arbeit muss
tatsächlich ist die »Passpyramide« in den An- man sich mehr unnatürliche Bewegungen
fangszeiten des Fußballs, die alleinige Auf- angewöhnen; wenn man dann im Sport na-
stellungsform gewesen und heute noch als türliche Bewegungen hineinbringt, die mehr
»klassische Aufstellungsform« bekannt. dem physischen Menschen angepasst sind,
dann ist das Erholen im Sport gut. Aber dieses
Waldorfpädagogik und Fußball heutige Treiben von Sport, wo auch viele
im Abseits Menschen teilnehmen, die gar nicht sich zu
erholen brauchen, was ist denn dies? Ja, es
Dass das Fußballspielen an vielen Waldorf- gibt heute Sportsleute, die gehen unter Um-
schulen, besonders in der Vergangenheit, ständen – natürlich nicht alle, aber einzelne
beinahe apodiktisch abgelehnt wurde, geht – gibt es schon – rasch einmal morgens in die
meines Wissens – nicht direkt auf Rudolf Stei- Kirche, da beten sie … […]. Dann gehen sie
ner zurück. Es gibt von ihm nur eine einzige auf den Sportplatz. Ja, da sprechen sie es nicht
gezielte Äußerung über das Fußballspiel. Da mit Worten aus, aber was die da tun, wenn
diese Stelle in den so genannten Arbeitervor- man es in Worte fasst, so heißt das: Ich glaube
trägen durch ihre Einmaligkeit ein besonderes ja nicht an einen Gott im Himmel. Der hat mir
Gewicht erhält und da hierbei auch Steiners den Ätherleib gegeben, aber von dem will ich
abwägendes und differenzierendes Verhältnis nichts wissen. Ich glaube an Fleisch und Kno-
zum Sport deutlich wird, soll diese Passage chen, das ist meine einzige Seligkeit. – Sehen
etwas ausführlicher zitiert werden: »Sehen Sie, das ist natürlich die notwendige, unbe-
Sie, ich war letzten Sommer auch in England. wusste Folge desjenigen, was heute getrieben
Gerade als wir abreisten, war ganz England wird. Nicht bloß dadurch, dass man sagt, man
voller Erregung […] Alles wartete gespannt will nichts wissen vom Geistigen, ist man Ma-
692 Erziehungskunst 6/2006terialist, sondern durch solche Sachen, durch schulen heute noch angebracht ist. Gegen eine
die man den ganzen Menschen losreißt vom streng fundamentalistische Richtung spricht,
Geistigen.«8 dass jede unangebracht dogmatische, autori-
Trotz dieser Differenzierungen bei Steiner täre Erziehungspraxis den Reiz des Verbote-
kam es an den Waldorfschulen bis zum heu- nen erhöht, heimliche Lehrpläne provoziert
tigen Tage zu einem oft unausgesprochenen, und letztlich zum Eigentor wird. Zumindest
aber rigorosen »Verbot« des Fußballes. Am könnten durch eine Entkrampfung Feindbilder
Anfang dieser Tradition einer radikalen Fuß- und Blockbildungen abgebaut werden und die
ball-Ablehnung mag ein Satz im alten »Hey- Zahl der durch »Moralapostel« abgeschreck-
debrand-Lehrplan« von 1926 gestanden ha- ten Waldorfschüler, konsternierten Waldorf-
ben: »Das Fußballspiel ist den Schülern auf eltern, irritierten Freunde und schadenfrohen
dem Schulgelände verboten; es schädigt die Gegner vermindert werden.
körperliche, seelische und geistige Entwick- Als bei einem Lehrerkurs in England die Fra-
lung in den Schuljahren.«9 Das zweite Mal, ge an Steiner gestellt wurde, ob es sinnvoll
bei dem von einem Verbot des Fußballs durch sei, Sportarten wie Hockey und Cricket in den
Steiner die Rede war, war in einem Artikel Waldorflehrplan aufzunehmen, antwortete er
über den »griechischen Fünfkampf« aus dem nach Abwägung des Für und Widers: »Es
Jahre 1962, in dem behauptet wurde, Steiner ist durchaus nicht die Absicht der Waldorf-
lehnte das Fußballspiel als pädagogisches schulmethode, diese Dinge zu unterdrücken,
Mittel ab und verbot es für die Waldorfschu- Sie können schon betrieben werden, einfach
len.10 weil sie im englischen Leben eine große Rolle
Aufgrund dieser Haltung hat sich die euro- spielen und das Kind ins Leben hineinwach-
päische Waldorfbewegung in der breiten Öf- sen soll … Er (dieser Sport, M.B.) hat nur
fentlichkeit in puncto Fußball allmählich ins einen Wert, weil er eben eine beliebte Mode
Abseits manövriert. Verschiedene Waldorf- ist, und man soll durchaus das Kind nicht zum
schulen versuchen mittlerweile mit einem Weltfremdling machen und es von allen Mo-
liberaleren Kurs, den Weg zwischen Skylla den ausschließen. Man liebt Sport in England,
und Charybdis, zwischen Dogmatismus und also soll man das Kind auch in den Sport ein-
Laisser-faire zu finden. führen.«11 Sicherlich ist Fußball nicht Hockey
Hier sind Waldorfschulen aufgefordert, nach oder Cricket, doch bliebe auch hier zu fragen,
Alternativen zum Fußballspielen zu suchen. ob nicht trotz aller berechtigter Einwände ge-
Wenn davon auszugehen ist, dass es vor allem gen den Fußball auch hier eine zwar kritische,
die Sehnsucht der jungen Menschen nach Aben- aber dennoch unverkrampfte, undogmatische
teuer, Spannung und Spiel und unverbrüch- Haltung lebensnäher und zeitgemäßer wäre.12
licher Gemeinschaft (»Mannschaftsgeist«) ist, So sehr es gerade in einer Phase der starken
so kann daraus ein Ersatz für das Bedürfnis Expansion der Waldorfbewegung notwendig
nach Fußballspielen abgeleitet werden. ist, sie vor einer »Verwässerung der Sub-
Beispielsweise sind diese Elemente ebenfalls stanz« zu schützen, so sehr wäre darauf zu
in Abenteuer-Aktivitäten innerhalb der Schule achten, dass die Waldorfbewegung nicht
(Abenteuer-Projekte, Sport-AGs, Zirkuspro- durch einseitige Vorstellungen in ein schräges
jekte, Waldorfjugendgruppe) oder außerhalb Licht gerät. Michael Birnthaler
der Schule (Ferienlager, Jugendprojekte) wie-
derzufinden. Zum Autor: Diplompädagoge, Waldorflehrer 1992-
2000 (Sport), Dozent in der Lehrerbildung, Gründung
Vor diesem Hintergrund wäre zu prüfen und
und Leitung von EOS-Erlebnispädagogik (Ferienlager,
abzuwägen, ob eine fundamentalistische Po- Klassenfahrten, Erlebnispädagogik-Ausbildungen,
sition gegenüber Fußballspiel an Waldorf- Firmentrainings, Schulberatungen; www.eos-ep.de)
Erziehungskunst 6/2006 693Anmerkungen: 1 Harald Gießler, in: Zeitschrift »Sportpädagogik« 1/1996, S. 18 2 Bausenwein, Christoph: Geheimnis Fußball, Göt- tingen 1995, S. 249 3 Siehe: Morris, Desmond: Das Spiel, München 1981 4 Z.B. Emile Durkheim, in: Bausenheim, Christoph: Geheimnis Fußball. Auf den Spuren eines Phäno- mens, Göttingen 2006 5 SPIEGEL Special, 2, 2006, S. 23 6 Kischnick, R: Leibesübung und Bewusstseins- schulung, Basel 1955, S. 156 ff. 7 Frankfurt, Heinz: Gedanken zum Fußball, in: »Er- ziehungskunst« 6/1974, S. 204 ff. 8 Hergang und voller Wortlaut ist zu entnehmen aus: Husemann, Gisbert: Das Fußballspiel im Urteil Rudolf Steiners, in »Erziehungskunst« 10/1981, S. 581; dort mit Bezug auf GA 350, Vortrag vom 30.5.1923, Dornach 1980, S. 28 9 Von Heydebrand, Caroline: Vom Lehrplan der Freuen Waldorfschule, Stuttgart 1990 10 Kischnick, Rudolf: Griechischer Fünfkampf und Leibeserziehung, in: »Erziehungskunst« 10/1962, S. 299 11 Steiner, Rudolf: Die Kunst des Erziehens, GA 311, Fragenbeantwortung 20.8.1924, Dornach 1989, S. 139 12 So wurde in einer skizzenhaften Kontroverse über Fußballspielen an der Waldorfschule in den Grazer Schulmitteilungen, wiederabgedruckt in der Zeit- schrift »Info3« 6/1996 von der einen Seite bereits entschieden für eine Lockerung der Position ge- worben. Diese Auffassung wurde auch geäußert von Johannes Kiersch: Fragen an die Waldorfschu- le, Flensburg 1991, S. 64 f. 694 Erziehungskunst 6/2006
Sie können auch lesen