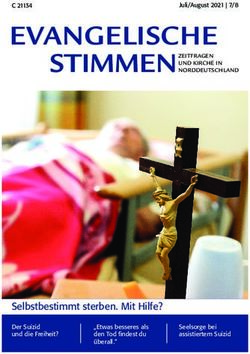Deus caritas est Sozialethische Anmerkungen zur Antrittsenzyklika Benedikts XVI. im Blick auf ein prophetisches Diakonat
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Deus caritas est
Sozialethische Anmerkungen zur Antrittsenzyklika
Benedikts XVI. im Blick auf ein prophetisches Diakonat
von Andreas Lob-Hüdepohl, Berlin
veröffentlicht in:
Diaconia christi 41/2006, Heft 2, S. 79-89
Mit freundlicher Genehmigung des Herausgebers1
1. Vorbemerkungen: Vielfältige Überraschungen
Kurz vor seiner Ermordung 1945 wandte sich der Widerstandskämpfer und Jesuitenpater Alfred
Delp SJ mit einem leidenschaftlichen Appell an seine Kirche. Von zwei Sachverhalten, so Delps
feste Überzeugung, werde es abhängen, ob die Kirche Christi ihre Zukunft finde. Erstens von
der Wiederentdeckung ihrer Sakramentalität: „Die Kirche muss sich selbst viel mehr als Sakra-
ment, als Weg und Mittel begreifen, nicht als Ziel und Ende.“ Und zweitens von ihrer „Rück-
kehr in die Diakonie: in den Dienst der Menschheit. Und zwar in einen Dienst, den die Not
der Menschheit bestimmt, nicht unser Geschmack oder das Consuetudinarium einer noch so
bewährten kirchlichen Gemeinschaft. ‚Der Menschsohn ist nicht gekommen, sich nur bedienen
zu lassen, sondern zu dienen.‘ Man muss nur die verschiedenen Realitäten kirchlicher Existenz
einmal unter dieses Gesetz rufen und an dieser Aussage messen, und man weiß eigentlich schon
genug. Es wird kein Mensch an die Botschaft vom Heil und vom Heiland glauben, solange wir
uns nicht blutig geschunden haben im Dienste des physisch, psychisch, sozial, wirtschaftlich,
sittlich oder sonst wie kranken Menschen.“2
Gut sechzig Jahre später veröffentlicht Papst Benedikt XVI. seine Antrittsenzyklika Deus
Caritas Est (DCE), und es scheint, als ob er diesen leidenschaftlichen, ja prophetischen Appell
Alfred Delps im Ohr bzw. vor Augen gehabt hat, als er sich der Liebe Gottes als des Zentrums
des Evangeliums Jesu Christi und damit auch des Wirkens der Kirche in unserer Welt in dieser
ausführlichen und prominenten Weise seines ersten päpstlichen Lehrschreibens widmete. Zwar
hat sich seit dem Appell Alfred Delps schon viel gewandelt. Die dogmatische Konstitution des
Zweiten Vatikanischen Konzils Lumen gentium hebt an mit der Wesensbestimmung der Kirche
als Sakrament, also als Zeichen und Werkzeug (und damit nicht als Selbstzweck) „für die innig-
ste Vereinigung mit Gott wie für die Einheit der ganzen Menschheit“ (LG 1). Aus diesem Grund
folgt unmittelbar die Programmatik der Pastoralkonstitution Gaudium et spes: „Freude und
Hoffnung, Trauer und Angst der Menschen heute, besonders der Armen und Bedrängten aller
Art, sind auch Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Jünger Christi.“ (GS 1)
Dennoch sorgt(e) die Enzyklika Deus Caritas est für einige Überraschungen. Als erstes
päpstliches Lehrschreiben konzentriert sie sich auf die Liebe als Inbegriff der Gegenwart Gottes
und damit als Herzmitte christlichen Glaubens. Für einen ehemaligen Präfekten der Glau-
benskongregation unerwartet definiert er den Glauben primär als Beziehungsgeschehen: „Am
Anfang des Christseins steht nicht ein ethischer Entschluss oder eine große Idee, sondern die
Begegnung mit einem Ereignis, mit einer Person, die unserem Leben einen neuen Horizont und
1 Der vorliegende Text geht zurück auf einen Vortrag, den ich am 7.10.2006 auf dem Diakonentag des Bistums
Rottenburg-Stuttgart in Ludwigsburg gehalten habe. Den Duktus des Vortrages habe ich bewusst erhalten
und damit den wissenschaftlichen Anmerkungsapparat auf das Nötigste beschränkt.
2 Alfred Delp: Das Schicksal der Kirchen. In: Im Angesicht des Todes, Frankfurt/M. 11.A. 1981, S. 138–144, hier:
S. 139f.
79Deus Caritas est
damit seine entscheidende Richtung gibt.“ (DCE 1)3 Überraschend auch, dass der Hauptfokus
dieses Lehrschreibens über die Liebe nicht auf ihrer intimen Dimension zwischenmenschlicher
Sexualität liegt, sondern ihre soziale Dimension im Modus caritativen Handelns ins Bewusst-
sein hebt; so stark, dass diese Caritas nicht nur als unverzichtbar für das Christsein als solches,
sondern sogar als ein geordnetes Grundamt der Kirche ausgewiesen wird. Diese – von der Tra-
dition der Kirche eigentlich sehr naheliegende – Feststellung ist in Zeiten, in denen prominente
Unternehmensberatungen die Konzentration auf das kirchliche Kerngeschäft der Verkündigung
und der Liturgie nahe legen, eine klare (und wie ich meine: notwendige wie heilsame) Abgren-
zung contra McKinsey.
Freilich enthält die Enzyklika auch Überraschungen, die vielleicht nicht wenige irritie-
ren. Besonders ihre Feststellung, dass die kirchliche Caritas kein unmittelbares Mandat für
den Aufbau sozialer Gerechtigkeit in einer Gesellschaft besitzt, könnte die Vermutung nähren,
Benedikt XVI. wolle sich behutsam von der Position seines Vorgängers absetzen. Johannes Paul
II. hat nämlich in seinem Lehrschreiben Centesimus annus die Kirche noch als Teil jener „Groß-
bewegung zur Verteidigung und zum Schutz der Würde des Menschen“ bezeichnet, die „in den
Wechselfällen der Geschichte zum Aufbau einer gerechten Gesellschaft beigetragen und dem
Unrecht eine Grenze gesetzt“ hat (CA 3). Steht die caritative Liebe der Kirche damit nicht im
Widerspruch zum prophetischen Wächteramt der Kirche (und folglich auch ihres diakonischen
Grundamtes), das in der Erfahrung struktureller Ungerechtigkeiten, in der Missachtung von
Menschenrechten aller Art eintritt für Recht und Gerechtigkeit? Besonders dieser Frage soll im
Folgenden nachgegangen werden.
2. Die Einheit von Gottes- und Nächstenliebe als therapeutische Dimension
der Erlösung
Ich will zunächst einige wenige Schlaglichter auf die Kernaussagen der Enzyklika werfen. Dabei
folge ich nicht der Gliederung der Enzyklika, deren erster Teil systematisch die „Einheit der
Liebe in Schöpfung und Heilsgeschichte“ entwickelt und die im zweiten Teil diese Einheit auf
„das Liebestun der Kirche als einer ‚Gemeinschaft der Liebe‘“ entfaltet. Ich will und muss mich
auf die Verzahnung von Gottes- und Nächstenliebe beschränken und werde deshalb die Aus-
führungen des Papstes anders gliedern. Gleichwohl will ich die Enzyklika durch ausführliche
Zitate möglichst häufig unmittelbar zu Wort kommen lassen, um die bemerkenswerte Einfühl-
samkeit wie Eindringlichkeit ihrer Sprache wenigstens ansatzweise widerzuspiegeln.
Gottesliebe als unbedingte Liebe Gottes zum Menschen
Die gewohnte Rede von der Einheit von Gottes- und Nächstenliebe lässt gelegentlich in Vergessen-
heit geraten, dass Gottesliebe zunächst die Liebe Gottes zum Menschen meint. Die Liebe Gottes
zum Menschen ist im eigentlichen Sinne des Wortes ‚Grund legend‘: Sie ist völlig ungeschuldet
(und in diesem Sinne barmherzig) und gilt dennoch, besser: darin unbedingt jedem einzelnen
– vor aller Leistung, trotz aller Schuld. Sie ist die „Liebe, die Gott dem Menschen in geheimnis-
voller Weise und völlig vorleistungsfrei anbietet“ (DCE 1). Und ich ergänze: Diese Liebe Gottes
ist keine bloße Idee oder kein geistiger Akt, sondern leibliches, ‚fleischliches‘ Geschehen. Gott
als die Liebe ist Mensch geworden und hat unter uns gelebt – als Mann aus Nazareth, als heilsam
befreiende Lebensgeschichte des Gottessohnes, dessen Gemeinsame-Sache-Machen (‚Solidari-
3 Mit Blick auf den Theologen Josef Ratzinger ist diese Feststellung freilich nicht überraschend. In seiner
Einführung in das Christentum stellt er schon 1968 apodiktisch fest: „Christlicher Glaube ist nicht Idee, son-
dern Leben, ist nicht für sich seiender Geist, sondern Inkarnation, Geist im Leib der Geschichte und ihres
Wir.“ (zitiert nach der 7. Auflage, München 1968, S. 69.)
80Lob-Hüdepohl, „Deus Caritas est“. Sozialethische Anmerkungen
tät‘) mit den in Unheil verstrickten Menschen soweit ging, dass er den Fluch beladenen Tod am
Kreuz nicht scheute; dessen Auferweckung von den Toten reales Symbol für die Wirklichkeit
eines Gottes ist, der seinem Sohn wie letztlich jedem von uns auch durch den Tod die Treue hält
und weder ihn noch uns der endgültigen Vernichtung ausliefert; der damit auch jedem von uns
die Möglichkeit zuspielt, durch seine Liebe zu uns – von der Angst um uns selbst befreit – dem
Nächsten, dem Anderen in liebender Solidarität zu begegnen, ohne die Erwiderung unserer
Liebe seitens des anderen für unsere eigene Sicherheit einkalkulieren zu müssen. In dieser Liebe
Gottes zu uns spiegelt sich also so etwas wie die heilsam therapeutische Dimension christlicher
Erlösung.4
Nächstenliebe, von Gott her ermöglicht und erwünscht
Die Erfahrung der unbedingten Liebe Gottes zu jedem von uns im Rücken setzt in uns die
Möglichkeit frei, auch anderen in Liebe zu begegnen: Gott „liebt uns, lässt uns seine Liebe sehen
und spüren, und aus diesem ‚Zuerst‘ Gottes kann als Antwort auch in uns die Liebe aufkeimen.“
(DCE 17) Hier wird die für ein christliches Ethos typische Verschränkung von Heilsindikativ
und Handlungsoptativ sichtbar: Des Menschen Liebe zu Gott und zum Menschen „lebt von der
uns zuvorkommenden Liebe Gottes, der uns zuerst geliebt hat. So ist es nicht mehr ein ‚Gebot‘
von außen her, das uns Unmögliches vorschreibt, sondern geschenkte Erfahrung der Liebe von
innen her, die ihrem wahren Wesen nach sich weiter mitteilen muss. Liebe wächst durch Liebe.
Sie ist ‚göttlich‘, weil sie von Gott kommt und uns mit Gott eint, uns in diesem Einigungsprozess
zu einem Wir macht, das unsere Trennungen überwindet und uns eins werden lässt, so dass am
Ende ‚Gott alles in allem‘ ist.“ (DCE 18)
Nächstenliebe als Darstellung der Liebe Gottes zum Menschen und Ort
liebender Gottesbegegnung von Seiten des Menschen
Das unbedingte Bejahtsein des Menschen durch Gott wird erfahren in und durch die liebende
Kommunikation zwischen Menschen, deren realsymbolisch äußerste Verdichtung die Erfah-
rung eucharistischer Gemeinschaft ist: „Die ‚Mystik‘ des Sakraments hat sozialen Charakter.
Denn in der Kommunion werde ich mit dem Herrn vereint wie alle anderen Kommunikanten.
(…) Die Vereinigung mit Christus ist zugleich eine Vereinigung mit allen anderen, denen er sich
schenkt.“ (DCE 14) Die von Jesus, dem Christus, ermöglichte Teilhabe an dem einen Brot ist
zeitgleich die realsymbolische Vereinigung des Menschen mit Gott wie mit den Mitmenschen.
Umgekehrt findet darin die Einheit von Gottes- und Nächstenliebe ihren Ursprung. Die Liebe
zum Nächsten ist jener privilegierte Ort, an dem der Mensch auch seinem Schöpfer- und Erlö-
sergott begegnet. Sie ist für die liebende Gottesbeziehung des Menschen unumgänglich: „Wenn
ich aber die Zuwendung zum Nächsten aus meinem Leben ganz weglasse und nur ‚fromm‘ sein
möchte, nur meine ‚religiösen Pflichten‘ tun, dann verdorrt auch die Gottesbeziehung. Nur
meine Bereitschaft, auf den Nächsten zuzugehen, ihm Liebe zu erweisen, macht mich auch fühl-
sam Gott gegenüber.“ (DCE 18)
4 Dieses Grundmotiv ist entscheidend für eine im emphatischen Sinne christliche Sittlichkeit und Ethik. Vgl.
dazu ausführlicher etwa Andreas Lob-Hüdepohl: ‚Moralisch Handeln um der Menschwerdung der Menschen
willen!“ Zum Profil Theologischer Ethik. In: Barbara Henze (Hg.): Studium der Katholischen Theologie =
UTB 1894, Paderborn 1995, S. 195–230.
81Deus Caritas est Caritas als soziale Liebe und Grundamt der Kirche Das Tun der sozialen Liebe, das Tun der Caritas also, gehört zum Grundvollzug christlicher Existenz. Denn der christliche Glaube lässt sich ja begreifen als jenes hoffende Vertrauen des Menschen auf eine heilsam-befreiende, erlösend-liebende Wirklichkeit, die Christen als ihren Gott erfahren und durch ihr gleichfalls liebend-innovatorisches Handeln an sich und anderen – wenigstens fragmentarisch – bezeugen und bekennen. Die Enzyklika erinnert zugleich daran, dass das caritative Tun nicht nur konstitutiv für jeden einzelnen Christen ist, sondern auch für die Geistlichkeit der Kirche Christi insgesamt: Der „Ursprung des Diakonenamtes (…) bedeu- tet, dass der Sozialdienst, den sie zu leisten hatten, ein ganz konkreter, aber zugleich durchaus geistlicher Dienst und ihr Amt ein wirklich geistliches Amt war, das einen der Kirche wesent- lichen Auftrag – eben die geordnete Nächstenliebe – wahrnahm.“ (DCE 21) Wie bedeutsam die praktizierte Caritas für die äußere Erkennbarkeit wie Reputation der Kirche zu allen Zeiten war und ist, unterstreicht Benedikt XVI. durch einen auf den ersten Blick etwas eigentümlichen Hinweis auf einen der schärfsten frühchristlichen Kritiker: Als im 4. Jahrhundert Kaiser Julian der Apostat im römischen Reich die konstantinische Wende rückgängig zu machen trachtete, so beteuerte er gleichwohl, dass das einzige, was ihm am Christentum beeindrucken würde, die Liebestätigkeit der Kirche sei. (vgl. DCE 24) Fast scheint es, als antizipiere das Zitat aus früh- christlicher Zeit jene weitverbreitete Außenwahrnehmung unserer heutigen Zeit, der zufolge die Caritas der Kirche ein hoch beachtliches Vertrauen und Ansehen genießt, die anderen Dimensi- onen kirchlichen Lebens dagegen in der Gesellschaft wenig Ansehen besitzen. Caritas ohne Hintergedanken Schließlich wendet sich die Enzyklika gegen alle offenen oder versteckten Überlegungen, die die kirchliche Caritas für eigene Zwecke zu instrumentalisieren trachten. Praktizierte Nächstenliebe darf niemals als Mittel für Proselytismus missbraucht werden. Die absichtslose Liebe ist das beste Zeugnis für einen Gott, „der uns zur Liebe treibt. (…) Der Christ weiß, dass Gott Liebe ist (vgl. 1 Joh 4,8) und gerade dann gegenwärtig ist, wenn nichts als Liebe getan wird.“ (DCE 31) Weil es nicht um eine subtile Strategie zur Stärkung des eigenen, sondern allein um das Wohl der Menschen geht, wirkt der geordnete Liebesdienst der Kirche zusammen mit anderen christlichen und kirchlichen Gemeinschaften. Die „glückliche Verbindung von Evangelisierung und Liebeswerk“ hat überall „das gleiche Ziel vor Augen: einen wahren Humanismus, der im Menschen das Ebenbild Gottes erkennt, und ihm helfen will, ein Leben gemäß dieser seiner Würde zu verwirklichen.“ Dieser gemeinsame Einsatz ist, wie Benedikt XVI. mit Verweis auf die Enzyklika Ut unum sint betont, unbedingt erforderlich, „damit ‚der Achtung der Rechte und der Bedürfnisse aller, besonders der Armen, der Gedemütigten und der Schutzlosen zum Sieg verholfen wird‘.“ (DCE 31) 3. Die politisch-unpolitische Dimension christlicher Liebe Mit dieser ausdrücklichen Ausrichtung auf den wahren Humanismus und auf die Achtung der Rechte und Bedürfnisse besonders der Marginalisierten scheint das caritative Tun der Kirche endgültig in den politischen Raum vorzustoßen. Unmittelbare versus mittelbare Aufgabe der Kirche für die Schaffung sozialer Gerechtigkeit Doch die Enzyklika konfrontiert den Leser mit einer unerwartet schroffen Gegenüberstellung von caritativer Liebe und dem Einsatz für soziale Gerechtigkeit. Zunächst lässt die Enzyklika keinen Zweifel an der besonderen Dringlichkeit sozialer Gerechtigkeit, ja sie bindet das Ziel 82
Lob-Hüdepohl, „Deus Caritas est“. Sozialethische Anmerkungen
allen staatlichen Handelns an die Schaffung struktureller Gerechtigkeit. Gerechtigkeit ist erheb-
lich mehr als eine persönliche Tugend; sie ist als Ordnungsprinzip der Gesellschaft Ziel und
inneres Maß aller Politik: „Richtig ist, dass das Grundprinzip des Staates die Verfolgung der
Gerechtigkeit sein muss und dass es das Ziel einer gerechten Gesellschaftsordnung bildet, unter
Berücksichtigung des Subsidiaritätsprinzips jedem seinen Anteil an den Gütern der Gemein-
schaft zu gewährleisten.“ (DCE 26)
Doch so sehr Politik und Kirche an der Schaffung gerechter Strukturen und Verhältnisse
interessiert sind, um die Rechte und Bedürfnisse eines jeden Menschen abzusichern, so sehr
unterscheiden sich ihre spezifischen Aufgaben: „Die Kirche“, so warnt Benedikt XVI. eindrück-
lich, „kann nicht und darf nicht den politischen Kampf an sich reißen, um die möglichst gerechte
Gesellschaft zu verwirklichen. Sie kann und darf sich nicht an die Stelle des Staates setzen. Aber
sie kann und darf im Ringen um Gerechtigkeit auch nicht abseits bleiben. Sie muss auf dem
Weg der Argumentation in das Ringen der Vernunft eintreten, und sie muss die seelischen
Kräfte wecken, ohne die Gerechtigkeit, die immer auch Verzichte verlangt, sich nicht durchset-
zen und nicht gedeihen kann. Die gerechte Gesellschaft kann nicht das Werk der Kirche sein,
sondern muss von der Politik geschaffen werden. Aber das Mühen um die Gerechtigkeit durch
eine Öffnung von Erkenntnis und Willen für die Erfordernisse des Guten gehen sie zutiefst an.“
(DCE 28)
Infolgedessen besitzt die Kirche zwar keine unmittelbare, gleichwohl eine mittelbare Auf-
gabe für die Schaffung sozialer Gerechtigkeit. Die Enzyklika ist davon überzeugt, dass das poli-
tische Handeln etwa des Staates immer in der Gefahr steht, ethisch zu erblinden, wenn nicht
die praktische Vernunft – etwa in Gestalt der kirchlichen Soziallehre – die Vernunft der Politik
ethisch reinigt. Infolgedessen hat die Kirche nicht nur das Recht, sondern sogar die Pflicht,
„durch ethische Bildung ihren Beitrag zu leisten, damit die Ansprüche der Gerechtigkeit ein-
sichtig und politisch durchsetzbar bleiben.“ (DCE 28) Fast scheint es, als ob die Enzyklika jene
Grundintuition aufgreift, die in Deutschland schon 1997 für das Gemeinsame Wort der Kirchen
zur sozialen und wirtschaftlichen Lage leitend war. Denn auch hier betonten die Kirchen, dass
sie nicht selbst Politik zu machen beabsichtigen. Ihr Eintreten für eine gemeinwohlorientierte
Wertorientierung will stattdessen eine angemessene Politik wieder möglich machen und dabei
besonders den Stimmlosen und Ausgegrenzten im politischen Ringen Gehör verschaffen.5
Widerstand gegen Ungerechtigkeiten allein durch ethisches Argumentieren?
Diese strikte Unterscheidung der Zuständigkeiten von Politik und Kirche für die staatlich zu
garantierende soziale Gerechtigkeit geht von einer analytisch durchaus nachvollziehbaren,
lebensweltlich freilich allzu idealtypischen Unterstellung aus: dass sich nämlich Widerstand
gegen strukturelle Ungerechtigkeiten, die für eine erhebliche Anzahl prekärer Lebenslagen not-
leidender Menschen verantwortlich sind, in ausreichendem Maß allein durch ethische Bildung
und Argumentation aktivieren lässt. Die politische Gestaltung von Strukturen der Gesellschaft
und damit auch Strukturen sozialer Gerechtigkeit obliegt – zumindest was ihren legislativen Cha-
rakter angeht – gewiss allein demokratisch legitimierter staatlicher Gewalt. Gleichwohl eröffnen
moderne Gesellschaften einen politischen Raum, in dem nicht nur im Interesse einer humanen
Gesellschaft öffentlich räsoniert wird, sondern über konkrete Projektarbeit auch ‚handfestes‘
politisches Lobbying erfolgt. Projekte gegen die Verwahrlosung von Kindern und Jugendliche,
gegen Zwangsprostitution und unwürdige Arbeitsbedingungen, Projekte für eine lebensdien-
liche Ausgestaltung des sozialen Nahraumes oder für ein würdiges Leben im Alter, solche und
5 Vgl. Für eine Zukunft in Solidarität und Gerechtigkeit. Wort des Rates der Evangelischen Kirche in
Deutschland und der Deutschen Bischofskonferenz zur wirtschaftlichen und sozialen Lage in Deutschland =
Gemeinsame Texte 9, Hannover/Bonn o.J., Nr. 3f. (S. 7f.).
83Deus Caritas est
viele weitere Projekte von Kirchengemeinden, von christlichen Verbänden und Gemeinschaften
und nicht zuletzt der verbandlichen Caritas zielen keineswegs auf die Verdrängung und Ent-
pflichtung des Staates als hauptverantwortlichen Akteur der Politik. Und doch sind sie gegen-
über der politischen Gestaltung sozialer Gerechtigkeit nicht indifferent. Das Medium zivilge-
sellschaftlichen Engagements, zu denen man diese konkrete Projektarbeit der Kirche sinnvoller
Weise rechnet, hat unmittelbare Ausstrahlungseffekte auf die offizielle staatliche Politik. Die
Zivilgesellschaft lebt und besteht nicht nur aus den – absolut notwendigen (!) – Diskursland-
schaften, in denen die ethischen Selbstverständigungsprozesse einer demokratischen Gesell-
schaft unter Einschluss möglichst vieler gesellschaftlich relevanter Gruppen und damit auch der
Kirchen verlaufen. Sie lebt und besteht auch aus zahlreichen Projektlandschaften, in denen die
Visionen einer sozial gerechten Landschaft wenigstens fragmentarisch und in Umrissen Wirk-
lichkeit werden und ihre Lebensdienlichkeit unter realen Alltagsbedingungen unter Beweis stel-
len können. Dies dürfte für den Aufbau sozialer Gerechtigkeit ebenso wichtig sein wie etwa ihre
legislative Ausformung durch das politische Ordnungshandeln des Staates.
Hintergründige Motive für die Unterscheidung kirchlicher und staatlicher Aufgaben mit Blick
auf die soziale Gerechtigkeit
Die unerwartet schroffe Zurückweisung politischer Ambitionen der Kirche mit Blick auf die
Schaffung sozial gerechter Strukturen ist unterschiedlichen Motiven geschuldet, die im Hin-
tergrund wirken. Zunächst wird man zu Recht vermuten dürfen, dass sich der Papst sowohl
gegen eine politische Vereinnahmung der Kirche seitens eines Staates als auch gegen jede inte-
gralistische oder gar theokratische Ambition einer Religionsgemeinschaft und damit auch einer
christlichen Kirche abgrenzen will. Vor allem dient die klare Unterscheidung der Zuständigkei-
ten von Staat und Kirche dazu, das spezifisch christliche Profil und die Unersetzbarkeit carita-
tiven Handelns kenntlich zu machen und zu verteidigen. Einerseits unterstreicht die Enzyklika
die enorme Bedeutung, die der Sicherung und der Förderung sozialer Gerechtigkeit durch die
staatliche Politik für eine menschenwürdige Gesellschaft zukommt und durch keine caritativen
Liebesdienste der Kirche ersetzt werden kann. Im historischen Rückblick etwa auf das ausge-
hende 19.Jahrhundert gibt Benedikt XVI. sogar freimütig zu, „dass die Vertreter der Kirche
erst allmählich wahrgenommen haben, dass sich die Frage nach der gerechten Struktur der
Gesellschaft in neuer Weise stellte.“ (DCE 27) Andererseits wendet er sich strikt gegen die Fik-
tion einer sozial gerechten Gesellschaft, die die Werke der Liebe überflüssig machen will: „Die
Behauptung, gerechte Strukturen würden die Liebestätigkeit überflüssig machen, verbirgt tat-
sächlich ein materialistisches Menschenbild: den Aberglauben, der Mensch lebe ‚nur von Brot‘
(Mt 4,4; vgl. Dtn 8,3) – eine Überzeugung die den Menschen erniedrigt und gerade das spezi-
fisch Menschliche verkennt.“ (DCE 28)
Auffällig ist, dass die Unersetzbarkeit von Werken der Liebe mit der Eigenlogik wirklich
lebensdienlicher Hilfebeziehungen begründet wird, die auch ein Höchstmaß sozial gerechter
Strukturen nicht ersetzen kann: „Immer wird es Leid geben, das Tröstung und Hilfe braucht.
Immer wird es Einsamkeit geben (…). Nicht den alles regelnden und beherrschenden Staat
brauchen wir, sondern den Staat, der entsprechend dem Subsidiaritätsprinzip großzügig die
Initiativen anerkennt und unterstützt, die aus den verschiedenen gesellschaftlichen Kräften auf-
steigen und Spontaneität mit Nähe zu den hilfsbedürftigen Menschen verbinden.“ (DCE 28,
Hervorhebung ALH)
Was die beinahe altmodisch-betuliche Formulierung vielleicht etwas verdeckt, ist: Die
Verbindung von Spontaneität des Hilfehandelns mit einer spezifischen Nähe zum Hilfsbedürf-
tigen birgt auch mit Blick auf die politische Gestaltung des öffentlichen Raumes im Dienst an
einer humanen Gesellschaft erhebliche Sprengkraft. Denn diese Verbindung ist nicht automa-
tisch gleichzusetzen mit der dominierenden Rezeption des Gleichnisses vom Barmherzigen
84Lob-Hüdepohl, „Deus Caritas est“. Sozialethische Anmerkungen
Samariter, der zufolge die spontane Wahrnehmung und Linderung unmittelbar spürbarer Not
das Markenzeichen christlicher Werke der Liebe ist – was schon fast zwangsläufig mit einer
Ausblendung der (gesellschaftlichen) Ursachen von Not und damit der systemstabilisierenden
Folgen bloßer Symptombehandlungen einhergeht.6 Sondern sie macht auf ein Moment sozial-
professioneller Eigenlogik aufmerksam, dessen auch politische Relevanz in den letzten Jahren
zunehmend bewusst wird.
Politische Wirksamkeit anerkennender, solidarischer Liebe
Unabhängig von der Frage, wie bewusst Benedikt XVI. dieses Moment sozialprofessioneller
Eigenlogik bei seinen Reflexionen vor Augen hatte, entfaltet seine Enzyklika Argumente, die
die besondere Brisanz dieser etwas verborgenen Linie erkennbar werden lassen. Zunächst kons-
tatiert sie selber ein politisches Wirken der Kirche im Sinne einer sozialen Liebe (vgl. DCE 29).
Sodann erinnert sie daran, dass caritative Hilfe – auch und gerade die beruflich-professionelle
Variante – neben einem Sachaspekt („berufliche Kompetenz“) auch einen genuinen Beziehung-
saspekt („Menschlichkeit“, „Zuwendung des Herzens“) besitzen muss, um für die Hilfeempfän-
ger wirklich hilfreich, wirklich lebensdienlich zu sein: „Es geht ja um Menschen, und Menschen
brauchen immer mehr als eine bloß technisch richtige Behandlung.“ (DCE 31) Und um diesen
Beziehungsaspekt jeder wirklich hilfreichen Hilfebeziehung gegen jede Form falschen Mitleids
abzugrenzen, das lediglich für den Helfer ein Medium darstellt, sich in der Pose des Mildtätigen
zu gefallen und sich gegenüber dem Hilfeempfänger zu erheben, unterstreicht die Enzyklika
ausdrücklich ein spezifisches Profil dieser Hilfebeziehung: „Das persönliche, innere Teilnehmen
an der Not und am Leid des anderen wird so Teilgabe meiner selbst für ihn: Ich muss dem ande-
ren, damit die Gabe ihn nicht erniedrigt, nicht nur etwas von mir, sondern mich selbst geben,
als Person darin anwesend sein.“ (DCE 34)
Vielleicht ist es hilfreich, einige Einsichten einer Sozialanthropologie der Gabe, besser:
des Gebens zu erinnern, um die Bedeutsamkeit dieses spezifischen Profils einer Hilfebeziehung
auszuleuchten. Der deutsche Sozialphilosoph Bernhard Waldenfels7 wie der französische Sozio-
loge Marcel Mauss8 machen darauf aufmerksam, dass jeder Gabe und jedem Geben neben dem
Inhaltsaspekt auch ein Beziehungsaspekt inhärent ist. Das Mehr, das dem Beziehungsaspekt
des Gebens im Unterschied zum bloßen Inhaltsaspekt der Gabe eignet, zeigt sich besonders in
einem Geben von Hilfe und Unterstützung, das der Gebende aus innerer Überzeugung in die
‚Not-Wendigkeit‘ seiner Gabe für das Schicksal des Empfangenen vollzieht. Denn in diesem
Geben schwingt das Selbstbekenntnis des Gebenden mit, dass das Gegebene dem Empfangen-
den eigentlich je schon gebührt – gebührt nicht unbedingt auf Grund eines fixierten Rechtsan-
spruches, wohl aber schon gebührt auf Grund seiner Versehrbarkeit und der je schon versehrten
Würde seiner Person. Der Gebende erfährt sich also im Geben der Hilfe und der Unterstützung
vom Anderen her für dessen existentiell bedeutsamen Bedarf je schon in Anspruch genommen.
Er fühlt sich als ‚Hüter seines Bruders‘ (vgl. Gen 4,9). So ist das freiwillige Gewähren und Geben
einer Hilfe weniger ein Weggeben des Eigenen, sondern – um mit Martin Heidegger zu sprechen
– ein „Geben im Sinne des Zugebens. Solches Geben“, so Heidegger, „lässt einem anderen das
6 Die Kritik am christlichen Liebesideal bzw. am ‚Barmherzigen Samariter‘ als Prototyp auch professionellen
Hilfehandelns, die in den sozialen Professionen immer wieder geübt wird, habe ich ausführlicher diskutiert
in Andreas Lob-Hüdepohl: Kritik der instrumentellen Vernunft. Soziale Arbeit in einer entsakralisierten
Gesellschaft. In: Lewkowicz, Marina/Lob-Hüdepohl, Andreas (Hg.): Spiritualität in der sozialen Arbeit,
Freiburg/Brsg., 69–86; ders.: Soziale Arbeit aus christlicher Hand = Arbeitspapiere des ICEP, Berlin 2005.
7 Vgl. Bernhard Waldenfels: Antwortregister, Frankfurt/M. 1994.
8 Vgl. Marcel Mauss: Die Gabe. Form und Funktion des Austauschs in archaischen Gesellschaften, Frankfurt/
M. 1990.
85Deus Caritas est
Gehören, was als Gehöriges ihm eignet.“9 Die Freiwilligkeit des Gebens und Gewährens von
Hilfe signalisiert zugleich die prinzipielle Selbstverpflichtung des Gebenden, auch zukünftig
im Rahmen seiner Möglichkeiten für das dem Empfänger eigentlich je schon ‚Eignende‘ und
‚Gehörige‘ einzustehen. Insofern übereignet sich der Gebende im personalen Akt des Gebens
und Helfens dem Empfänger immer auch selbst mit. In dieser Weise verknüpft der Gebende
sein Schicksal mit dem Schicksal des Empfangenden. Deshalb bildet dieses Geben die norma-
tiv gehaltvolle Kernstruktur von Solidarität im Sinne des ‚Für-einander-Einstehens‘ bzw. des
‚Gemeinsame-Sache-Machens‘.
Von hieraus ist es nicht mehr weit, im caritativen Handeln die politische Wirksamkeit
sozialer Liebe zu erkennen. Caritas und Diakonie sind nicht nur Methode oder instrumen-
tell-technische Fertigkeiten, die etwas herstellen, sondern sie sind kommunikative Praxis in
einem emphatischen Sinn: Sie spielen im Akt solidarischen Handelns den Hilfebedürftigen (wie
übrigens auch dem Helfer!) Möglichkeiten besserer, gelingenderer, weniger von Not und Leid
versehrter und beeinträchtigter Lebensführung zu. In dieser kommunikativen Praxis erfährt
sich der Empfänger von Hilfe nicht mehr als Unterlegener, der dem Helfenden zu unterwürfi-
ger Demut verpflichtet ist, sondern als Unterstützter, dessen durch vielfältiges Leid missachtete
Würde nunmehr in ihrer Not anerkannt sowie gestärkt und wieder aufgerichtet wird. Die Erfah-
rung basaler Anerkennung in den Situationen äußerster Missachtung, die dem Hilfeempfän-
ger im spontanen Akt hilfereicher Nähe sozusagen leiblich vermittelt widerfährt, diese Erfah-
rung wird zum Ausgangspunkt eines auch politisch wirksamen Empowerments des versehrten
Menschen. Denn die Hilfebeziehung, will sie wirklich ein ‚hilfreicher Beistand‘, also wirklich
subsidiär sein10, stiftet und aktiviert Solidarität gegen jene gesellschaftlichen Mächte, die ein
menschenwürdiges Leben behindern und es instrumentell vernutzen. Solche Solidarität bleibt
jedoch nicht bei den Formen von Begrenzungsmacht stehen. Sie transformiert sich auch in
eine Gestaltungsmacht, die das soziale Miteinander im Raum der Öffentlichkeit – und sei dies
nur der öffentliche Nahraum einer Nachbarschaft – neu ordnen hilft. Werke christlicher Liebe,
die dieser Eigenlogik diakonalen Handelns folgen, sind in diesem prägnanten Sinne ‚politisch-
unpolitisch‘.
4. Prophetische Existenz – Ausfluss christlicher Liebe!?
Diakonales ‚Anerkennungshandeln‘ ist auch und gerade in seiner Verknüpfung von Spontaneität
und spezifischer Nähe durchaus politisch. Ist es aber auch prophetisch? Denn wenn das Leitbild
‚diakonalen Anerkennungshandelns‘ – mit Blick etwa auf das Modell des barmherzigen Sama-
riters – das Profil unmittelbarer, unauffälliger sowie individueller Unterstützung markiert, so
verkörpert das Leitbild prophetischer Existenz – etwa mit Blick auf die Sozialkritik alttestament-
licher Prophetie – die Lebensform eines scharfzüngigen ‚Gesellschaftskritikers‘, der zunächst
widerstrebend, dann aber öffentlich vernehmbar und generalisierend gegen die Missstände seiner
Zeit protestiert.
Der „Barmherzige Samariter“ oder die Zuständigkeit der Nichtzuständigen
Ich will zunächst an die ursprüngliche Aussageabsicht des Gleichnisses vom Barmherzigen
Samariter erinnern, um ihn aus dem Odium zwar liebenswürdig-spontaner, gleichwohl unpoli-
9 Martin Heidegger: Der Spruch des Anaximander. In: ders., Holzwege (GA 5), Frankfurt/M. 1977, S. 321–373,
hier: S. 356f.
10 Hier wäre wieder an das unverfälschte Verständnis von Subsidiarität zu erinnern, das Oswald von Nell-
Breuning immer wieder entfaltet hat. (Vgl. ders.: Baugesetze der Gesellschaft: Solidarität und Subsidiarität,
Freiburg/Brsg. 1990.)
86Lob-Hüdepohl, „Deus Caritas est“. Sozialethische Anmerkungen
tisch-naiver Unterstützungsleistung zu befreien. Mit Blick auf seine Rahmung will die biblische
Gleichniserzählung keineswegs ein Handlungsmodell sinnvoller Beseitigung von Notsitua-
tionen entfalten oder gar eine professionelle Helferrolle skizzieren. Vielmehr erläutert sie an
einem profanen Alltagsbeispiel die im Umfeld Jesu brisant gewordene Frage, wer denn als der
Nächste eines Menschen und deshalb um der Gottesliebe willen ein bevorzugter Adressat von
Nächstenliebe und Unterstützung zu gelten hat (vgl. Lk 10,25–37). Modern gewendet lautet die
Frage: Mit wem habe ich solidarisch zu sein?
Nach gängiger Auffassung des antiken Judentums sind eigentlich der Priester und der
Gesetzeslehrer (Levit) für den unter die Räuber gefallenen Israeliten zuständig. Sie gehören
demselben Sozialverband an. Trotzdem gehen sie achtlos am Überfallenen vorbei. Stattdessen
hilft der Reisende aus Samaria dem hilflosen Israeliten, obwohl er nach den sozialen Gepflogen-
heiten seiner Zeit eigentlich gar nicht zuständig ist. Dass der Samaritaner als Angehöriger einer
vom Judentum eigentlich geächteten und marginalisierten sozialen Gruppierung den unter die
Räuber gefallenen Israeliten dennoch rettet und sich ihm in dieser Weise praktisch und leib-
haftig als Nächster erweist, unterstreicht die Kernaussage dieses Gleichnisses und mithin die
Botschaft Jesu: Nicht überkommene soziale Normierungen und Rollenzuweisungen, sondern
praktisches Unterstützungshandeln – sozusagen von der Unterseite der etablierten Gesellschaft
– dokumentiert eine Nächstenliebe, die die vorfindlichen sozialen Grenzziehungen mit ihren
üblichen Exklusionsmechanismen überschreitet. Insofern ist das Gleichnis vom Barmherzigen
Samariter keinesfalls als Illustration vorbildhaft mitleidvollen Hilfehandelns zu lesen, sondern
– zugespitzt formuliert – als modellhafte Praxis systemsprengender Solidarbeziehungen, das um
aller betroffenen Menschen willen über die prinzipiell entgrenzte, universale Zuständigkeit der
prima facie Nichtzuständigen aufklärt.
Diese Zuständigkeit der (vermeintlich) Nichtzuständigen ist ein wichtiger Baustein jener
prophetischen Tradition, in die sich der Nazarener ausdrücklich stellt und ihn in seiner ‚Antritts-
predigt‘ einen der wichtigsten Propheten des Ersten Testaments, nämlich Jesaja, zitieren lässt:
„Der Geist des Herrn ruht auf mir; denn der Herr hat mich gesandt, damit ich den Armen die
gute Nachricht bringe; damit ich den Gefangenen die Entlassung verkünde und den Blinden
das Augenlicht; damit ich die Zerschlagenen in Freiheit setze und ein Gnadenjahr des Herrn
ausrufe.“ (Lk 4,18f)
Kleine Typologie alttestamentlicher Sozialkritik
Die alttestamentliche Sozialkritik überliefert zwar durchaus unterschiedliche Selbstverständnisse
der Propheten, so dass eine einheitliche Typologisierung unmöglich ist.11 Gleichwohl lassen
sich mit Blick auf die bekanntesten sozialkritischen Propheten wie Amos, Hosea oder auch Jesaja
einige Profilmerkmale nennen, die für sie im Grundsatz typisch sind. Besonders bei Amos wird
biblische Prophetie als eine Lebensform erkennbar12, zu der man sich keinesfalls drängt, son-
dern die man – mehr oder minder unfreiwillig – um Gottes willen annimmt und dann aber mit
umso größerer Konsequenz und Entschiedenheit vertritt. Diese Lebensform wendet sich weni-
ger gegen die bestehenden formalen Institutionen also solche. Gleichwohl protestiert sie aber
entschieden gegen jene informellen sozialen Praktiken gesellschaftlich dominierender sozialer
Gruppen, die die etablierten sozialen Üblichkeiten und (gewohnheitsmäßigen) Grundrechte
des Gesellschaftsverbandes zur gierigen Befriedigung bornierter Eigeninteressen ausnutzen.
11 Vgl. immer noch erhellend Klaus Koch: Die Profeten, 2 Bde., Stuttgart 1978.
12 Vgl. Gunther Fleischer: Von Menschenverkäufern, Baschankühen und Rechtsverkehrern. Die Sozialkritik des
Amosbuches in historisch-kritischer, sozialgeschichtlicher und archäologischer Perspektive, Frankfurt/M.
1989, bes. S. 264ff.
87Deus Caritas est
Dieses gerade für die heutige Zeit aufschlussreiche prophetische Protestmotiv lässt sich
bei Amos eindrucksvoll studieren: Heftig polemisiert er gegen die Praxis, Schuldknechte „für
ein paar Sandalen“ (Am 8,6) in die Fremde zu verkaufen. Dass verarmte Bauern in die Schuld-
knechtschaft und damit in die Verfügungsgewalt reicherer Bürger kommen, kritisiert Amos
nicht. Was er aber kritisiert, ist die informelle Praxis der Oberschicht, eine elementare Regel
dieser Schuldknechtschaft zu unterlaufen, nämlich ihre grundsätzliche Befristung. Es galt die
oberste Regel: „Herrenrechte sind aus der Schuldknechtschaft abgeleitet und müssen durch eine
befristete Arbeit des Schuldners abgetragen werden können.“13 Hier hat das Institut des Sab-
batjahres (Dtn 15,1) bzw. des Jobel-/Erlassjahres (Lev 26) seinen rechtsethischen Ort. Genau
diese oberste Norm wurde aber durch die informelle Praxis der Oberschicht unterlaufen, wenn
sie ihre Schuldknechte vor Ablauf der Befristung in das Ausland verkauften. Dieser Verkauf
war zwar sozusagen juristisch legal, moralisch aber keineswegs legitim. Denn mit dem Ver-
kauf entledigte sich die Oberschicht ihrer Pflicht, die Abhängigen nach Ablauf der Frist aus der
Schuldknechtschaft zu entlassen und ihnen damit einen Neuanfang zu ermöglichen. Auf diese
informelle Praxis zielt in diesem Punkt die Sozialkritik des Amos.
Prophetie ist deshalb eine Lebensform, die ideologie- und herrschaftskritisch ist; sie pran-
gert unerbittlich die herrschaftsstabilisierende Wirkung legalistischer, gleichwohl nicht mehr
legitimer Verhaltensmuster der Oberschicht und deren religiöse Verbrämung an. Um die Unver-
fügbarkeit elementarer Sozialrechte zu untermauern, unterstellt sie die Prophetie in gewisser
Weise der Autorität Gottes.14 Mit der Bezugnahme auf Gott beruft sich der Prophet auf die Auto-
rität einer Wirklichkeit, die per definitionem nicht in der Hand der Mächtigen und Profiteure
des jeweiligen gesellschaftlichen Status quo ist. Genau dadurch entzieht die prophetische Kritik
die grundlegenden Normierungen der sozialen Welt jedweder menschlichen Verfügungsgewalt.
In diesem Punkt zeichnet sie eine Begründungsfigur vor, wie sie gut zweieinhalbtausend Jahre
später nunmehr in säkularer Gestalt bei der Begründung des modernen Menschenrechtsden-
kens eine zentrale Rolle spielt.
5. Ausblick: Prophetische Existenz in diakonaler Liebe
Die Frage steht nach wie vor im Raum, wie christliche Nächstenliebe im Anschluss an Deus cari-
tas est und im Modus diakonalen ‚Anerkennungshandelns‘ mit der Lebensform prophetischer
Existenz in Verbindung steht. Zweierlei ist offensichtlich: weder schließen sich diakonales Aner-
kennungshandeln und prophetische Existenz aus, noch sind sie automatisch deckungsgleich. Sie
stehen in einem wechselseitigen Verhältnis der Ergänzung und der Kritik. Es gibt sowohl eine
prophetisch zugespitzte Diakonie als auch eine diakonal geerdete Prophetie.
Eine prophetische Diakonie verliert sich nicht in einer falsch verstandenen Individualisie-
rung von Hilfe und Hilfebeziehungen. Sie weiß, dass ihr Anerkennungshandeln am konkreten
Anderen immer auch pars pro toto und zugleich ein – zunächst wortkarges – Exempel für die
generalisierende Kritik an den etablierten Denk- und Handlungsgewohnheiten einer Gesell-
schaft ist, die viele Menschen, ja vielleicht sogar ganze Bevölkerungsgruppen durch ihre struk-
turellen Deformationen und Pathologien leidend macht. Sie weiß um die Universalität mensch-
licher Leiderfahrungen und ist sich ihrer auch strukturellen Ursachen bewusst. Prophetische
Diakonie stellt klar, dass solidarische Hilfe kein Ausfluss barmherziger Liebe ist, die man den
Verarmten und Hilfebedürftigen ungeschuldet zukommen lässt, sondern Ausdruck einer ent-
13 Hans G. Kippenberg: Die Entlassung aus der Schuldknechtschaft im antiken Judäa. In: Georg Kehrer (Hg.):
Vor Gott sind alle gleich, Düsseldorf 1983, S. 74–104, hier: S. 97.
14 Einen ähnlichen, freilich prominenteren Vorgang der Theologisierung ursprünglich profaner Sozialnormen
kennen wir aus der Komposition des Dekalogs. Vgl. Frank-Lothar Hossfeld: Der Dekalog, Freiburg i.Ue./
Göttingen 1982.
88Lob-Hüdepohl, „Deus Caritas est“. Sozialethische Anmerkungen
grenzten Gerechtigkeit, die man ihnen als Mitmensch und Mitgeschöpf schuldet. Prophetische
Diakonie bezieht sich bewusst auch auf soziale Rechte, die der Beliebigkeit gemeinschaftlichen
oder staatlichen Handelns entzogen sind. Sie appelliert an die Plausibilität jener normativen
Infrastruktur einer Gesellschaft, die wenigstens die elementaren Bedingungen eines men-
schenwürdigen Lebens für alle ihre Mitglieder sichern will und deshalb von allen respektiert
werden müsste. Gelegentlich wird sich prophetische Diakonie in den Diskurslandschaften einer
Öffentlichkeit mit einer zugleich anschaulich wie beißenden Schärfe einmischen müssen, um
das bereits nach menschlichem Ermessen Widersinnige und Anstößige dominierender sozialer
Praktiken zu entlarven; Gewohnheiten einer möglicherweise saturierten Mehrheitsgesellschaft,
die zwar möglicherweise noch vom geltenden Recht gedeckt sind, die sich aber längst von der
Solidarität mit der bedürftigen Minderheitsgesellschaft ‚emanzipiert‘, also entkoppelt haben.
Prophetische Sozialkritik, die sich heute in den zivilgesellschaftlichen Selbstverständi-
gungsprozessen über die ethischen Grundlagen und Implikationen gerechten wie solidarischen
Zusammenlebens engagiert zur Wort meldet, bedarf freilich auch einer diakonalen Erdung. Sie
wird fleisch- und substanzlos, wenn ihr die leibhafte Erfahrung persönlicher Nähen zu konkre-
ten Menschen in Not fehlt und das Einzelschicksal zur bloßen Chiffre einer Menschheit in Not
verkommt. Wie jedes prophetische Reden sich in Form und Inhalt vor dem Forum öffentlicher
Vernunft zu begründen und zu rechtfertigen hat und sich keinesfalls hinter das Bollwerk ver-
schanzt, dass man doch im Namen Gottes spreche15, so bedarf es auch jener kritischen Über-
prüfung und Präzisierung, die sich allein in solcher kommunikativ-diakonalen Praxis ergeben,
die nicht nur virtuell vernünftelt, sondern im Handgemenge alltäglicher Hilfebeziehungen real
vollzogen wird.
„Immer noch liegt der ausgeplünderte Mensch am Wege. Soll“, so fragte schon Alfred Delp
in seinem eingangs zitierten Appell, „der Fremdling ihn noch einmal aufheben?“ Kirchliche
Diakonie und Caritas bedürfen nach wie vor der prophetischen Stimmlagen, auch wenn im viel-
stimmigen Chor zivilgesellschaftlicher Öffentlichkeit von anderen vieles gesagt und getan wird.
„Alles Handeln der Kirche“, so Benedikt XVI., „ist Ausdruck einer Liebe, die das ganzheitliche
Wohl des Menschen anstrebt: seine Evangelisierung durch das Wort und die Sakramente (…)
und seine Förderung und Entwicklung in den verschiedenen Bereichen menschlichen Lebens
und Wirkens.“ (DCE 19) Diese Liebe wird immer dann zu entschiedenem Protest drängen, wo
menschliche Notlagen sich nicht einfach schicksalhaft einstellen, sondern durch die stillschwei-
genden Übereinkünfte einer Gesellschaft verursacht oder wenigstens geduldet werden. Hier
ist prophetische Diakonie nochmals gefordert. Denn sie versammelt gegen die schweigenden
Mauern einer Mehrheitsgesellschaft die Schubkraft jenes für prophetisches Reden so typischen
‚heiligen Zorns‘, angesichts der Leidensgeschichte im Plural von Millionen Lebensgeschichten
und Einzelschicksale auch unbequeme und anstößige Wahrheiten auszusprechen – damit wir
nicht ersticken müssen an den Worten, die um der Gerechtigkeit willen auszusprechen anson-
sten niemand mehr wagt!
15 Davor warnt zu Recht Wolfgang Huber: Prophetische Kritik und demokratischer Konsens. In: ders.: Konflikt
und Konsens, Gütersloh 1984, S. 253–271.
89Sie können auch lesen