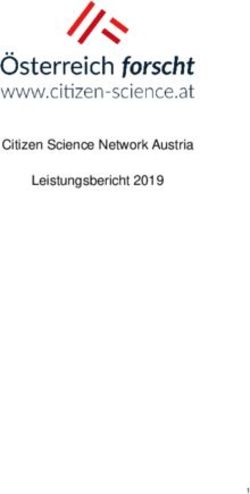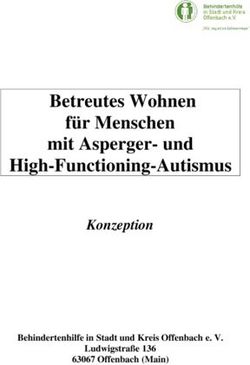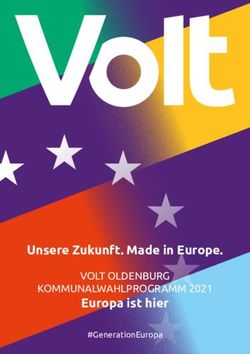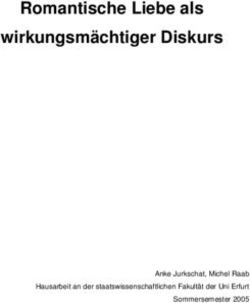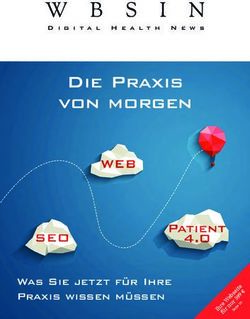DIE AMBIVALENZEN DER PARTIZIPATION - (SEPTEMBER 2018) - Das Kollektiv
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
DIE
AMBIVALENZEN
DER
PARTIZIPATION
–
PARTIZIPATIVE
FORSCHUNG
IN
DER
ERWACHSENENBILDUNG
das
kollektiv
Im
Zentrum
der
Basisbildung
stehen
bildungsbenachteiligte
Gruppen
–
wie
z.B.
Migrant_innen,
die
kaum
Zugang
zu
formaler
Bildung
hatten
–
und,
wie
aktuell
im
Rahmen
der
Initiative
Erwachsenenbildung
vorgesehen,
die
Idee
einer
humanistischen,
selbstermächtigenden
Bildung.
Eine
Reihe
von
Initiativen,
Fachgruppen
und
Vereinen
setzt
sich
dafür
ein,
einerseits
die
theoretischen
Grundlagen
weiterzuentwickeln
und
andererseits
diese
Erkenntnisse
in
die
Praxis
der
Basisbildung
einzubringen.
Die
gesellschaftspolitische
Relevanz
der
Basisbildung
wird
im
Rahmen
dieser
Bemühungen
reflektiert
und
sichtbar
gemacht.
Neben
dem
Ziel
der
Förderung
von
ökonomischen
und
sozialen
Anpassungsleistungen
bildungsbenachteiligter
und
formal
gering
qualifizierter
Erwachsener
(PPD
2018-‐2021:
7)
will
die
Basisbildungsarbeit
im
Rahmen
der
Initiative
Erwachsenenbildung
„Weltoffenheit
und
Bewusstsein
für
Transkulturalität
[ermöglichen]
und
[...]
gesellschaftliche
Ausschlussmechanismen
und
Diskriminierung
erkennen
sowie
kritisch
reflektieren
[lassen].
Sie
fördert
die
aktive
Mitwirkung
in
der
Gesellschaft.
Sie
ermutigt
die
Einzelnen,
die
Welt
mitzugestalten
und
zu
verändern,
anstatt
‚nur‘
in
der
Welt
zu
leben.“
(Fachgruppe
Basisbildung
2017:
4)
Diese
Prämissen
einer
gesellschaftspolitisch
teilnehmenden
Basisbildung,
die
auf
demokratische
und
kritische,
gar
selbstkritische
Handlungsalternativen
fokussiert,
führt
angesichts
der
aktuellen
Verhältnisse
zu
einer
Reihe
von
Fragen:
Wie
können
die
Anliegen,
pädagogische
Reflexion
und
Handlung
zu
verschränken
bzw.
dialogisch
und
wissenskritisch
zu
unterrichten,
in
die
Praxis
umgesetzt
werden?
Und:
Wie
können
Lehrende
und
Lernende
voneinander
lernen?
Ist
kritische
Basisbildungsarbeit
in
Zeiten
immer
stärker
werdender
Sanktionen
und
Diskriminierungsmechanismen
überhaupt
denkbar?
Aus
der
Perspektive
reflexiver
Pädagogik
stellt
sich
die
Frage,
wie
unter
diesen
Bedingungen
ein
emanzipatives
pädagogisches
Verhältnis
stattfinden
kann,
wie
es
unter
anderem
in
den
„Prinzipien
und
Richtlinien
für
Basisbildungsangebote“
(Fachgruppe
Basisbildung
2017)
vorgesehen
ist.
Mit
diesem
Beitrag
wollen
wir
diese
Fragen
aufgreifen,
indem
wir
uns
mit
der
Rolle
partizipativer
Forschung
für
die
Basisbildung
auseinandersetzen.
Konkreten
Anlass
dazu
gibt
das
Modul
„Forschende
Basisbildung“1,
das
vom
Verein
das
kollektiv
im
März
2017
als
Weiterbildung
für
Basisbilder_innen
angeboten
wurde.
Ziel
des
Moduls
war
es,
sich
(partizipative)
Forschungsmethoden
für
die
Gestaltung
der
eigenen
Praxis
in
der
Basisbildung
anzueignen
und
alternative
Handlungsmöglichkeiten
durch
die
Kollektivierung
der
Wissensproduktion
aufzuzeigen.
1
Das
Modul
„Forschende
Basisbildung“
fand
im
Rahmen
des
Netzwerkprojekts
„Basisbildung
mitgestalten“
statt
und
wurde
vom
Europäischen
Sozialfonds
und
dem
Bundesministerium
für
Bildung,
Wissenschaft
und
Forschung
finanziert.
2
In
diesem
Beitrag
diskutieren
wir
in
diesem
Sinne
das
Potenzial
partizipativer
Forschungsmethoden,
die
kritische
Arbeit
in
der
Basisbildung
mit
Migrant_innen
und
Refugees
weiter
zu
fördern.
Wir
besprechen
den
Prozess
des
Moduls
und
reflektieren
Praxis,
Theorie
und
Probleme
der
partizipativen
Forschung
als
Methode
in
der
Basisbildung
und
in
der
Wissenschaft.
Das
Konzept
für
das
Modul
„Forschende
Basisbildung“
Das
Modul
„Forschende
Basisbildung“
war
zeitlich
auf
drei
Tage
aufgeteilt.
Am
ersten
und
zweiten
Tag
trafen
sich
die
Teilnehmer_innen
mit
dem
Lehrteam
zusammen,
um
einerseits
die
theoretischen
Bedingungen
partizipativer
Forschung
zu
diskutieren
und
andererseits
die
Praxis
eines
partizipativen
Projekts
zu
erproben.
Der
dritte
Tag
des
Moduls
erfolgte
nach
der
Selbstlernphase
und
fokussierte
auf
die
Projekt-‐Konzepte,
die
die
teilnehmenden
Basisbilder_innen
in
ihren
Kursen
ausgearbeitet
hatten.
Die
theoretischen
Bedingungen
partizipativer
Forschung
–
Fragestellungen,
Rolle
der
Sozialwissenschaften,
Inhalte
der
partizipativen
Forschung
und
Kritik
daran
–
waren
auf
die
drei
Tage
des
Moduls
aufgeteilt
und
werden
in
den
hier
folgenden
Kapiteln
ausführlich
diskutiert.
Das
bedeutet,
dass
die
Struktur
des
Moduls
abwechselnd
aus
theoretischen
Inputs
und
Praxisbeispielen/Erhebungsmethoden
bestand.
Um
die
Praxis
der
partizipativen
Forschung
zu
erproben,
sind
wir
im
Modul
„Forschende
Basisbildung“
am
ersten
Tag
auf
die
Methoden
und
Paradigmen
der
Sozialwissenschaft
eingegangen.
Mittels
der
bereits
im
Vorfeld
durch
das
Lehrteam
überlegten
Forschungsfrage
„Welche
Erwartungen
haben
wir
an
dem
Modul?“
haben
sich
die
teilnehmenden
Basisbildner_innen
in
zwei
Methoden-‐Gruppen
geteilt.
Die
erste
Gruppe
hat
mit
quantitativen
Interviews
versucht,
Antworten
auf
die
Forschungsfrage
zu
formulieren.
Die
zweite
Gruppe
hat
dieselbe
Forschungsfrage
mit
qualitativen
Interviews
zu
beantworten
versucht.
Die
Interviews
von
beiden
Gruppen
wurden
parallel
dazu
von
Teilnehmer_innen
beobachtet.
Die
beobachtenden
Teilnehmer_innen
unterstützten
im
Anschluss
an
die
Interviews
die
Methodengruppen
bei
der
Besprechung
der
Verhandlungsprozesse:
Wie
wurden
die
Fragen
für
die
methodischen
Instrumente
(Fragebogen
und
Leitfaden)
entschieden?
Wie
wurde
die
soziale
Situation
der
Interviews
erlebt?
Wie
war
die
Situation,
bei
den
Befragungen
beobachtet
zu
werden?
Die
Reflexion
über
die
Erlebnisse
mündete
in
einer
Auseinandersetzung
mit
den
Methodendifferenzen
wie
auch
in
einer
Methodenkritik.
Am
zweiten
Tag
folgte
die
Auswertung
der
transkribierten
qualitativen
Ergebnisse
einerseits
und
der
quantitativ
erfassten
Daten
andererseits.
Wir
bildeten
daraufhin
Interpretationsgruppen,
um
Lesarten
zu
entwickeln
und
die
Abstraktion–
Konstruktionen
zweiter
Ordnung
–
der
Interviews
zu
ermöglichen.
Beispiele
aus
der
partizipativen
Forschung
wurden
daraufhin
vorgestellt,
um
den
Umgang
mit
den
3
Ergebnissen
zur
Diskussion
zu
stellen.
Der
zweite
Tag
wurde
zudem
dazu
genutzt,
Konzepte
für
die
eigene
Lehrpraxis
zu
entwerfen:
Was
wäre
möglich
aufzugreifen?
Wie
kann
in
einer
Gruppe
eine
Forschungsfrage
entstehen?
Welche
Methoden
unterstützen
Basisbildner_innen
darin,
in
Gruppen
gemeinsame
Fragen
zu
formulieren?
Die
ersten
zwei
Tage
des
Moduls
endeten
mit
dem
Beginn
der
Selbstlernphase:
Konzepte,
die
in
den
Modulgruppen
besprochen
wurden,
konnten
in
dieser
Phase
weiter
ausgearbeitet
bzw.
umgesetzt
werden.
Im
Anschluss
wurden
am
dritten
Tag
des
Moduls
je
nach
Input
die
Erfahrungen
der
Teilnehmer_innen
mit
partizipativer
Forschung
in
der
Unterrichtssituation
oder
die
weiterentwickelten
Konzepte
besprochen.
Den
Abschluss
des
Moduls
bildete
die
Frage,
welche
Handlungen
als
Ergebnis
der
Forschung
unternommen
werden
können.
Dabei
ging
es
um
das
Potenzial
für
„Veränderungen“,
das
ein
wesentliches
Merkmal
partizipativer
Forschung
ist.
4
1. Das
umkämpfte
Recht
auf
Forschung
für
Alle
Die
Arbeit
mit
Migrant_innen
und
Refugees
ist
bedeutend,
spannend
und
mit
Herausforderungen
verbunden.
Das
pädagogische
Verhältnis
in
der
Basisbildung
ist
jedoch
strukturell
und
im
Klassenkollektiv
von
ungleichen
sozialen
Machtverhältnissen
durchkreuzt.
Die
beteiligten
Lehrenden
und
Lernenden
begegnen
sich
aus
unterschiedlichen
gesellschaftlichen
Machtpositionen
heraus.
Gleichzeitig
wird
Basisbildung
von
einer
Migrationspolitik
umrahmt,
die
das
Erlernen
der
hegemonialen
Sprache
und
vermeintlicher
europäischer,
demokratischer
Werte
als
Zwang
konzipiert
und
erwachsene
Migrant_innen
und
Refugees
infantilisiert.
Diese
Rahmenbedingungen
gestalten
das
Feld
der
Basisbildung
wesentlich
mit
und
unterstützen
paternalistisches
und
diskriminierendes
Wissen.
Welche
Mittel
stehen
dem
humanistischen
und
selbstemanzipativen
Anliegen
der
Basisbildung
zu
Verfügung,
um
dieser
Wissensproduktion
gegenzusteuern?
Arjun
Appadurai
(2006)
geht
davon
aus,
dass
Forschung
ein
Recht
und
dass
die
Möglichkeit,
selbst
Wissen
zu
generieren,
eine
Bedingung
für
die
Teilhabe
an
demokratische
Gesellschaften
ist.
Parallel
dazu
rechnet
er
damit,
dass
50%
der
Weltbevölkerung
„außerhalb
des
Wissensspiels“
(ebd.:
168)
verortet
sind.
Für
Lehrende,
die
sich
einer
(selbst)kritischen
Pädagogik
verschrieben
haben,
stellt
sich
aus
dieser
Perspektive
die
Frage
nach
bestreitbaren
Wegen
zu
einer
Wissensproduktion
mit
den
Teilnehmer_innen
in
der
Basisbildung,
die
zweifelsohne
zu
diesen
50%
der
Weltbevölkerung
gehören.
Appadurai´s
Forderung
von
Forschung
als
Recht
(vgl.
ebd.)
auch
für
diese
besagten
50%
schließen
wir
uns
als
Basisbildner_innen
an.
Ausgehend
von
diesem
Verständnis
von
Forschung
als
das
Vermögen,
die
Horizonte
des
eigenen
Wissens
hinsichtlich
einer
Aufgabe,
eines
Ziels
oder
eines
Strebens
systematisch
zu
erweitern
(vgl.
ebd.:
176),
fordern
wir
auch
für
Lernende
und
Lehrende
in
der
Basisbildung
das
Recht
auf
Forschung
und
somit
auf
einen
Rahmen
für
kollektive
und
systematische
Wissensproduktion
ein.
Die
Konzeption
und
Durchführung
des
Moduls
„Forschende
Basisbildung“
ist
ein
Ergebnis
dieser
Forderung:
Ein
Schritt
auf
der
Suche
nach
Ansätzen
und
Methoden,
die
in
unserer
Bildungsarbeit
mit
erwachsenen
Migrant_innen
herangezogen
werden
konnten,
um
gemeinsam
die
Welt
mitzugestalten
und
zu
verändern.
Aufgrund
der
spezifischen
Lebenssituationen
–
etwa
durch
Gewalterfahrungen
in
den
Herkunftsorten
und/oder
auf
der
Flucht
wie
auch
durch
massive
existenzielle
Unsicherheit
in
Österreich
und
der
Lernbiografien
der
Teilnehmer_innen
–
meistens
kaum
Zugang
zu
formaler
Bildung
und
damit
zu
Schriftsprache
und
systematisiertem
mathematischen
und
digitalen
Wissen
–
befinden
sich
Lehrende
und
Lernende
in
der
Basisbildung
stets
mit
(methodischen)
Herausforderungen
konfrontiert.
Wenn
es
in
der
Basisbildung
nicht
um
die
Vermittlung
von
„objektivem“,
sondern
um
die
Er-‐
oder
Bearbeitung
von
relevantem
Wissen
geht
und
wenn
es
dabei
um
die
Erweiterung
der
Handlungsoptionen
für
5
bildungsbenachteiligte
Menschen
geht
–
und
wir
wissen,
dass
Bildungsbenachteiligung
mit
vielfältigen
Diskriminierungsprozessen
wechselseitig
verschränkt
und
in
diesen
eingebettet
ist
–,
bietet
sich
eine
Auseinandersetzung
mit
den
Möglichkeiten
partizipativer
Forschung
als
Lehr-‐
und
Lernmethode
von
relevantem
und
kritischem
Wissen
an.
Daher
wurde
im
Projekt
eine
Verknüpfung
zwischen
Basisbildung
und
partizipative
Forschung
hergestellt,
eine
Verknüpfung,
die
den
Rahmen
dieses
Beitrags
bildet.
Der
Schritt
der
Aneignung
und
Aufarbeitung
von
Methoden
der
partizipativen
Forschung
war
jedoch
erst
durch
die
langjährige
kritische
Praxis
im
Feld
der
Sprachbildung
und
Forschung
als
Migrant_innen
und
mit
Migrant_innen
möglich.
Praxis
wird
in
das
kollektiv
als
Aktion
und
Reflexion
verstanden.
Von
hier
aus
und
eingebettet
in
ein
Kollektiv
entwerfen
wir
Fragen,
die
uns
zu
theoretischen
Räumen
führen.
Hier
bewegen
wir
uns
suchend,
hinterfragend,
lernend.
Hier
werden
Ansätze
und
Theorien
weitergedacht,
verarbeitet,
verschränkt,
entfaltet,
in
ein
Verhältnis
zur
Erfahrung
gebracht.
Die
Suche
und
die
Beschäftigung
mit
Forschung,
die
daraus
entstand,
schreibt
sich
ebenfalls
in
eine
lange
Geschichte
in
unseren
Verein
(ursprünglich
als
maiz
und
seit
2015
als
das
kollektiv)
ein,
bei
der
auf
unterschiedliche
Weisen
Möglichkeiten
angestrebt
wurden
und
werden,
sich
in
Bereiche
der
hegemonialen
Wissensproduktion
einzumischen,
Räume
zu
erkämpfen
und
dort,
wo
es
scheinbar
keine
Räume
gibt,
im
Bewusstsein
über
die
Gefahr
der
Vereinnahmung
und
der
Konflikte,
die
so
eine
Einmischung
in
sich
birgt,
und
mit
der
Intention,
Brüche
sichtbar
zu
machen
und
zu
erzeugen,
Impulse
für
Verschiebungen
zu
setzen,
Veränderung
herbei
zu
führen
und
dabei
auch
uns
selbst
zu
hinterfragen.
6
2. Partizipation
als
Methode
Partizipative
Forschung
greift
auf
ein
theoretisches
Konzept
zurück,
das
aus
der
intensiven
Kritik
an
der
hegemonialen
Wissensproduktion
und
unhinterfragten
Machtverhältnissen
entstanden
ist.
Durch
den
Schwerpunkt
auf
die
Forschungsarbeit
mit
unterschiedlichen
teilnehmenden
Gruppen
wurde
partizipative
Forschung
zu
einem
Mittel
für
locals
–
wie
ambivalent
diese
Bezeichnung
auch
sein
mag
–
bzw.
für
Akteur_innen,
die
bereits
in
politische
Prozesse
involviert
sind
und
damit
einen
starken
Zugang/wenig
Distanz
zum
Feld
und
zu
weiteren
Akteur_innen
haben.
Das
Fokussieren
der
Aktionsforschung,
auf
„unsichtbare“
oder
„naturalisierte“
Machtverhältnisse
macht
sie
zudem
nicht
nur
für
die
Basisbildung
relevant,
sondern
war
schon
seit
je
für
viele
politische
Projekte
von
großer
Bedeutung.
Dazu
zählen
vor
allem
die
feministische
Kritik,
die
Kritische
Pädagogik
wie
auch
die
Sozialgeographie
und
Entwicklungsforschung.
Action
research
aims
to
bring
together
theory,
method,
and
practice
as
people
work
collaboratively
towards
practical
outcomes
and
new
forms
of
understanding.
At
its
core,
action
research
is
about
challenging
and
unsettling
entrenched
and
sometimes
invisible
power
arrangements
and
mechanisms
that
are
enacted
in
everyday
relationships,
organizational
and
economic
structures,
cultural
and
institutional
practices,
large
and
small
(Reason/Bradbury
2008;
c.f.
Frisby/Maguire/Reid
2009:
13)
Partizipative
Forschung
(Unger
2014)
–
auch
Aktionsforschung2
genannt
–
ist
ein
Forschungszugang,
der
Methoden
der
Sozialwissenschaften
mit
gesellschaftskritischem
Anspruch
verbindet
und
auf
soziale
Veränderung
im
Lokalen
bzw.
in
den
teilnehmenden
Gruppen
setzt.
Die
Fachbezeichnungen
variieren:
Viele
Forscher_innen
sprechen
von
partizipativer
Forschung
oder
partizipativer
Aktionsforschung
(Collins
2011;
Hague/Thiara/Turner
2011;
Khan/Bawani/Aziz
2013),
andere
von
Kritischer
Aktionsforschung
(Carpenter/Cooper
2009).
Gemeinsam
haben
die
unterschiedlichen
Bezeichnungen
das
Interesse
an
der
Überbrückung
von
Hierarchien
in
der
Wissensproduktion
und
in
der
wissenschaftlichen
Praxis.
Yoland
Wadsworth
(1998)
geht
vor
allem
auf
drei
hierarchisierte
Bedeutungspaare
ein:
Die
Hierarchien
zwischen
Forschung
und
Praxis,
die
Hierarchien
zwischen
„Forschenden“
und
„Beforschten“
und
die
Hierarchien
zwischen
Teilnehmer_innen
und
weiteren
Akteur_innen
aufgrund
der
Frage,
wer
von
einem
Forschungsprojekt
profitieren
darf
oder
kann.
Der
Umgang
der
partizipativen
Forschung
mit
2
Die
Begriffe
„partizipative
Forschung“
und
„Aktionsforschung“
werden
hier
synonym
verwendet,
obwohl
in
der
Literatur
häufig
differenziert
wird.
Hella
von
Unger
(2014:
3)
geht
davon
aus,
dass
mit
dem
Begriff
„partizipative
Forschung“
eine
Abgrenzung
zum
aktivistischen
Charakter
der
Aktionsforschung
der
1970er
Jahren
stattgefunden
hat.
Statt
auf
„Aktion“
setze
partizipative
Forschung
den
Schwerpunkt
auf
das
Element
der
Beteiligung
und
grenze
sich
so
vom
Vorwurf
des
Aktionismus
bzw.
Aktivismus
ab.
„Partizipative
Forschung
ist
eine
engagierte
Forschung,
die
die
Möglichkeiten
der
partnerschaftlichen
Zusammenarbeit
und
empirischen
Forschung
nutzt,
um
die
sozialen,
politischen
und
organisationalen
Kontexte,
in
die
sie
eingebettet
ist,
kritisch
zu
reflektieren
und
aktiv
zu
beeinflussen.“
(ebd.)
Beide
Bezeichnungen
bzw.
Zugänge
sind
jedoch
für
die
Basisbildung
relevant,
weshalb
sie
hier
synonym
verwendet
werden.
7
diesen
Fragen
löst
bei
vielen
Forscher_innen
eine
Reihe
von
emanzipativen
Versprechen
durch
Forschung
aus.
Partizipative
Forschung
bedeutet
auch
deshalb
für
viele
Praktiker_innen,
die
Veränderungen
innerhalb
der
traditionellen
empirischen
Sozialforschung
voranzutreiben,
„viable,
vital
alternatives
to
the
exclusionary
domains
of
academic
research“
(Cahill
2007:
269)
Die
Skepsis
gegenüber
einer
„imperialen“
Sozialforschung
fügt
sich
in
die
umfassende
Kritik
an
der
Rolle
der
Sozialwissenschaften
in
der
Gesellschaft.
Martin
Nicolaus
(1968)
bewirkte
mit
seiner
Rede,
bei
der
er
die
Bezeichnung
„Fat-‐Cat
Sociology“
einführte,
dass
eine
Reihe
von
Bewegungen
innerhalb
der
Sozialwissenschaften
sich
mit
seiner
Kritik
identifizierten
und
die
Anliegen
einer
kritischen
selbstreflexiven
Wissensproduktion
forcierten:
The
corporate
rulers
of
this
society
would
not
be
spending
as
much
money
as
they
do
for
knowledge,
if
knowledge
did
not
confer
power.
So
far,
sociologists
have
been
schlepping
this
knowledge
that
confers
power
along
a
one-‐way
chain,
taking
knowledge
from
the
people,
giving
knowledge
to
the
rulers.
(ebd.)
Unter
anderem
gilt
die
Kritik,
die
Nicolaus
hier
formuliert,
auch
dem
Objektivitätsaxiom
und
Positivismus
der
traditionellen
überwiegend
männlichen
Sozialforschung.
Aufgrund
der
Rolle,
die
Migration
in
den
Problematisierungen
(Foucault
1983b)
der
Gesellschaft
spielt,
sind
diese
Überlegungen
für
die
Forschung
„über“
Migrant_innen
zentral.
Eine
Reihe
von
Analysen
hinterfragt
beispielsweise
den
große
Beitrag
der
Forschung
bei
der
politischen
Legitimierung
des
Konzepts
des
„Migrationsmanagements“3.
(Perchinig
2003;
Georgi
2009;
Georgi/Wagner
2009)
Partizipative
Forschung
ist
demnach
eine
Konsequenz
der
Kritik
an
der
Rolle
der
Sozialwissenschaften
in
der
Gesellschaft
einerseits
und
an
der
Hierarchisierung
innerhalb
der
akademischen
Wissensproduktion
andererseits.
Damit
ist
sie
für
eine
Migrant_innen-‐Organisation
wie
das
kollektiv
besonders
relevant.
Im
Rahmen
des
Moduls
„Forschende
Basisbildung“
–
siehe
Abb.
1
–
haben
wir
versucht,
eine
Verschränkung
der
unterschiedlichen
Aktionsfelder
vorzunehmen.
Ausgehend
davon,
dass
das
Modul
„Forschende
Basisbildung“
für
Lehrende
in
der
Basisbildung
gestaltet
wurde,
schien
uns
zentral,
die
Kritik
an
bestimmten
Forschungsansätzen
und
ihren
Einfluss
auf
(politische)
Entscheidungen
und
ihr
Einwirken
auf
Diskurse
für
die
Teilnehmer_innen
des
Moduls
zugängig
zu
machen.
Dabei
stellen
wir
keineswegs
den
Anspruch,
Wissenschaftler_innen
3
Migrationsmanagement
ist
die
„moderne“
Antwort
auf
die
Erkenntnis,
dass
Migration
trotz
Kontrollen,
Grenzziehungen
und
bürokratischen
Hindernissen
stattfindet:
„Das
Ziel
von
Migrationsmanagement
ist
nicht,
Migration
zu
stoppen,
sondern
Migrant_innen
nach
bestimmten
Kriterien
und
Bedingungen
zu
rekrutieren:
[…]
Im
Gegensatz
zu
nationalistischen
Bewegungen
und
Diskursen
schlägt
das
Migrationsmanagement
vor,
Migration
proaktiv
zu
organisieren
und
die
Kontrolle
zu
verfestigen,
um
vor
allem
die
wirtschaftlich
oder
gesellschaftlich
„interessanteren“
Migrant_innen
in
den
globalen
Norden
zu
lassen.“
(Gouma
2017:
165f.)
8
„auszubilden“,
sondern
vielmehr
die
unterschiedlichen
Voraussetzungen
der
Teilnehmenden
ernst
zu
nehmen
und
ihnen
möglicherweise
erste
Berührungspunkte
mit
der
Thematik
zu
ermöglichen.
Abb.
1:
Diskussion
mit
den
TN
über
die
Ziele
der
„Forschende
Basisbildung“
(Quelle:
Modul
„Forschende
Basisbildung“,
das
kollektiv)
Einleitend
wurde
ein
Überblick
über
wissenschaftliche
Paradigmen,
empirische
Sozialforschung
und
empirische
Methoden
(siehe
als
Beispiel
Abb.
2
und
Abb.
3)
angeboten,
wobei
der
Schwerpunkt
auf
Unterscheidungen
zwischen
qualitativer
und
quantitativer
Forschung
gelegt
wurde.
Die
Teilnehmenden
erhielten
daher
zu
Beginn
die
Möglichkeit,
selbst
diese
Differenzen
aufzuspüren,
indem
sie
beide
methodische
Zugänge
auf
das
Modul
angewendet
haben:
ein
Fragebogen
mit
geschlossenen
Fragen
zu
ihren
Erwartungen
an
das
Modul
und
ein
Interviewleitfaden,
dem
ebenfalls
die
Erwartungen
an
das
Modul
zugrunde
lagen.
Die
Vortragenden
standen
dabei
beratend
zur
Verfügung
und
moderierten
die
Reflexion
der
Interviewdurchführung
ausgehend
von
den
Wahrnehmungen
der
Teilnehmer_innen,
die
die
Rolle
der
Beobachtenden
bei
der
Durchführung
des
Interviews
übernahmen.
9
Abb.
2:
Unterschiede
zwischen
sozialwissenschaftliche
Methoden
(Quelle:
Modul
„Forschende
Basisbildung“,
das
kollektiv)
Abb.
3:
Forschungsprozesse
im
Vergleich
(Quelle:
Modul
„Forschende
Basisbildung“,
das
kollektiv)
Während
die
Fragebögen
von
einer
mitwirkenden
Kollegin
ausgewertet
und
die
Ergebnisse
am
Folgetag
gemeinsam
in
der
Gruppe
diskutiert
wurden,
wurden
die
transkribierten
Interviewpassagen
nach
einem
Input
zu
Datenanalyse,
vor
allem
in
Bezug
auf
die
Grundlagen
sozialwissenschaftlicher
Hermeneutik
und
Grounded
Theory,
gemeinsam
analysiert.
Anhand
dieser
Kombination
von
10
Hintergründen,
Methoden
und
Anwendung
konnten
die
Teilnehmenden
selbst
ihren
Blick
auf
Forschungsprozesse
und
ihre
Perspektivenabhängigkeit
schärfen
und
experimentell
in
die
Analyse
eintauchen.
Inputs
und
Beispiele
sollten
dazu
beitragen,
dass
die
scheinbaren
Grenzen
zwischen
den
Kategorien
Theorie
und
Praxis
zumindest
ansatzweise
verschoben
werden
können.
11
3. Warum
Aktionsforschung
in
einer
Migrant_innen-‐Selbstorganisation?
Partizipative
Forschung
ist
ein
Wissenszugang,
der
gesellschaftliche
Praxis
mit
theoretischem
Wissen
verbindet
und
auf
soziale
Veränderung
im
Lokalen
bzw.
für
die
teilnehmenden
Gruppen
setzt.
Im
deutschsprachigen
wissenschaftlichen
Feld
sind
partizipative
Untersuchungen
relativ
selten:
Es
geht
einerseits
darum,
dass
es
zu
wenig
Erfahrungswissen
über
Partizipation
in
der
Forschung
an
sich
gibt.
Im
stark
hierarchisierten
Feld
der
Academia
sind
zudem
partizipative
Zugänge
eher
„exotische“
Prozesse.
Andererseits
widerspricht
der
shifting
Ground,
auf
dem
partizipative
Forschung
aufbaut,
dem
quantitativen
wie
auch
technokratischen
Wunsch
nach
stark
kontrollierten
Verfahren.
Zudem
hat
das
wissenschaftliche
Feld
nicht
selbstverständlich
Zugang
zu
allen
sozialen
Gruppen
bzw.
ihr
Vertrauen.
Migrant_innen-‐Organisationen
oder
lokale
Akteur_innen
haben
indes
erhebliches
Wissen,
Netzwerke
wie
auch
Strukturen,
die
partizipative
Forschung
sinnvoll
machen.
Partizipative
Forschung
erfordert
also
nicht
nur
theoretische
und
methodische
Innovationen,
sondern
auch
Formen
der
Organisation
und
Netzwerke.
Dieser
Argumentation
folgend,
würden
wir
richtig
in
der
Annahme
liegen,
dass
das
kollektiv
als
Selbstorganisation
von
Migrant_innen,
die
den
Anspruch
erhebt,
herrschafts-‐
und
gesellschaftskritische
Bildungsarbeit
zu
gestalten,
die
passenden
Rahmenbedingungen
für
partizipative
Forschungsprozesse
bieten
würde.
Da
jedoch
Basisbildung
im
politischen
Spannungsfeld
des
neoliberalen
Imperativs
des
„lebenslangen
Lernens“
und
der
„Festung
Europa“
stattfindet,
ist
eine
Auseinandersetzung
mit
den
Ambivalenzen
zwischen
Partizipation
und
hegemonialer
Praxis
unseres
Erachtens
unausweichlich.
Denn
wenn
Basisbildungsprojekte
als
Raum
für
Interventionen
gestaltet
werden
sollen,
der
nicht
im
Sinne
einer
vermeintlich
partizipatorischen
Agenda,
die
letztendlich
gegebene
hegemoniale
Verhältnisse
verfestigen,
wenn
Basisbildungsprojekte
abseits
von
paternalistischen
und
antimigrantischen
Politiken
selbstermächtigende
Konzepte
für
lokale
Akteur_innen
generieren
wollen,
dann
müssen
sich
die
Akteur_innen
fragen,
wie
gemeinsam
zu
arbeiten,
um
problematische
Verhältnisse
aufzugreifen
und
Aktionen
zu
setzen,
die
die
Situation
der
Teilnehmer_innen
der
Basisbildungskurse
verbessern.
Inwiefern
auf
der
Suche
nach
Antworten
auf
diese
Frage
auf
partizipative
Forschungsansätze
produktiv
zurückgegriffen
werden
kann,
bildet
die
zentrale
Beschäftigung
im
diesem
Vorhaben.
Da
es
deutlich
war,
dass
ein
partizipativer
Forschungsprozess
nicht
vollständig
mit
einer
bereits
existierenden
und
bereits
etablierten
Gruppe
in
einem
Kurssetting
durchgeführt
werden
kann
(vor
allem
aufgrund
der
unterschiedlichen
Interessenslagen
und
des
unterschiedlichen
Informationsstandes
der
Teilnehmer_innen
in
Hinblick
auf
die
beabsichtigte
Forschung),
sahen
wir
zwei
Möglichkeiten
des
Einsatzes
partizipativer
Methoden:
als
Selbstreflexionsinstrumente
hisichtlich
der
eigenen
Praxis
oder
als
Methoden,
die
ein
Forschungsprozess
im
Rahmen
des
Unterrichts,
indem
12
die
Teilnehmenden
den
Foschungsprozess
gestalten.
Parizipative
Methoden
als
Stütze
pädagogischer
Reflexivität
anzuwenden,
erschein
uns
legitim
und
im
Sinne
der
Professionalisierung
von
Basisbildungslehrenden
durchaus
wünschenswert.
Nicht
zuletzt
aufgrund
der
Beschäftigung
im
Verein
im
Rahmen
eines
weiteren
Projektes,
entschieden
wir
uns
allerdings
für
die
zweite
Alternative,
im
Bewusstsein
darüber,
dass
beide
Ansätze
in
einander
verschränkt
sind
und
radikale
(Selbst-‐)Reflexion
als
Bestandteil
des
Prozesses
begriffen
werden
muss.
Unser
Konzept
sah
vor,
dass
wir
die
Praxis
der
partizipativen
Forschung
mit
Teilnehmer_innen
des
Moduls
„Forschende
Basisbildung“
erproben,
damit
sie
in
der
Selbstlernphase
(zwischen
den
beiden
Workshopterminen)
die
Forschungsmethoden
in
der
eigenen
Basisbildungspraxis
gemeinsam
mit
den
Teilnehmer_innen
von
Basisbildungskursen
einsetzen
konnten.
3.1. Beispiele
und
Differenzierungen
in
der
partizipativen
Forschung
Im
Modul
„Forschende
Basisbildung“
haben
wir
uns
sowohl
mit
theoretischen
als
auch
mit
praktischen
Zugängen
in
der
partizipativen
Forschung
auseinandergesetzt.
In
diesem
Sinne
haben
wir
verschiedene
Aktionsforschungsbeispiele
(siehe
Abb.
4)
zu
Diskussion
gestellt.
Abb.
4:
Projekt
„AfroLebenVoice“
(Quelle:
Modul
„Forschende
Basisbildung“,
das
kollektiv)
AfroLebenVoice
ist
ein
spannendes
Beispiel
der
Aktionsforschung,
das
soziale
Veränderungen
sowohl
innerhalb
der
Community
als
auch
bei
den
gesellschaftlichen
Institutionen
angestrebt
hat:
„[...]
nach
innen:
Uns
war
es
wichtig,
einen
respektvollen
und
konstruktiven
Austausch
untereinander
zum
Thema
Diskriminierung
und
Quellen
der
Kraft
zu
ermöglichen.
Wir
wollten
die
Ressourcen,
13
Sie können auch lesen