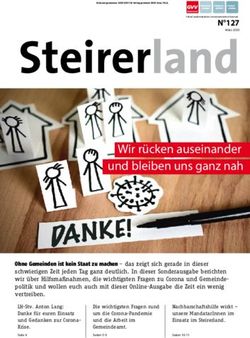Die angebliche Lobby der Fleischwirtschaft als Nickemännel Zum Gastbeitrag der Fraktionsvize der SPD, Frau Katja Mast, vom 23.10.2020
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
29.10.2020
AWZ A.29 AN Tue/gm
Die angebliche Lobby der Fleischwirtschaft
als Nickemännel
Zum Gastbeitrag der Fraktionsvize der SPD,
Frau Katja Mast,
vom 23.10.2020
von
Prof. Dr. Hansjürgen Tuengerthal
Rechtsanwalt
Kanzlei Mannheim www.protag-law.com
M 7|3 Email: info@protag-law.com
(Alte Reichsbank) Raiffeisen Privatbank eG
Telefon: 0621 391 80 10 – 0 IBAN: DE62 6726 2243 0020 5641 05
Telefax: 0621 391 80 10 – 20 BIC: GENODE61WIB1 1Inhalt Seite
1. Lobbyismus, Corona-Krise und keine Erklärung der Ablehnung
des Gesetzes ..................................................................................................................... 3
2. Der angeblich wieder einmal zum Ausdruck gekommene Lobby-
ismus der Fleischwirtschaft.............................................................................................. 4
2.1 Fehlende Kenntnis von der wirklichen Haltung der Fleischverbände ................................... 4
2.2 Maßgebliche Zurückweisung des Werkvertragsverbots nur von der
Arbeitsgemeinschaft Werkverträge und Zeitarbeit (AWZ) .................................................... 5
3. Das sogenannte Brennglas Corona ................................................................................. 5
3.1 Die aus der Sicht der EU bei der Pandemie gebotene Zurückhaltung.................................. 5
3.2 Zu den noch dazu falschen Folgerungen aus der Corona-Pandemie................................... 6
4. Die angeblich fehlende Erklärung der Öffentlichkeit ...................................................... 8
4.1 Maßgebliches Eingreifen der Öffentlichkeit und rechtlich Betroffener im
Hinblick auf die Verfassungswidrigkeit des Vorgehens ........................................................ 8
4.2 Gewisse Zurückhaltung des Wissenschaftlichen Dienstes der Bundestages ..................... 10
4.3 Infragestellung der Übereinstimmung mit Europarecht durch den Wissen-
schaftlichen Dienst des Bundestages, Fachbereich Europa .............................................. 12
4.4 Berechtigte Kritik des Normenkontrollrates ........................................................................ 13
5. Zur angeblich erforderlichen „Aufräumaktion des Ministers Heil“
im eigenen Hause ............................................................................................................ 13
5.1 Die sich aus der Richtlinie des Jahres 1989 ergebende Verpflichtung der
Bundesrepublik, eine gewisse Ordnung zu schaffen .......................................................... 13
5.2 Die von Minister Heil selbst eingeräumte Unordnung aufgrund nicht um-
fassender Umsetzung der Richtlinie 89/381/EWG ............................................................. 14
5.3 Ordnung im eigenen Haus schaffen statt sich als Aufräumer zu gerieren! ......................... 14
6. Zusammenfassung .......................................................................................................... 15
21. Lobbyismus, Corona-Krise und keine Erklärung der Ablehnung des Gesetzes
Im Rahmen einer Meldung des Handelsblatts, teilte die Sprecherin für ArbeitnehmerInnen-
rechte der Grünenfraktion, Frau Müller-Gemmeke, mit, dass vorerst nicht über „geplante
schärfere Regeln für die Fleischbranche in Deutschland entschieden werden“ soll:
„Die Fleischlobby kann einen ersten wichtigen Sieg gegen die GroKo feiern. Es ist offensicht-
lich, dass die Regierungskoalition wieder einmal dabei ist, vor den Interessen der Fleischin-
dustrie einzuknicken“.
In gleicher Weise, aber krasser, äußerte sich am gleichen Tag die Fraktionsvize der SPD,
Katja Mast, in einem Gastbeitrag unter dem Titel „Gesetz gegen Ausbeutung“.
Ihre maßgeblichen Angriffe gegenüber der Fleischwirtschaft im angesprochenen Artikel las-
sen sich wie folgt zusammenfassen:
• Es geht zunächst auch um den angeblichen Lobbyismus der Fleischwirtschaft, der das
Gesetzesvorhaben zu Fall bringen wolle. Hierzu heißt es bei Katja Mast: „Widerstände
und Lobbyismus sind wir gewohnt, das haben wir erwartet. Wir kennen die Branche. Sie
nutzt jedes Schlupfloch aus.“
• Als weiterer Gesichtspunkt wird auf die Corona-Pandemie abgestellt: „Die große Koali-
tion wollte nach den Corona-Ausbrüchen Schluss machen mit der Ausbeutung in der
Fleischbranche. … Die Fleischbranche zeigt uns im Brennglas, was in unserer Wirt-
schaftsordnung nicht stimmt. Die Corona-Pandemie hat den Scheinwerfer darauf gerich-
tet. Unser Wirtschaftssystem ist für Krisen wie Corona nicht gemacht“.
• Schließlich tritt sie wie folgt für die Durchführung des Gesetzesvorhabens von Hubertus
Heil ein und fordert: „Wer das nicht will, muss es der Öffentlichkeit erklären.“
Zusammenfassend geht es ihr also um drei Gesichtspunkte:
• Um die Lobbyisten, die gegen das Gesetz sind.
• Die Folgen der Corona-Pandemie, die für das Gesetz sprechen.
• Und schließlich, dass angeblich niemand der Öffentlichkeit erklärt, warum man das Ge-
setz nicht will.
3Alle Gesichtspunkte sind eindeutig begründet zurückzuweisen. Es zeigt sich in der Meldung,
wie leichtfertig und oberflächlich und mit ganz allgemeinen Stichworten in der Politik versucht
wird, eine Richtung, die im Moment nicht gefällt, herabzuwürdigen.
2. Der angeblich wieder einmal zum Ausdruck gekommene Lobbyismus der Fleischwirt-
schaft
2.1 Fehlende Kenntnis von der wirklichen Haltung der Fleischverbände
Wie wenig die stellvertretende Fraktionsvorsitzende für Arbeit, Soziales, Familie, Senioren,
Frauen und Jugend der SPD über die tatsächlichen Verhältnisse im Zusammenhang mit dem
Werkvertragsverbot in der Fleischwirtschaft informiert ist, erinnert an die Äußerungen ihres
Fraktionsvorsitzenden, Herrn Dr. Mützenich. Dr. Mützenich, der seiner Vorgängerin Andrea
Nahles im Amt folgte, nahm das Werkvertragsverbot von seinem Parteikollegen Heil auf und
äußerte nach einer Nachricht vom 23.05.2020 dem Redaktionsnetzwerk Deutschland gegen-
über, dass er das geplante Verbot von Werkverträgen in der Fleischwirtschaft auf alle Bran-
chen ausdehnen wolle:
„Wir kümmern uns jetzt um die Fleischindustrie. Aber das Ziel ist klar: ich will, dass der Miss-
brauch von Leih- und Werkverträgen in allen Bereichen der Wirtschaft verboten wird.“
Wir haben demgegenüber darauf hingewiesen, dass diese Ausführungen hinsichtlich der
Werkvertragssituation in Deutschland im krassen Widerspruch zu den Ergebnissen von zwei
Studien stehen, die die Vorgängerin von Herrn Dr. Mützenich, Frau Andrea Nahles, in Auftrag
gegeben hat und die auf der Basis von über 9.500 Interviews zu Fragen der Werkvertrags-
abwicklung in Deutschland zu dem Ergebnis kamen, dass die Situation in Deutschland hin-
sichtlich der Abwicklung von Werkverträgen als konstruktiv und positiv zu sehen ist. (Vgl.
dazu Blickpunkt Dienstleistung 8/2020, S. 13, Hansjürgen Tuengerthal, Zurückweisung der
Pauschalabwertung von Werkverträgen durch den Fraktionsvorsitzenden der SPD im Bun-
destag, Herrn Dr. Rolf Mützenich, oder: Mützenich versus Nahles.)
Während Dr. Mützenich seinerseits sich nicht darüber informierte, was auf Initiative seiner
eigenen Parteigenossin und ehemaligen Gewerkschaftsfunktionärin im Detail in zwei 300sei-
tigen Studien ermittelt worden ist, hat sich seine Fraktionsvize, Frau Katja Mast, nicht über
die tatsächliche Situation in der Schlachtindustrie nach dem Regierungsentwurf informiert,
sondern hat ohne Überprüfung zu pauschalen Verurteilungen gegriffen. Dies ist entschieden
zurückzuweisen, zumal die Haltung der Verbände der Fleischwirtschaft und maßgeblicher
4Schlachtunternehmen pressewirksam diskutiert wurde. Diese maßgebliche Haltung in die-
sem Sinne ist u.a. im Fleischmagazin 9/20 wiedergegeben, wobei sich überraschend eindeu-
tig ergibt, wie wenig sich die Verbände der Fleischwirtschaft tatsächlich für ihre eigene Bran-
che einsetzen und sich vielmehr, wie man es im Thüringischen so gut beschreibt, als „Nicke-
männel“ betätigen. Hier äußert der Verband der Fleischwirtschaft: „Unterstützung für Geset-
zesvorhaben zur Abschaffung von Werkverträgen“, der Zentralverband der Geflügelwirt-
schaft: „Forderung nach flexibler Arbeitnehmerüberlassung, Verzicht auf Werkverträge“. Die
Unternehmensgruppe Wilms äußert: „Ab 2021 Verzicht auf Werkverträge im Kerngeschäft“;
die Westfleisch führt in einem 10-Punkte-Programm aus, dass sie „z.B. bis Jahresende alle
Mitarbeiter selber anstellen“ will, und die dänische Firma Danish Crown sagt: „‚Ja‘ zum Ver-
bot der Werkverträge“.
2.2 Maßgebliche Zurückweisung des Werkvertragsverbots nur von der Arbeitsgemeinschaft
Werkverträge und Zeitarbeit (AWZ)
Nur eine einzige Stellungnahme schert aus dieser Kategorie an der gleichen Stelle aus, näm-
lich diejenige unserer Arbeitsgemeinschaft Werkverträge und Zeitarbeit unter dem Titel „Eine
Branche unter Dauerbeschuss – Wer wehrt sich?“.
Neben der Arbeitsgemeinschaft Werkverträge und Zeitarbeit findet nur noch der Junior-
partner Bernhard J. Simon der Firma Simon-Fleisch in Wittlich in einer eher zurückhaltenden
Stellungnahme „Werkverträge sind eine althergebrachte und bewährte Vertragsform“ ein
paar nachvollziehbar erklärende Worte an gleicher Stelle.
Wie kann man angesichts dieser Situation mit dem Brustton der Überzeugung erklären: „Wi-
derstände und Lobbyismus sind wir gewohnt. Das haben wir erwartet. Wir kennen die Bran-
che. Sie nutzt jedes Schlupfloch aus.“?
3. Das sogenannte Brennglas Corona
3.1 Die aus der Sicht der EU bei der Pandemie gebotene Zurückhaltung
Auch die Parteikollegin von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil spricht davon, die Fleisch-
industrie „zeigt uns im Brennglas, was in unserer Wirtschaftsordnung nicht stimmt. Die
Corona-Pandemie hat den Scheinwerfer darauf gerichtet. Unser Wirtschaftssystem ist für
Krisen wie Corona nicht gemacht.“
5Auch diese Argumentation, die dazu dienen soll, das Werkvertragsverbot zu begründen, ist
ein mutwilliges, die Angelegenheit unsachlich behandelndes Argument.
Dazu ist auf den Gesetzesentwurf von Minister Heil abzustellen, der schon in der Einleitung
zum Ausdruck bringt: „Das EU-Recht verpflichtet die Mitgliedstaaten, insbesondere für eine
angemessene Kontrolle und Überwachung zu sorgen (Art. 4 Abs. 2 der Richtlinie
89/391/EWG des Rates vom 12. Juni 1989 über die Durchführung von Maßnahmen zur Ver-
besserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Arbeitnehmer bei der Arbeit ABl.
L 183 vom 29.06.1989)“.
Nach diesem Hinweis auf die angesprochene Richtlinie aus dem Jahr 1989 hätte die Politi-
kerin als stellvertretende Fraktionsvorsitzende für Arbeit und Soziales gut daran getan, nicht
einfach die Argumente ihres Parteikollegen Heil aufzunehmen und ebenfalls vorzutragen,
sondern sich mit dieser angesprochenen Richtlinie des Rates vom 12. Juni 1989 über die
Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschut-
zes der Arbeitnehmer bei der Arbeit (89/391/EWG) zu beschäftigen. Diese Richtlinie, die
unmittelbar unseren Bereich betrifft, enthält in Abschnitt II, in dem die Pflichten des Arbeitge-
bers beschrieben sind, den unsere Pandemie-Situation unmittelbar erfassenden Art. 5 Abs.
4, der wie folgt lautet:
„Diese Richtlinie steht nicht der Befugnis der Mitgliedstaaten entgegen, den Ausschluß oder
die Einschränkung der Verantwortung des Arbeitgebers bei Vorkommnissen vorzusehen, die
auf nicht von diesem zu vertretende anormale und unvorhersehbare Umstände oder auf au-
ßergewöhnliche Ereignisse zurückzuführen sind, deren Folgen trotz aller Sorgfalt nicht hät-
ten vermieden werden können.“
Zwar heißt es im nächsten Absatz, dass die Mitgliedstaaten nicht verpflichtet seien, von der
in Unterabsatz 1 genannten Möglichkeit Gebrauch zu machen. Die damals noch als EWG
firmierende EU hat aber bereits am 12. Juli 1989 ihrerseits sehr deutlich gemacht, dass ein
Ereignis wie die jetzt grassierende Pandemie mit der nötigen Zurückhaltung zu beurteilen ist
und die Folgen nicht, wie es hier pauschal geschieht, den Arbeitgebern und Unternehmern
aufzuerlegen sind.
3.2 Zu den noch dazu falschen Folgerungen aus der Corona-Pandemie
Wir haben in unserer einen Stellungnahme (Hansjürgen Tuengerthal u. Frank Hennecke, Ist
das Verbot des Werkvertrages in der Fleischwirtschaft verfassungsrechtlich gerechtfertigt?),
dargelegt, dass nicht etwa die werkvertragliche Abwicklung der Schlachtung mit der für die
6Unterbringung der Werkarbeitnehmer erforderlichen Wohnungen zur Ansteckung der Werk-
arbeitnehmer geführt hat, sondern die Tatsache, dass aufgrund der bedauerlicherweise bei
Schlachtung und Zerlegung erforderlichen kühlen Temperatur und nicht zu vermeidbaren
engen Zusammenarbeit bei den Arbeitsleistungen die Ansteckungsgefahr in diesem Bereich
bedauerlicherweise sehr groß ist. Dazu hat die ‚Süddeutsche Zeitung‘ im Hinblick auf die
Schlachtbetriebe in den USA unter dem Titel „Notstand im Hamburger Land“ (Süddeutsche
Zeitung vom 19. Mai 2020) berichtet:
„Die hohen Infektionszahlen haben zum einen mit den Arbeitsbedingungen in den Schlacht-
höfen zu tun. Hunderte, oft tausende Arbeiter stehen Schulter an Schulter nebeneinander an
Fließbändern und zerschneiden Schweine, Rinder oder Geflügel. Die Arbeit ist körperlich
anstrengend, und es ist für die Mitarbeiter unmöglich, den empfohlenen Sicherheitsabstand
von zwei Metern zu den anderen Arbeitnehmern zu halten. Zudem begünstigt die kühle Tem-
peratur und der stetige Luftaustausch in den Gebäuden die Verbreitung des Virus.“
Daraus ergibt sich, dass aufgrund des unvermeidbaren engen Zusammenarbeitens bei der
Schlachtung und Zerlegung in den Schlachtbetrieben die Auswirkung der Corona systembe-
dingt ist.
In ähnlicher Weise hat auch die ‚Zeit‘ (Die ‚Zeit‘ vom 14. Mai 2020, S. 17) „Ein Land stürzt
ab“ zum Ausdruck gebracht, dass in den USA eine Vielzahl von Schlachthöfen wegen der
Corona-Infektionen geschlossen ist und die Corona bedingte Schließung von einem Dutzend
Betrieben den Fleischnachschub bedroht. Die ‚FAZ‘ hat in ihrer Ausgabe vom 4. August 2020
auf die Situation in Dänemark hingewiesen, in einem Land, das bisher immer, wegen der
unmittelbaren Anstellung der in der Fleischwirtschaft Beschäftigten als Vorbild galt, wo in
einem Betrieb der Danish Crown in Ringsted in Dänemark 62 Mitarbeiter als nachweislich
mit dem Corona-Virus infiziert festgestellt wurden. Hier gibt es keine Sammelunterkünfte wie
in Deutschland.
Inzwischen ist auch in Deutschland klar, dass die besondere Situation, die für die Fleisch-
wirtschaft hinsichtlich der Krise auch in anderen Ländern gilt, sich auch in Deutschland so
bemerkbar gemacht hat. So meldet die ‚Bild‘ in einer Meldung vom 31. August 2020 unter
dem Titel „Tönnies – Analyse: Fast alle infizierten sich im Werk.“
Danach ergab sich aus der Antwort des nordrhein-westfälischen Gesundheitsministeriums
auf eine Anfrage der AfD im Landtag, dass in 90% der Fälle sich als Infektionsquelle der
Arbeitsplatz herausgestellt hat, nur in 9% der Fälle der private Haushalt und bei 1% sonstige
Kontakte, die nicht näher festgestellt werden konnten.
7Aufgrund der rechtlichen Beurteilung einer derartigen Pandemie wie auch der Situation, dass
die letztlich bedauerlich betroffenen Arbeitnehmer an Schlachthöfen und Zerlegebetrieben,
die zur Aufrechterhaltung der Fleischversorgung in Deutschland und gleichzeitigen Entlas-
tung der betroffenen Landwirte ihren schweren und gefährlichen Job weiter durchgeführt ha-
ben, vorwurfsvoll unter Fortsetzung des täglichen Fleischverbrauchs in der folgenden Weise
sich zu äußern, lässt sich nicht nachvollziehen, wenn ausgeführt wird:
„Die Fleischindustrie zeigt uns im Brennglas, was in unserer Wirtschaftsordnung nicht stimmt.
Die Corona-Pandemie hat den Scheinwerfer darauf gerichtet. Unser Wirtschaftssystem ist
für Krisen wir Corona nicht gemacht. Sobald die Rahmenbedingungen wackeln, erschüttert
uns das bis in zutiefst wichtige gesellschaftliche Bereiche, wie Schulen, KiTas. Staatlicher
Einfluss kann Krisen mindern. Wollen wir Gesellschaft positiv gestalten, müssen wir genau
da weitermachen.“
Es ist nicht nachvollziehbar, dass trotz der angesprochenen deutlichen kritischen Haltung
der insoweit für uns Deutsche maßgebenden einschlägigen Richtlinie der EU und der klaren
Erkenntnis, dass die Corona-Folgen nicht von Schlachtbetrieben und Zerlegebetrieben ver-
ursacht worden sind, sondern eine Folge des durch diese Betriebe sichergestellten Fleisch-
verzehrs in Deutschland ist, derartige pauschale unzutreffende Verdrehungen vertreten wer-
den.
4. Die angeblich fehlende Erklärung der Öffentlichkeit
4.1 Maßgebliches Eingreifen der Öffentlichkeit und rechtlich Betroffener im Hinblick auf die Ver-
fassungswidrigkeit des Vorgehens
Wie zum Ausdruck gebracht, hat Frau Katja Mast geäußert, wer das Gesetz nicht wolle,
„muss es der Öffentlichkeit erklären“. Auch insoweit ist außerordentlich bedauerlich, dass die
für Arbeit und Soziales zuständige stellvertretende Fraktionsvorsitzende Katja Mast offen-
sichtlich nicht darüber informiert ist, in welcher Weise diejenigen, die das Gesetz aus recht-
lichen Gründen ablehnen, sich ganz deutlich in der Öffentlichkeit bemerkbar gemacht haben.
In einer einmaligen, bisher nicht in dieser Form festgestellten Aktion, haben sich 12 führende
Arbeitsrechtsprofessoren äußerst kritisch und sehr genau begründet mit einem Teilaspekt
der Problematik befasst, nämlich mit der Frage: „Das Verbot der Arbeitnehmerüberlassung
in der Fleischwirtschaft, Arbeitsschutzkontrollgesetz: Der falsche Weg zum richtigen Ziel“
(vgl. Prof. Dr. Burkhard Boemke, Prof. Dr. Franz Josef Düwell, Prof. Dr. Stefan Greiner, Prof.
Dr. Wolfgang Hamann, Prof. Dr. Heinz-Jürgen Kalb, Dr. Martin Kock, Prof. Dr. Anja Mengel,
8Dr. Guido Motz, Prof. Dr. Peter Schüren, Prof. Dr. Gregor Thüsing, Prof. Dr. Rolf Wank, in:
NZA 17/2020, S. 1160 ff).
Bei der Conclusio und dem Ausblick wird von den 12 benannten Professoren einheitlich fest-
gestellt:
„Die vorstehenden Überlegungen haben ergeben, dass der derzeitige Entwurf weder mit Ver-
fassungs- noch Europarecht zu vereinbaren ist. … Erforderlich ist ein ehrlicher Dialog. Ge-
meinsam mit der Branche, den Gewerkschaften und den politischen Entscheidungsträgern
sollten effektive Lösungen gefunden werden, den Arbeitnehmerschutz zu verbessern, ohne
die bestehenden Arbeitsplätze zu gefährden.“
In gleicher Weise hat sich die Bundesrechtsanwaltskammer durch ihren Ausschuss Arbeits-
recht (Bundesrechtsanwaltskammer, Stellungnahme Nr. 60/2020, Oktober 2020) mit der Ge-
setzesvorlage zum Arbeitsschutzkontrollgesetz beschäftigt und im Rahmen ihrer begründe-
ten Stellungnahme als Fazit zum Ausdruck gebracht, dass das geplante Verbot des Einsat-
zes von Fremdpersonal in bestimmten Bereichen der Fleischwirtschaft aus der Sicht der
BRAK „verfassungsrechtlichen Bedenken“ begegnet. „Das Verbot greift in Grundrechte aus
Artikel 12 GG und Artikel 14 GG sowie in die europäische Dienstleistungsfreiheit und Arbeit-
nehmerfreizügigkeit ein“.
Ebenso hat sich auch die BDA in einer Stellungnahme vom 29. September 2020 dahinge-
hend geäußert:
„Zusammenfassend lässt sich feststellen: Der Gesetzesentwurf greift tief in von der Verfas-
sung geschützte Rechte ein und ist mit Maßgaben des Unionsrechts nicht zu rechtfertigen.
Die in der Begründung enthaltene ‚Rechtfertigung‘ für diese Eingriffe ist allenfalls formelhaft
und daher für eine nachhaltige Rechtfertigung ungeeignet. Der Gesetzesentwurf geht an den
wirklichen Problemen vorbei.“
Wir selbst als Arbeitsgemeinschaft Werkverträge und Zeitarbeit haben nicht nur unser man-
gelndes Verständnis dafür zum Ausdruck gebracht, dass die Verbände der Fleischwirtschaft
eine aus der Tradition derselben sich ergebende historisch begründbare Werkvertragsab-
wicklung in der Fleischwirtschaft nicht nachdrücklich und begründet vertreten haben, sondern
was Schlachtung und Zerlegung angeht, sofort ihre bisherige Aktivität aufgegeben haben,
sondern wir haben auch in zwei maßgeblichen Stellungnahmen die Verfassungswidrigkeit
des Werkvertragsverbots in der Fleischwirtschaft begründet (vgl. Hansjürgen Tuengerthal,
Frank Hennecke: Ist das Verbot des Werkvertrags in der Fleischwirtschaft verfassungsrecht-
9lich gerechtfertigt?, Christian Andorfer und Heiko E. Greulich: Zur Frage der Verfassungsmä-
ßigkeit des Entwurfs eines Gesetzes zur Verbesserung des Vollzugs im Arbeitsschutz (Ar-
beitsschutzkontrollgesetz).
Wir haben klar zum Ausdruck gebracht, dass nicht einmal der mit dem Gesetz bezweckte
Schutz der betroffenen Werkarbeitnehmer erreicht ist, denn sie würden in Folge des Geset-
zes ihren nach Art. 12 GG geschützten Arbeitsplatz verlieren. Es kann wohl kaum ein politi-
sches Ziel sein, ausländische Arbeitnehmer daran zu hindern, nach Deutschland zu kom-
men, nur damit sie dort nicht ausgebeutet werden.
In diesem Zusammenhang hat das Bundesverfassungsgericht für einen ähnlichen Fall
(BVerfG, Beschluss vom 25. Januar 2011 – 1 BvR 1741/09 Rn. 92) entschieden:
*Die durch Artikel 12 Absatz 1 GG geschützte Privatautonomie des Arbeitnehmers erlaubt
Gesetzgeber und Gerichten vorliegend nicht, kraft vermeintlich besserer Einsicht die Ent-
scheidung, welcher von mehreren zur Auswahl stehenden Arbeitgeber mehr Vorteile bietet,
anstelle des Arbeitnehmers zu treffen.“
Nach allem gibt also bereits der Gesetzeszweck deshalb, weil er zu einem verfassungswid-
rigen Ergebnis der an sich zu schützenden Arbeitnehmer führt, die durch das Gesetz ihren
Arbeitsplatz verlieren, keine verfassungsrechtliche Rechtfertigung für das Gesetz.
Damit ist im Grunde schon alles zur Verfassungswidrigkeit des Gesetzes gesagt, das im
Übrigen auch nach allen weiteren Gesichtspunkten im Hinblick auf Geeignetheit, Erforder-
lichkeit und Verhältnismäßigkeit im weiteren Sinne verfassungswidrig ist.
4.2 Gewisse Zurückhaltung des Wissenschaftlichen Dienstes der Bundestages
Der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages hat in seiner Ausarbeitung zur den verfas-
sungsrechtlichen Aspekten eines Verbots von Werkverträgen und Leiharbeit in der Fleisch-
wirtschaft zum einen deutlich gemacht, dass in der Fleischwirtschaft bereits gewisse Verän-
derungen eingetreten sind und führt dazu aus, dass nach „Angaben der Bundesregierung …
erste Hinweise von der zuständigen Berufsgenossenschaft“ vorliegen, „dass sich in der ge-
setzlichen Unfallversicherung die Zahlungsmoral der fleischwirtschaftlichen Dienstleistungs-
unternehmen in den Jahren 2017 und 2018 gegenüber dem Zeitraum der Jahre 2014 bis
2016 signifikant verbessert hat … Dies lasse erkennen, dass die Regelung in § 3 GSA Fleisch
die beabsichtigte generalpräventive Wirkung erfülle“.
10Der Wissenschaftliche Dienst betont auch, dass die beschäftigten ausländischen Arbeitneh-
mer „nun jedenfalls uneingeschränkt dem deutschen Arbeits- und Sozialversicherungsrecht
unterliegen.“ Der dritte Fortschrittsbericht des sozialpolitischen Ausschusses der deutschen
Fleischwirtschaft zur Umsetzung der Initiative trete „Behauptungen (entgegen), dass der Min-
destlohn und die anderen gesetzlichen Arbeitsbedingungen systematisch unterlaufen wer-
den.“ Bereits im letzten Bericht sei „auf die Zahlen der Überprüfungen des Zolls hingewiesen
worden, nachdem es kaum festgestellte Verstöße gegen den Mindestlohn gibt“. Aus den
Zahlen über die Entgeltentwicklung ergebe sich vielmehr, „dass die Arbeitnehmer einschließ-
lich der meist osteuropäischen Arbeitnehmer deutlich oberhalb des Mindestlohns vergütet
werden.“
Der Wissenschaftliche Dienst verweist schließlich auch auf die am 16. Juli 2019 im Rahmen
der gemeinsamen deutschen Arbeitsschutzstrategie (GDA) von der nationalen Arbeits-
schutzkonferenz verabschiedeten Leitlinie Arbeitsschutz bei der Kooperation mehrerer Ar-
beitgeber im Rahmen von Werkverträgen. Die Leitlinie diene, nach Aussage der Bundesre-
gierung, dem Ziel, ein gleichwertiges Arbeitsschutzniveau für alle Beschäftigten auch im Rah-
men von Werkverträgen im betrieblichen Alltag umzusetzen.
Aufgrund der angesprochenen weniger eingreifenden Maßnahmen zur Verbesserung des
Arbeitsschutzes bei Werkverträgen in der Fleischwirtschaft sei gewissenhaft zu prüfen, ob
die festgestellten Missstände bereits behoben wurden oder absehbar behoben werden kön-
nen. „In einer solchen Situation könne das in Rede stehende Verbot von Arbeitnehmerüber-
lassung und Werkverträgen in diesem Wirtschaftszweig als unverhältnismäßiger Eingriff in
das Grundrecht aus Art. 12 Abs. 1 GG zu werten sein, der mithin nicht mehr verfassungs-
rechtlich gerechtfertigt wäre.“
Der Wissenschaftliche Dienst führt auch aus, dass sowohl „die Beurteilung der Eignung als
auch der Erforderlichkeit des eingesetzten Mittels, also die Frage, ob ein alternatives Mittel,
etwa eine Kontingentierung der Werkverträge oder eine Beschränkung der Zahl von Arbeit-
nehmern pro Werkvertragsunternehmen gleich geeignet und milder wäre.“ Dies unterliege
aber, so schränkt er ein, „der Einschätzungsprärogative des Gesetzgebers“. Das Gleiche
gelte hinsichtlich der prognostizieren Wirkung der im Eckpunktepapier der Bundesregierung
skizzierten weiteren Maßnahmen, die ebenfalls auf die Verbesserung der Arbeits- und Un-
terkunftsbedingungen sowie auf verbesserten Infektionsschutz zielen.
Im Endeffekt sieht der Wissenschaftliche Dienst die Verfassungsmäßigkeit des Werkver-
tragsverbots und des Verbots der Arbeitnehmerüberlassung kritisch.
11Nach unserer Überzeugung kann der Gesetzgeber mit einer solchen zurückhaltenden Hal-
tung seines Wissenschaftlichen Dienstes das Werkvertragsverbot nicht bedenkenlos durch-
führen, zumal die bereits angesprochenen zahlreichen weiteren Gutachten eindeutig die Ver-
fassungswidrigkeit der vorgesehenen Maßnahmen feststellen.
4.3 Infragestellung der Übereinstimmung mit Europarecht durch den Wissenschaftlichen Dienst
des Bundestages, Fachbereich Europa
Der ebenfalls tätig gewordene Wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestags, Unter-
abteilung Europa, Fachbereich Europa, hat allerdings aufgrund des zunächst nur vorliegen-
den, vom Bundeskabinett am 20. Mai 2020 beschlossenen Eckpunktepapiers im Hinblick auf
die darin enthaltenen „sehr allgemeinen Hinweise über Inhalt, Reichweite und Begründung
des geplantes Verbots von Werkvertragsgestaltungen und Arbeitnehmerüberlassung in Be-
zug auf das Schlachten und die Verarbeitung von Fleisch in Betrieben der Fleischwirtschaft“
zum Ausdruck gebracht, dass eine rechtliche Prüfung der Vereinbarkeit eines solchen Ver-
bots mit unionsrechtlichen Vorschriften nur eingeschränkt möglich sei. Das Vorgehen wird
aber, genau wie von unserer Seite, zu Recht wie folgt zurückhaltend gesehen:
„Das Eckpunktepapier geht nicht näher darauf ein, in welcher Weise ein Verbot von Werk-
vertragsgestaltungen und Arbeitnehmerüberlassungen zu einer Verbesserung der Arbeits-
und Beschäftigungsbedingungen führen soll!“
Weiter heißt es in der Ausarbeitung:
„Bei einem Verbot von Werkvertragsgestaltungen und Arbeitnehmerüberlassungen erscheint
es daher angezeigt, besonders zu prüfen, ob dieses unter Berücksichtigung seiner konkreten
Begründung und Ausgestaltung tatsächlich erforderlich ist, um die Einhaltung bestimmter
Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen sicherstellen zu können. Nach der Rechtspre-
chung des EuGH obliegt es dem Mitgliedstaat, die Erforderlichkeit der betreffenden Maß-
nahme ‚hinreichend überzeugend‘ darzulegen. Hieran dürften bei einem Verbot von Werk-
vertragsgestaltungen und Arbeitnehmerüberlassungen, das eine besonders einschneidende
Beschränkung des von der Dienstleistungsfreiheit umfassten Rechts zur grenzüberschrei-
tenden Übersendung von Arbeitnehmern bewirkt, sehr hohe Anforderungen zu stellen sein.
… Vor diesem Hintergrund wäre ein Verbot von Werkvertragsgestaltungen und Arbeitneh-
merüberlassungen wohl allenfalls zu rechtfertigen, wenn der Gesetzgeber konkret darlegt,
dass selbst unter Ausschöpfung aller in der Richtlinie 2014/67/EU vorgesehenen und auf
ihrer Grundlage zulässigen Mittel (u.a. in Bezug auf Verwaltungszusammenarbeit, Überwa-
chung der Einhaltung, Durchsetzung, Haftung, Sanktionen), eine wirksame Kontrolle auf-
grund außergewöhnlicher Umstände in dem betreffenden Sektor praktisch nicht hinreichend
gewährleistet werden kann. … Allein auf der Grundlage der im Eckpunktepapier genannten
allgemeinen Gründe kann nicht beurteilt werden, ob die Voraussetzungen vorliegen, auf-
grund derer ein Verbot von Werkvertragsgestaltungen und Arbeitnehmerüberlassungen zu
rechtfertigen wäre.“
124.4 Berechtigte Kritik des Normenkontrollrates
Der Normenkontrollrat, der seinerseits das Gesetz aufgrund seiner Aufgabenstellung über-
prüft hat, hat es als „ein weiteres Negativbeispiel für die zunehmende Praxis“ genannt, „Fris-
ten bei politisch wichtigen Vorhaben nicht zu beachten“. Unter diesen Bedingungen sei eine
bessere „Rechtssetzung und eine gründliche inhaltliche Behandlung von Gesetzesentwürfen
nicht möglich“.
5. Zur angeblich erforderlichen „Aufräumaktion des Ministers Heil“ im eigenen Hause
5.1 Die sich aus der Richtlinie des Jahres 1989 ergebende Verpflichtung der Bundesrepublik,
eine gewisse Ordnung zu schaffen
Etwas, was in der Ausführung von Frau Katja Mast, „Die Fleischindustrie ist krank – die Union
verzögert die Therapie“ nicht zum Ausdruck kommt, ist die besonders hervorgehobene Er-
klärung ihres Ministers Heil, „in den Schlachthöfen jetzt aufzuräumen!“. Wenn ein Minister
sich in der Öffentlichkeit hinsichtlich einer Branche so hinstellt, als müsse er der Aufräumer
vom Dienst sein, so stellt sich sofort die Frage, ob jener Aufräumer überhaupt in seinem
eigenen Hause die Ordnung hat, die er auf der anderen Seite von den von seinem Vorgehen
betroffenen Unternehmen erwartet. Dazu ist festzustellen, dass von dieser Ordnung keines-
wegs auszugehen ist. Was die EU insoweit auch von ihm hierbei fordert, ergibt sich u.a. aus
den Begründungserwägungen der von ihm für die Erforderlichkeit seines Tuns im Regie-
rungsentwurf angesprochenen Richtlinie 89/391/EWG des Rates vom 12. Juni 1989 über die
Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschut-
zes der Arbeitnehmer bei der Arbeit (ABl. L 183 vom 29.06.1989, S. 1). Hierzu heißt es in
den Begründungserwägungen dieser Richtlinie:
„Es ist Aufgabe der Mitgliedstaaten, in ihrem Gebiet die Sicherheit und den Gesundheits-
schutz von Arbeitnehmern zu verbessern … Es sind nach wie vor zu viele Arbeitsunfälle und
berufsbedingte Erkrankungen zu beklagen. Für die Sicherheit und den Gesundheitsschutz
der Arbeitnehmer müssen daher unverzüglich vorbeugende Maßnahmen ergriffen bzw. be-
stehende Maßnahmen verbessert werden, um einen wirksamen Schutz sicherzustellen. …“
Eindeutig heißt es dann auch in Art. 4 Abs. 2 der Richtlinie:
„Die Mitgliedstaten tragen insbesondere für eine angemessene Kontrolle und Überwachung
Sorge.“
135.2 Die von Minister Heil selbst eingeräumte Unordnung aufgrund nicht umfassender Umsetzung
der Richtlinie 89/381/EWG
Es ist also festzustellen, dass es sich hier um eine Richtlinie vom 12. Juni 1989 über die
Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschut-
zes der Arbeitnehmer bei der Arbeit handelt. Dazu muss der Minister am Beginn seiner Ge-
setzesvorlage selbst einräumen:
„Ein zentrales Instrument der Arbeitsschutzbehörden ist die aktive oder reaktive Ansprache
der Betriebe in Form von Betriebsbesichtigungen. Das Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) ent-
hält derzeit dazu keine Vorgaben. Insbesondere über die Kontrolldichte, das heißt über An-
zahl und Häufigkeit von Betriebsbesuchen entscheiden die Arbeitsschutzbehörden nach ei-
genem Ermessen selbst. In der Praxis ist seit Jahren eine rückläufige Entwicklung bei der
Zahl der von den Arbeitsschutzbehörden durchgeführten Betriebsbesichtigungen zu be-
obachten.“ (Unterstreichung durch den Unterzeichner)
Das stellt der Minister heute zu einer Richtlinie der EU vom 12. Juni 1989, also einer Rege-
lung, die 40 Jahre alt ist und nach ihrem Artikel 18 bis spätestens 31. Dezember 1992 hätte
umgesetzt werden müssen, fest.
5.3 Ordnung im eigenen Haus schaffen statt sich als Aufräumer zu gerieren!
Dieses Eingeständnis zeigt eindeutig, dass die von der EU in der vor 40 Jahren erlassenen
Richtlinie geforderte gründliche Untersuchung der Branchen nicht eingehalten worden ist und
nunmehr versucht wird, diesen Unterlassungsmangel einer bestimmten Branche aufzuerle-
gen. Das ist nachdrücklich zurückzuweisen und keinesfalls hinzunehmen.
Der Minister sollte auch dahingehend aufräumen, dass er sich die von seiner Vorgängerin
beauftragten beiden großen Untersuchungen zur Werkvertragsproblematik heranzieht, um
auf diese Art und Weise dann festzustellen, wie in seinem eigenen Hause Werkvertragstä-
tigkeit in Deutschland beurteilt wird.
Angesichts dieser hier festgestellten Situation sollte sich die Verfasserin des angesproche-
nen Artikels besser mit der verfassungsrechtlich nicht haltbaren Position ihrer Partei bei dem
Werkvertragsverbot im Zusammenhang mit den angeblichen Aufräumarbeiten befassen,
satt, wie geschehen, ungeprüft nicht haltbare Thesen zu verbreiten.
146. Zusammenfassung
Zusammenfassend ist zu sagen, es wird, wie das Beispiel Katja Mast und auch ihres Frakti-
onsvorsitzenden Dr. Mützenich zeigt, ohne Überprüfung pauschal die Fleischwirtschaft mit
Argumenten angegriffen, die absolut nicht haltbar sind und die mit nachweisbaren Argumen-
ten zurückzuweisen sind.
Wenn es dann am Schluss ihres Gastbeitrags lautet:
„Wollen wir Gesellschaft positiv gestalten, müssen wir genau da weitermachen. Wir müssen
Innovationen im Sinne der Gesellschaft voranbringen. Wir müssen den Sozialstaat stärken,
so wie wir es aktuell in der Krise tun.“
Dann der wichtige Satz, der unbedingt auf den Gastbeitrag Anwendung finden muss:
„Wir müssen wachsam bleiben und die richtigen Fragen stellen.“
Prof. Dr. Hansjürgen Tuengerthal
Rechtsanwalt
15Sie können auch lesen