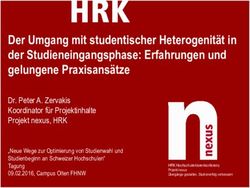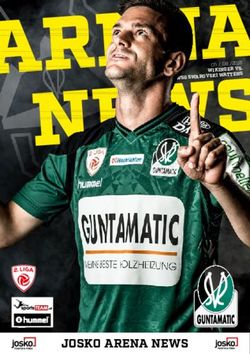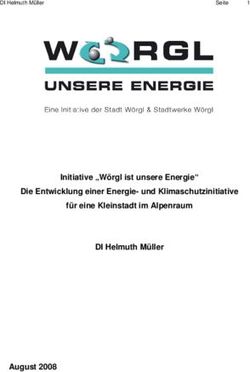Die Kaserne Basel Vom Militär zur Kultur - Projektarbeit von Valérie Kremo, Beda Stähelin, Melanie Bieli
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Die Kaserne Basel
Vom Militär zur Kultur
Projektarbeit von
Valérie Kremo, Beda Stähelin, Melanie Bieli
März 20052 Inhaltsverzeichnis 1. Vorwort ........................................................................................................................................2 2. Einleitung .....................................................................................................................................3 3. Vorgeschichte...............................................................................................................................4 4. Vom Militär zur Kultur ................................................................................................................5 4.1 Von der ARENA zu ”Ent-stoh-lo” ........................................................................................5 4.2 “Ent-stoh-lo” – aber wie?........................................................................................................6 5. Schlusswort ..................................................................................................................................7 Abstract ............................................................................................................................................8 Literatur- und Quellenverzeichnis....................................................................................................9 Quellen..........................................................................................................................................9 Gespräche mit Gewährsleuten ......................................................................................................9 Darstellungen ................................................................................................................................9 Internetquellen ............................................................................................................................10 Abbildungsverzeichnis ...................................................................................................................10 Legende zu den Abbildungen auf der Titelseite: Oben: Die Kaserne bei Nacht, Hauptgebäude, Foto von B. Stähelin Unten: Das Kasernenareal als Panoramaansicht, von www.basel.ch
3
1. Vorwort
Im Rahmen unserer Projektarbeit haben wir uns zum Ziel gesetzt, einer Klasse aus Halle die Re-
gion Basel vorzustellen. Dabei hat sich unsere Gruppe vorgenommen, den Hallenser Schülerin-
nen und Schülern die vielfältige Kultur der Stadt Basel näherzubringen. Dies werden wir in Form
einer Stadtführung zu den sehenswertesten und schönsten Plätzen Basels versuchen.
Zur Projektarbeit gehört auch, dass wir in einem schriftlichen Teil ein Thema wissenschaftlich
aufarbeiten und näher beleuchten. Die Kultur sollte auch hier im Zentrum stehen. Unsere erste
Idee, das Museum Jean Tinguely, verwarfen wir aber nach kurzer Zeit wieder. Wir wollten ein
Thema finden, zu dem die Jugend einen grösseren Bezug hat. Die Kaserne Basel stellt in vielerlei
Hinsicht eine optimale Lösung dar: Mit ihrer Entwicklung vom Militärgebäude zum Jugendkul-
turzentrum hat sie eine sehr bewegte Vergangenheit hinter sich. Im Kleinbasel gelegen, gibt sie
uns zudem die Möglichkeit, unseren Hallenser Gästen diesen touristisch sonst eher weniger be-
kannten Teil Basels vorzustellen.
2. Einleitung
Die Kaserne Basel befindet sich am
nordwestlichen Rand der Kleinbas-
ler Altstadt, in unmittelbarer Nähe
zum Rheinufer und zum Claraplatz.
Das ganze Areal umfasst 21‘000
Quadratmeter, wobei zwei grosse
Hallen das eigentliche Herzstück
der Anlage bilden. Sie werden für
Konzerte, Tanzveranstaltungen und
Theateraufführungen genutzt. Die
Abb. 1: Die Kaserne Basel – in der Mitte der Hauptbau verschiedenen Gebäude sind in
einer Hufeisenform angeordnet, so
dass ein grosser Innenhof mit einer Rasenfläche und einem Hartplatz entsteht. Heute ist die Ka-
serne ein etablierter Kultur- und Quartiertreffpunkt in
einem spannenden multikulturellen Umfeld. Für die
Bevölkerung des Kleinbasel ist sie Spielplatz, Schule,
Treffpunkt und kulturelle Drehscheibe in einem. Der
Begriff “Kaserne” und die Namen der einzelnen Ge-
bäude (“Rossstall”, “Reithalle”) weisen jedoch eindeu-
tig auf eine militärische Vergangenheit hin. Vor 50
Jahren wurden die roten Sandsteinmauern der Kaserne
tatsächlich noch von der Schweizer Armee bewohnt.
Unsere Projektarbeit beschäftigt sich nun mit der Ent-
wicklung der Kaserne Basel vom Militärgebäude zum Abb. 2: Ausschnitt aus dem Stadtplan
Kulturzentrum. Dabei interessiert uns besonders die
Frage, inwiefern das Aufkommen einer Alternativkultur die Beteiligung der Kleinbasler Bevölke-
rung am Planungsprozess begünstigte, und wie dieser Einbezug dann konkret aussah.4
3. Vorgeschichte1
Die Ursprünge des Kasernenareals sind im Kloster Klingental zu finden. Der 1233 von vier Frau-
en in Hüsern bei Ensisheim gegründete Dominikanerinnenkonvent wurde 1256, vom Minnesän-
ger und Ritter Walter von Klingen reich beschenkt, ins
heute badische Wehratal verlegt. Die Frauen nannten ihr
Kloster fortan Klingental. Nach der Wahl von Rudolf
von Habsburg zum deutschen König 1273 festigte sich
die habsburgische Position, zu deren Lager die Nonnen
gehörten, auch in Basel. Ein Jahr später siedelte sich der
reiche Konvent zwischen Rhein und ”Niderem Tor”
(später: Bläsitor) an. Für den Bau des Klosters wurde
der Kleinbasler Mauerring 1278 erweitert. Damit war
das heutige Kasernenareal zwischen dem Kleinen Klin-
gental und dem Klingentalgraben geboren. 1293 wurde
die Klingentalkirche eingeweiht, die als eines der
schönsten und aufwendigsten Bauwerke dieser Art am
Oberrhein gilt.
Die aus adeligen Kreisen stammenden Nonnen hielten
auf standesgemässe Bequemlichkeiten: Die Horen
(Stundengebete) wurden sitzend gesungen, im Winter Abb. 3: Basler Stadtplan mit Kloster Klin-
durften Handschuhe getragen werden. Im Kleinbasel gental, 1615
standen sie in zwiespältigem Ruf, zum Beispiel weil sie
des Nachts im Rhein badeten. Ab 1460 erlebte das Klos-
ter deshalb eine wechselvolle Geschichte mit Verbannung und Wiedereinsetzung der Nonnen.
1529, als die Reformation in Basel Einzug hielt, wurde den Nonnen der Austritt aus dem Kloster
freigestellt – ausser der Äbtissin
und einer einzigen Nonne zogen
alle weg und heirateten. Die Auf-
lösung des Klosters zog sich bis
1559 hin. Dann übernahm die Stadt
das Areal. Fortan dienten die Ge-
bäude grösstenteils als Lagerhaus
für die Kirchen Basels.
1804 übernahm der Kanton Kirche
und Grosses Klingental und be-
nutzte die die Anlage als Kaserne.
1860-63 musste das Grosse Klin-
gental mit seinen Konventsgebäu-
Abb. 4: Entwurf des Architekten J.J. Stehlin für die Kaserne, 1860
den dem heute noch bestehenden
Kasernenbau des Architekten J.J.
Stehlin weichen. Das Militär zog ein. Hundert Jahre herrschten hier Drill und Gehorsam.
1
Nach: Schiess 1994, IKA 20045
4. Vom Militär zur Kultur
4.1 Von der ARENA zu ”Ent-stoh-lo”
In der Aufbruchstimmung der 1960er-Jahre ging der Militarismus in Europa unter dem Eindruck
des Zweiten Weltkrieges und des Vietnamkrieges allgemein zurück. Der Stellenwert des Militärs
in der Bevölkerung sank und allmählich war Sinn und Zweck einer Kaserne mitten in der Stadt
Basel nicht mehr gegeben. Unter diesen Voraussetzungen zog die Schweizer Armee aus Basel
weg.
Die jugendliche Protestwelle, welche sich 1968 schlagartig ausbreitete, schwappte auch nach
Basel über. Zwar liess sich nicht die Studentenschaft als Ganzes aufrütteln, doch auch hier ent-
wickelte sich eine jugendliche Alternativszene.
Einzelne ausseruniversitäre Gruppierungen be-
lebten die Bewegung. Zu ihnen zählte die ARE-
NA. Sie verstand sich als Diskussionsforum mit
dem Ziel, gesellschaftliche Probleme bewusst zu
machen. Dabei sollten möglichst breite Teile der
Bevölkerung in den Diskurs miteinbezogen wer-
den. Die obersten Organe der Arena bildeten die
Mitglieder-Vollversammlung sowie über ein
Dutzend Arbeitsgruppen. Zusammen mit ande-
ren 68er-Gruppierungen der Region bildete die
ARENA ein ”kommunikatives Netzwerk”, das
sich als Alternative zur ”etablierten” Öffentlich-
keit verstand.
Nachdem nun das Militär den Platz geräumt hat- Abb. 5: Einladung der ARENA zu einer Diskusssi-
te, meldeten verschiedenste Leute und Institutio- on mit Wilfried Heidt
nen Interesse an den so zentral gelegenen Ge-
bäuden an. Ein heftiges Gerangel um die begehrten Räume begann. Das Kasernenareal sah einer
ungewissen Zukunft entgegen, doch bot es dem Kleinbasel auch eine tolle städtebauliche Chance.
Kulturell und kommerziell Ambitionierte lieferten sich heftige Kämpfe um die zukünftige Nut-
zung der Kaserne. Zur Diskussion stand unter Anderem eine Ausgestaltung des Areals zum Park
und die Errichtung eines unterirdischen Parkings.
Unterdessen hatten sich schon erste Umnutzungen des Kasernenareals vollzogen: Die Künstlerin
Mary Vierira bezog 1964 – also noch während der Militärzeit – als erste ein Atelier im Kasernen-
areal. 1968 richtete sich die Bläsikrippe in der ehemaligen Soldatenstube ein und 1969 wurde der
Kirchentrakt der Ateliergenossenschaft dauerhaft vermietet.
Doch noch fehlte ein genaues Konzept zur weiteren Nutzung der Kasernengebäude. 1972 wurde
deshalb ein öffentlicher Ideenwettbewerb ausgeschrieben, in dessen Rahmen verschiedene Ideen
und Pläne für die Entwicklung des Kasernenareals formuliert wurden.
Viele Mitglieder der ARENA waren Kulturschaffende und sahen im Kasernenareal eine einmali-
ge Möglichkeit, die in ihren Arbeitsgruppen entwickelten Projekte zu verwirklichen. Die ARENA
fiel zwar Ende 1971/Anfang 1972 langsam auseinander2, doch gründete ein Teil ihrer Mitglieder
den “Verein interessierter Personen” (VIP) und reichte eine Alternative zu den bisherigen Wett-
bewerbsvorschlägen ein, die allerdings mit einem Trostpreis abgespiesen wurde. Ihr Projekt “Ent-
2
Nach: Lachenmeier 20036
stoh-lo” forderte einerseits die Erhaltung der Kasernengebäude (“stoh-lo”), andererseits sollte
unter permanenter Mitwirkung der Kleinbasler/innen ein Kommunikationszentrum “ent-stoh”.
In der Bevölkerung traf das Projekt auf breite Zustimmung und 1973 wurde es als Petition mit
4000 Unterschriften den Behörden eingereicht.
4.2 “Ent-stoh-lo” – aber wie?
Trotz des fehlenden Erfolges im Ideenwettbewerb ging “Ent-stoh-lo” dank grossem Anklang bei
der Basler Bevölkerung nicht vergessen. Im Gegensatz du den übrigen Vorschlägen, welche alle
marktwirtschaftlich orientiert waren, sollten beim “Ent-
stoh-lo” gemeinnützige Einrichtungen das Kasernenareal
füllen. Es war als Provisorium von 10 Jahren bis zu einem
definitiven Nutzungsbeschluss gedacht. Fünf Erstnutzer-
gruppen wurden vorgestellt, welche bereit waren, ein au-
tonomes Kommunikationszentrum zu bilden. Zur Reali-
sierung dieses Planes und Aufgabenverteilung wurde 1974
die Interessengemeinschaft Kasernenareal (IKA) gegrün-
det. Sie ist konfessionell und politisch neutral. Diese Leu-
te, welche sich mehrheitlich schon im VIP engagierten,
beabsichtigten, die Räume auf dem Areal von der Zentral-
stelle für staatlichen Liegenschaftsverkehr (ZLV)3 zu mie-
ten und sie an Körperschaften aus der Bevölkerung wei-
terzugeben. Die Bewohner der Umgebung sollten bei der
Ideenfindung, der Rea-
lisierung und der Be-
Abb. 6: Gerangel um den „Patient“ Kaser- nutzung direkt einbe-
nenareal – die brauchbaren Teile werden zogen werden.
herausgeschnitten.... Nach dem Auszug des
Militärs waren Miet-
verträge mit dem Globus zur Nutzung eines grossen Teiles der
Gebäude als Lagerräume abgeschlossen worden. Die Stadt
begrüsste einen Mieter, der einem künftigen Neubau nicht im
Wege stehen würde. Für das “Ent-stoh-lo”-Projekt ergab sich
dadurch jedoch ein Platzproblem. Durch Zufall erfuhr die IKA
schliesslich von einem freigewordenen Estrich und konnte so
ihr erstes Projekt, einen Spielestrich für Kinder, verwirkli-
chen. Finanziert wurde dies durch die Veranstaltung von Fes-
ten und guten Beziehungen zu sozialen Einrichtungen.
Trotz unermüdlicher Bemühungen erwies sich die “Ent-stoh-
lo”-Umsetzung als wesentlich schwieriger als geplant. Bei der ...Erst unter der Obhut der IKA tritt
Verwaltung biss die IKA immer wieder auf Granit. Es war ein eine Besserung ein.
mühseliger Prozess, doch nach und nach kamen Erfolgserleb-
nisse: 1976 zog das “Kaffi Schlappe” und das Frauenzentrum
3
Die Zentralstelle für staatlichen Liegenschaftsverkehr (ZLV) betreut innerhalb der Kantonalen Verwaltung den
Geschäftsbereich Liegenschaften.7 ein. Die “Kulturwerkstatt Kaserne” und eine Moschee entstanden vier Jahre später. Nach einiger Zeit stellt man fest, dass das Warenlager im Stalltrakt vom Globus nicht mehr gebraucht wurde. So konnten immer mehr Räumlichkeiten erlangt werden. Bald folgten der Seniorenwerkhof und die Beiz “Rössli”. So entstand allmählich ein Kulturzentrum, in dem nicht nur Personen ver- schiedener Altersklassen, sondern auch unter- schiedlicher Herkunft aufeinandertreffen. Jeder Einwohner kann sich an diesem Projekt beteiligen. Das ist bei diesem Konzept ge- währleistet. In der Praxis macht sich das darin bemerkbar, dass ein Bürger sich dem VIP anschliessen kann. Der Verein beurteilt Vor- schläge für kulturelle oder soziale Nutzungen und entscheidet, welches Projekt schliesslich umgesetzt wird. Andererseits kann man selbst eine dieser Anregungen beim VIP präsentie- ren. Eine dritte Möglichkeit zur Mitwirkung besteht im Teilnehmen einer Abstimmung Abb. 7: Der Spielestrich auf dem ehemaligen Heubo- über das Gelände. Ein solcher Fall trat 1987 den über den Ställen bei der Entscheidung über die erste Kaser- nenareal-Initiative ein. Sie war schon 20 Jahre vorher eingereicht worden und forderte einen Park kombiniert mit einer Tiefgarage. Das Basler Stimmvolk lehnte diese Initiative ab und bewies somit, dass die Einrichtungen auf dem Grundstück durchaus von einer breiten Masse gebraucht werden. Ein Jahr danach wurde ein Wettbewerb zur Aussenraumgestaltung veranstaltet. Doch das von der Bevölkerung angenommene Projekt “Die Wiese zwingt den Rhein ins Knie” scheiterte an mangelnden Finanzen. Es sah die Öffnung des Areals zum Rhein vor. Schritt für Schritt installierten sich weitere Einrichtungen auf dem Kasernenareal. So nutzen heu- te verschiedenste Organisationen die verfügbaren Räume: Ein Boxclub und das Junge Theater Basel haben dabei ebenso ihren Platz wie der Kasernentreff oder die Schule für Gestaltung. Trotz aller Schwierigkeiten kann das Kasernenareal heute also vielfältig und intensiv genutzt werden und ist aus dem Stadtbild des Kleinbasels nicht mehr wegzudenken. 4.3 Zukunftspläne Ein grosses Ziel, das schon im “Ent-stoh-lo”-Projekt festgeschrieben steht, ist die Verbindung des Kasernenareals mit dem Erholungsgebiet Rheinpromenade. Dieses Projekt konnte wegen bis jetzt noch nicht verwirklicht werden, doch wird die IKA alles daran setzen, dass der “Durchstich” durch das Kasernengebäude zum Rhein hin realisiert wird. 5. Schlusswort Je mehr wir uns in das Thema eingearbeitet haben, desto spannender erschien uns die Vergan- genheit der Basler Kasernenareals. Die Gespräche mit Ruedi Bachmann, einem der “Ent-stoh- lo”-Architekten, trugen viel zur Faszination für die Zeit der 68er-Revolution und deren Auswir- kungen auf die Entwicklung des Kasernenareals bei.
8 Was sich in Basel vor 40 Jahren abspielte, hat bis heute nicht an Aktualität verloren: Immer wie- der werden Militärgebäude für eine neue Nutzung frei. Das mutige “Ent-stoh-lo”-Konzept mit dem ständigen Einbezug der Bevölkerung könnte dabei eine Vorreiterrolle spielen. Es zeigt, wie mithilfe engagierter Personen aus einem Abbruchprojekt eine auf das Quartier zugeschnittene, sinnvolle Einrichtung entstehen kann. Vom Bücherfinden in der Unibibliothek über das Führen von Interviews bis zum Umgang mit Bergen von Informationen haben wir während dieser Arbeit viel gelernt. Wir hoffen, dass man beim Lesen auch einen Teil jenes Interesses, mit dem wir uns dem Thema gewidmet haben, her- ausspüren kann. Abstract Die Arbeit befasst sich mit dem Übergang der Kaserne Basel vom Militärgebäude zu einem Kul- tur- und Quartiertreffpunkt. Dabei legen wir einen Schwerpunkt auf die Besonderheit dieser Ent- wicklung unter dem Hintergrund der 68er-Bewegung. This work is about the development of the barracks in Basel from a military building to an arts centre. We are concentrating our efforts on the special features of this change together with the student revolt of the late sixties. Ce travail traite de la transformation de la Caserne de Bâle d’une installation militaire en un cen- tre culturel. En faisant ceci, nous concentrerons nos efforts sur les spécifités de ce développement en regardant le mouvement de 1968. Selbstständigkeitserklärung Wir erklären hiermit, dass wir diese Arbeit selbstständig durchgeführt und keine anderen als die angege- benen Quellen, Hilfsmittel oder Hilfspersonen beigezogen haben. Alle Textstellen in der Arbeit, die wört- lich oder sinngemäss aus Quellen entnommen wurden, haben wir als solche gekennzeichnet.
9
Literatur- und Quellenverzeichnis
Quellen
Plan 1860 Falknerplan, von: Grundbuch- und Vermessungsamt
Baselstadt
Gespräche mit Gewährs-
leuten
Gespräch über Alternativ- Das Gespräch wurde im März 2005 geführt mit Ruedi
kultur Bachmann. Mündliche Auskunft vom 5.3.2005
Gespräch über ENT- Das Gespräch wurde im Februar 2005 geführt mit
STOH-LO Ruedi Bachmann. Transkription bei den Verfassern.
Gespräch über Kasernen- Das Gespräch wurde im Februar 2005 geführt mit
areal Sonja Scheidegger. Mündliche Auskunft vom
26.2.2005.
Darstellungen
IKA 2004 IKA, Interessengemeinschaft Kasernenareal: Dreissig
Jahre IKA. 2004
KOMM VIP 1973 Kleinbasler Öffentlichkeitsbereich menschlicher Mit-
wirkung, Verein interessierter Personen: ENT-STOH-
LO. Basel 1973
Lachenmeier 2003 Dominik Lachenmeier: Die Arena – eine Gruppierung
der Basler “68er-Bewegung” zwischen “etablierter”
und “alternativer” Öffentlichkeit. Basel 2003
Lebmeier 1991 Anita Lebmeier: Vom militärischen Drill zum kreativen
Drall. In: Savoir vivre, ein Magazin der Basler Zeitung.
Basel 199110
Schiess 1994 Robert Schiess: Kasernenareal Basel. Vom Kloster über
Kaserne zum Kultur- und Quartiertreffpunkt. Basel
1994. In: Basler Heimatschutz, Jahresbericht 1993/94
Internetquellen
http://www.kaserne-basel.ch/
http://www.zlv.bs.ch/
http://www.basel.ch
Abbildungsverzeichnis
Abb. 1: Kaserne bei Nacht, Hauptgebäude, Foto von B. Stähelin ....................................2
Abb. 2: Ausschnitt aus dem Basler Stadtplan, von www.basel.ch ....................................2
Abb. 3: Ausschnitt aus Matthäus Merian d. Ä.: Vogelschauplan der Stadt Basel von Nor-
den, 1615, mit Kloster Klingental ....................................3
Abb. 4: Stich des Architekten J.J. Stehlin: Perspektive seines Projektes für die Kaserne....3
Abb. 5: Einladung der ARENA zu einer Diskussion mit Wilfried Heidt, aus Ruedi Bach-
manns persönlichem Archiv, undatiert ....................................4
Abb. 6: Karikatur von Hans Geisen (aus H. J. Nidecker: Das Kasernenareal in seiner Funk-
tion heute und morgen, 1988) ....................................5
Abb. 7: Spielestrich auf dem ehemaligen Heuboden, aus: Savoir vivre, Magazin zur Basler
Zeitung, Herbst 1991 ....................................6Sie können auch lesen