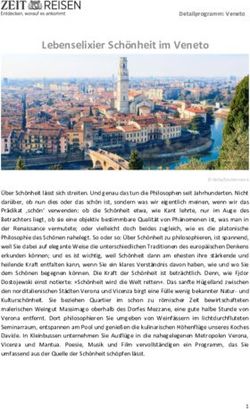Die Sammlung Klaus Giesen - Münzprägungen aus der Zeit der Ottonen und Salier (919-1125)
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Die Sammlung Klaus Giesen – Münzprägungen aus der Zeit der
Ottonen und Salier (919-1125)
Im Jahre 833 verlieh König Ludwig der Fromme (814–840) der Abtei Corvey an der Weser als erster geistlicher
Institution des Karolingerreiches das Münzrecht, und zwar »quia locum mercationis ipsa regio indigebat« (»weil
dieser Ort eines Marktplatzes entbehrte«). Dennoch sollte es noch bis ins 11. Jahrhundert dauern, bevor erste Äbte
selbstbewusst ihren Namen und ihr Bild auf die Prägungen setzten (Abb. 1, Kat-Nr. 337). Zugleich steht dieser
Prozess symptomatisch für die umwälzenden monetären Entwicklungen, die sich vom 9. bis zum 12. Jahrhundert
auf dem Gebiet des ostfränkisch-deutschen Reiches vollzogen: Hatte es zu Beginn der Herrschaft des ersten Nicht-
Karolingers Heinrich I. (919–936) (Abb. 2, Kat-Nr.103) östlich des Rheins und nördlich der Donau mit Würzburg
nur eine Münzstätte gegeben, weiteten die ottonisch-salischen Herrscher dieses dürftige Prägestättennetzwerk
schließlich auf über 150 Orte aus.
Abb. 1: Corvey. Abt Rudhard, 1046–1050 mit
Namen Heinrichs III. als König, 1039–1046. Denar.
1,67 g; Ein lateinisches Kreuz, in den Winkeln je ein
Punkt. H … ICREX. Rv.: Schriftkreuz mit dem Namen
ROTHA / RD – VS, in den Winkeln A - B - A – S.
Auktion 154, Frankfurter Münzhandlung,
6. November 2020, Nr. 337.
Abb. 2: Verdun. Heinrich I. (919–923). Denar. 1,42 g;
Im Felde der Titel REX, Umschrift beginnt unten.
+ HEIN … VD (D seitenverkehrt). Rv.: Kreuz mit jeweils spitz
auslaufenden Enden der Kreuzarme; im vierten Winkel ein
Punkt. +VIRD … Auktion 154, Frankfurter Münzhandlung,
6. November 2020, Nr. 103.
Zumeist war es die Geistlichkeit – Erzbischöfe, Bischöfe, Äbte und Äbtissinnen – die vielerorts neben dem König
zuerst als Träger der Münzprägung fungierte, bevor auch weltliche Herrschaftsträger – Herzöge und Grafen – diese
für sich in Anspruch nahmen. Kein Wunder – war der Klerus doch gleichzeitig Träger der Schriftlichkeit und Zentrum
der Verwaltung dieses Reiches, das noch keine Hauptstadt kannte und dessen Infrastruktur (Straßen und Brücken)
nur mäßig ausgebaut war. Letzteres war wie die fehlende Münzprägung ein Resultat des Umstandes, dass die
Gebiete östlich des Rheins nicht in das antik-römische Reich eingegliedert worden waren. Zu den interessantesten
Erscheinungen auf dem Gebiet der weltlich-herzoglichen Münzprägung gehören hierbei die Andernacher Münzen
von Dietrich I. (984–1027), die einen äußerst detaillierten Stempelschnitt aufweisen und für diese frühe Zeit sehr
1ungewöhnliche zweifigurige Darstellungen zeigen (Abb. 3, Kat-Nr. 146). Möglicherweise lieferten hierbei antike oder
byzantinische Münzen die Vorlage.
Abb. 3: Andernach. Herzog Dietrich I. (984-1027).
Denar. 1,1 g; Zwei zueinander gekehrte bärtige
Brustbilder, dazwischen ein Stab mit einer Blütenspitze
… EODERIC – Rv.: Der Name der Münzstätte in ein
Kreuz gestellt … NDER / NA - K … in den Winkeln des
Kreuzes Dreispitz - Zweig - Dreispitz - Zweig. Auktion 154,
Frankfurter Münzhandlung, 6. November 2020, Nr. 146.
Die umfangreiche Prägung von Klöstern wie Corvey oder der dem Heiligen Remaclus geweihten Abtei Stablo (Abb.
4, Kat-Nr. 170) ist dabei im europäischen Kontext ein besonderes Phänomen des Reiches geblieben, an der sogar
Äbtissinnen, wie diejenigen von Quedlinburg, Gandersheim oder Herford, partizipierten. Zumeist handelte es sich bei
ihnen um Mitglieder der regierenden Herrscherfamilien, die damit Spitzenpositionen in der Hierarchie bekleideten
und dies auch selbstbewusst in Bild und Schrift der Münzen zur Schau stellten. Zumeist waren es die Darstellungen
der Schutzheiligen, von denen die klösterlichen Münzbilder dominiert wurden, aber auch einflussreiche Äbte wie
Saracho von Corvey (1056–1071) ließen ihr Porträt in Metall verewigen.
Abb. 4: Stablo. Denar. 1,03 g; Brustbild des Heiligen
Remaclus mit geschultertem Krummstab nach
rechts. … VCE … Rv.: Dreigeschossige Kirchenfront
hinter Arkaden. … LAVS. Auktion 154, Frankfurter
Münzhandlung, 6. November 2020, Nr. 170.
Ansonsten waren es vor allem die mächtigen Erzbischöfe wie diejenigen von Trier (Abb. 5, Kat-Nr. 140) und
Bischöfe wie diejenigen von Metz (Abb. 6, Kat-Nr. 121), die nach und nach das ursprünglich königliche Recht
der Münzprägung verliehen bekamen oder in Zeiten unsicherer Herrschaft wie dem Investiturstreit (1076–1122)
zwischen Kaiser und Papst einfach okkupierten. Die Prägungen dieser geistlichen Werkstätten wurden häufig zu
Leitmünzen für benachbarte kleinere Münzstätten, in denen sie getreulich kopiert oder zumindest leidlich imitiert
wurden. In einer Zeit, in der nur die wenigsten Menschen lesen und schreiben konnten, waren etablierte Münzbilder
wichtig für die Akzeptanz der Gepräge im Zahlungsverkehr.
Abb. 5: Trier. Erzbischof Eberhard (1047–1066). Denar.
1,19 g; Brustbild des Erzbischofs nach rechts, vor ihm der
Krummstab. EBERHART … STRE. Rv.: Die rechte Hand
Gottes hält zwei Schlüssel, deren Bärte die Buchstaben
E und R der Legende … PETRVS bilden. Auktion 154,
Frankfurter Münzhandlung, 6. November 2020, Nr. 140.
2Abb. 6: Metz. Bischof Adalbero II. (984-1005).
Denar. 0,99 g; Kopf des Bischofs nach links.
ADAL … RO EPS. Rv.: Kirchenfront, im Portal ein
Kreuz. + M … T E S. Auktion 154, Frankfurter
Münzhandlung, 6. November 2020, Nr. 121.
Da diese Nachahmungen ebenfalls aus zumeist guthaltigem Silber geprägt wurden, handelt es sich auch nicht um
Münzfälschungen im eigentlichen Sinne. Vielmehr waren es Maßnahmen zur Steigerung der Vertrauenswürdigkeit
in die eigene Münzprägung, wenngleich diese von den größeren Münzstätten argwöhnisch beobachtet wurden.
Von Otto III. (983–1002) dagegen ist sogar eine Urkunde vom 2. Juli 993 überliefert, in der er dem Kloster Selz
anordnete, die Münzen der benachbarten Prägestätten von Straßburg und Speyer nachzuahmen, um die eigenen
Gepräge leichter in Umlauf bringen zu können. Selbst königliche Münzstätten wie Dortmund scheuten vor der
Nachahmung gängiger Münzbilder von beispielsweise Köln nicht zurück (Abb. 7, Kat-Nr. 307). Durch die Imitation
gängiger Münzbilder und die Anlehnung der eigenen Gepräge in Gewicht und Feingehalt an größere Münzstätten
bildeten sich allmählich verschiedene Währungsregionen heraus, die letztlich zur Regionalisierung der Münzprägung
und des Geldwesens im Reich während der Stauferzeit führten.
Abb. 7: Dortmund. Otto III., 983-1002, als König bis
996. Denar. – Nachahmung des Kölner Münzbildes
mit zweizeiligem Stadtnamen. 1.27 g; Kreuz, in
jedem Winkel ein Punkt. + ODDO + REX. Rv.: In drei
Zeilen. THERT / + / MANNI. Auktion 154, Frankfurter
Münzhandlung, 6. November 2020, Nr. 307.
Diese und andere interessante Münzgeschichten aus der Zeit der Herrscherdynastien der Ottonen und Salier
erzählen die Objekte der Sammlung Klaus Giesen, die nun in zwei Teilen bei der Frankfurter Münzhandlung unter
den Hammer kommt. Nach der Spezialsammlung von Dr. Bernhard Schulte (Auktion Münzen und Medaillen
GmbH 28, 30./31. Oktober 2008) handelt es sich um eine der umfangreichsten Zusammenstellungen dieser Art
in den letzten Jahrzehnten. Damit stellt der Katalog nicht nur die immense Vielfalt der Münzbilder des 10./11.
Jahrhunderts in großformatigen Farbbildern jedermann vor Augen, sondern bildet zugleich eine wertvolle Ergänzung
zu numismatischen Einführungswerken zu dieser Epoche.
Über die Sammlerpersönlichkeit Klaus Giesen
Klaus Giesen (geb. 1934) ist dabei ein »spätberufener Münzsammler«: Den systematischen Aufbau seiner Sammlung
begann er erst nach seinem Ruhestand im Jahre 1999. Den Großteil seines Berufslebens verbrachte er in der
chemischen Industrie bei einem Unternehmen im Kreis Diepholz. Dort entstand aus regionalem Geschichtsinteresse
zunächst eine Vorliebe für die spätmittelalterlichen Münzen von Diepholz, zu denen er umfangreiches Material und
3Literatur sammelte. Die Ergebnisse seiner Recherchen flossen in die Publikation »Die Münzen von Diepholz« (2001)
ein, der nur kurze Zeit später »Die Münzen von Hoya« (2004) folgte. Bis heute sind beides Standardzitierwerke für
Münzsammler dieser Gebiete, für die Klaus Giesen 2013 auch den Eligius-Preis erhielt.
Das Interesse für die ottonisch-salischen Münzen wurde allerdings schon weitaus früher geweckt. 1978 kaufte er die
erste Münze dieses Zeitraums bei einem Osnabrücker Münzhändler. Zunächst blieb jedoch aus beruflichen Gründen
lange keine Zeit, sich intensiver damit zu beschäftigen. Erst rund 20 Jahre später konnte er das in dem Gespräch
mit dem Münzhändler geweckte Interesse für ottonisch-salische Münzen vertiefen und zielstrebig bis zur heutigen
Sammlung ausbauen. Dabei beließ er es nicht ausschließlich beim Erwerb der Stücke, sondern nutzte diese als
Anknüpfungspunkte für weitreichende historisch-numismatische Untersuchungen: Zwischen 2012 und 2019 hat
er zahlreiche Aufsätze verfasst, von denen insbesondere die Untersuchungen zu den Hälblingen (Obolen) der Otto-
Adelheid-Pfennige, den EILHARD-Denaren und der Münzstätte Remagen im 11. Jahrhundert auch in Fachkreisen
große Beachtung gefunden haben. Fragt man ihn nach seiner »Lieblingsmünze«, so verweist Klaus Giesen allgemein
auf die Produkte der Münzstätte seines Geburtsortes Duisburg, die ihn wegen ihrer besonders qualitätsvollen
Prägung faszinieren.
Stets lag ihm aber auch die Förderung des numismatischen Nachwuchses sehr am Herzen. Im Dezember 2019
schenkte er eine Sammlung von knapp 800 Münzen aus aller Welt zu Unterrichtszwecken an das Gymnasium in
Damme. Die Stücke hatte er von vielen beruflichen und privaten Reisen mitgebracht und durch etwa 130 deutsche
Münzen ergänzt, anhand derer sich der Flickenteppich der Münzprägung vor der Gründung des Kaiserreiches 1871
besonders anschaulich den Schüler*innen näherbringen lässt.
Klaus Giesen ist auch ein gefragter Gesprächspartner (nicht nur) in Fragen zur mittelalterlichen oder westfälischen
Münzprägung. Zu den Münzfreunden für Westfalen und Nachbargebiete kam er über die Bekanntschaft mit Peter
Ilisch, den er wegen der Bibliothek in Münster Ende der 1990er Jahre erstmals anschrieb und um eine Aufsatzkopie
bat. Bis heute ist er festes Mitglied der sich regelmäßig treffenden Münzbolde und schätzt nicht nur den fachlichen
Austausch, sondern vor allem den persönlichen Kontakt zu seinen Münzfreunden. Vielleicht beschäftigen ihn auch
deshalb in den letzten Jahren immer wieder die Biographien bekannter Sammlerpersönlichkeiten. Augenblicklich liegt
auf seinem Schreibtisch der »Leitfaden für die Sammlung der Münzen des Mittelalters und der neueren Zeit« (Berlin
1850) … vielleicht der Ausgangspunkt einer neuen Publikation über die Entwicklung des privaten Münzensammelns
und der wissenschaftlichen Beschäftigung mit Münzen seit der Mitte des 19. Jahrhunderts?
Aber auch in so manchen Lehrveranstaltungen an den Universitäten von Münster und Osnabrück war er ein gern
gesehener Gast, der den Studierenden mit Literaturhinweisen oder Aufsatzkopien hilfreich zur Seite stand und sogar
Stücke aus seiner Sammlung als Anschauungsmaterial mitbrachte. Denn für Klaus Giesen steht fest: Münzen erzählen
oftmals mehr als die spärlichen Schriftquellen des frühen und hohen Mittelalters und das Originalobjekt übt immer
noch die größte Faszination aus. Der Beweis dafür liegt nun in Gestalt des Auktionskatalogs der Sammlung Giesen
vor, deren Stücke hoffentlich viele neu am Mittelalter interessierte Besitzer finden werden.
© Frankfurter Münzhandlung Nachf. GmbH, 2021
4Sie können auch lesen