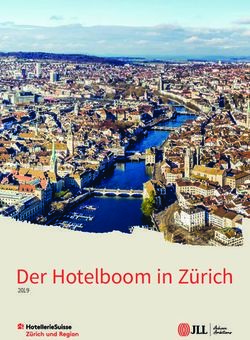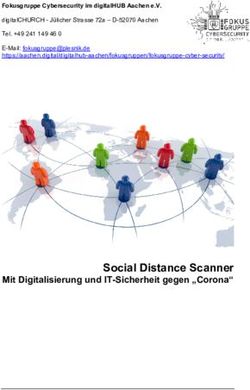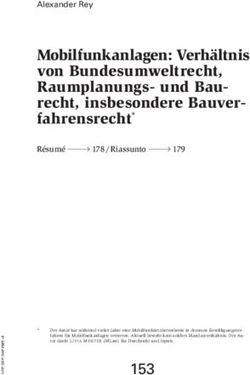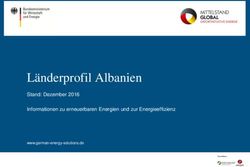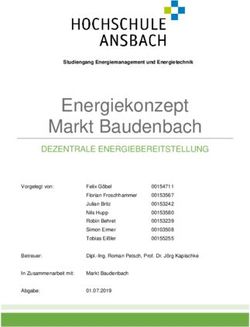Direktverbrauch Volleinspeisung - PV-Wegweiser Leitfaden für die Planung von PV-Anlagen und - HTW Berlin
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
HTW Berlin
Joseph Bergner, PV-Wegweiser
Bernhard Siegel
Leitfaden für die Planung von PV-Anlagen und
Stand April 2021
der solaren Eigenversorgung
Direktverbrauch
VolleinspeisungPV-Wegweiser - Leitfaden für die Planung von PV-Anlagen und der solaren Eigenversorgung
Autoren: Joseph Bergner und Bernhard Siegel
Fachbereich 1 – Ingenieurwissenschaften und Information
Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin
Version 1.0 (April 2021)
Webseite: https://pvspeicher.htw-berlin.de/
Förderung und Danksagung:
Der Leitfaden entstand im Forschungsprojekt PV2City im Rahmen des Berliner
Programms für Nachhaltige Entwicklung (BENE). Gefördert aus Mitteln des Europäischen
Fonds für Regionale Entwicklung des Landes Berlin (Förderkennzeichen 1048-B5-0).
Inhalt
1 Einleitung..................................................................1 3.1 Überblick................................................................................................................12
3.2 Dach und Gebäude.................................................................................................12
1.1 Hintergrund..............................................................................................................1
3.3 Stromerzeugung....................................................................................................14
1.2 Zielstellung und Aufbau des Leitfadens.................................................................1
3.4 Stromverbrauch und Direktverbrauch..................................................................16
1.3 Überblick über die Leitfragen..................................................................................2
3.5 Geschäftsmodell und Aufwand.............................................................................18
2 Zusammenstellung bestehender Literatur...............3 3.6 Ökonomische Eingangsparameter........................................................................20
2.1 Allgemeiner Ablauf eines PV-Projekts....................................................................3 4 Wirtschaftlichkeitsberechnung.............................24
2.2 Ein- und Zweifamilienhäuser...................................................................................5
2.3 Mehrfamilienhäuser.................................................................................................6
5 Fazit........................................................................29
2.4 Gewerbe...................................................................................................................7
6 Anhang....................................................................30
2.5 Kommunale Gebäude...............................................................................................8
6.1 Bestimmung des Direktverbrauchs.......................................................................30
2.6 Quellenverweise......................................................................................................9
6.2 Beispiele zur Berechnung der Wirtschaftlichkeit.................................................39
3 Leitfragen für eine Solarstromversorgung............12 6.3 Weitere Schaubilder zu PV-Anlagen.....................................................................441 – Einleitung –1–
1 Einleitung
1.1 Hintergrund
Lokale, dezentrale Stromproduktion aus erneuerbaren Quellen schont die Umwelt,
die Ressourcen und ist zudem noch wirtschaftlich realisierbar. Wer jedoch beim Club
der Solarstrom-Nutzer_innen mitmachen möchte, muss einiges beachten. Dieser
Leitfaden versucht hierbei Hilfestellung zu bieten und einen Einstieg für weitere
Recherchen zu liefern.
1.2 Zielstellung und Aufbau des Leitfadens
Wer günstigen grünen Strom selbst erzeugen möchte, kommt um das Thema Photo- werden. Dazu wird das gesamte Projekt anhand von Leitfragen betrachtet, welche im
voltaik (PV) und Eigenversorgung nicht herum. Neben den Energiekosten kann der folgenden Kapitel 1.3 aufgeführt sind.
mit der Energieversorgung verbundene Ausstoß von CO2 vermindert werden.
Die rechtliche Grundlage zur eigenen Stromproduktion ist komplex und schwierig zu In Kapitel 4 werden dann die notwendigen Rechengrößen zur Abschätzung der Wirt-
verstehen (Abgaben, Abgrenzung, Meldepflichten etc.). Es gibt daher bereits zahlrei- schaftlichkeit dargestellt. Mithilfe des Schemas in Abbildung Abbildung 4.1 und den
che Leitfäden und Papiere zu Eigenversorgung mit PV. Warum also ein weiterer Leit- Formeln in Tabelle 7 ist diese Abschätzung direkt möglich. Zusätzlich bieten ver-
faden zur Installation von PV-Anlagen? schiedene Web-Anwendungen1 aufbereitetes Wissen zur Thematik an. Mit ihnen kön-
Brücke schlagen zwischen Einstiegsliteratur und Detailwissen nen die komplexen Zusammenhänge spielerisch erfasst und eine detailliertere Wirt-
Im folgenden Kapitel 2 werden die einzelnen deutschsprachigen Leitfäden gesam- schaftlichkeitsberechnung vorgenommen werden.
melt präsentiert. Hieraus ergibt sich ein Überblick, wo Informationen bereits gut
aufbereitet zur Verfügung stehen. Die vorhandene Literatur (Stand: November 2020) In Kapitel 5 werden die Inhalte kurz zusammengefasst.
ist nach den unterschiedlichen Anwendungsfällen gruppiert in Ein- und Zweifami-
lienhäuser (Kapitel 2.2), Mehrfamilienhäuser (Kapitel 2.3), Gewerbe (Kapitel 2.4) und
Zusätzlich ermöglicht der Leitfaden die Abschätzung des Direktverbrauchs für Ein-
öffentliche Gebäude (Kapitel 2.5). Die Quellenverweise finden sich anschließend in
und Mehrfamilienhäuser, öffentliche Gebäude und Gewerbe anhand von durchge-
Tabelle 1.
führten Simulationsrechnungen. Aus Gründen der Übersichtlichkeit finden sich diese
im Kapitel 6.1 im Anhang. Darüber hinaus sind Beispielrechnungen für unterschiedli-
Im Kapitel 3 soll das Verständnis für die technische Auslegung einer PV-Anlage ver- che Anwendungsfälle (Kapitel 6.2) sowie interessante Schaubilder aus anderer Lite-
mittelt werden. Ebenfalls soll die Auswahl des passenden Geschäftsmodells einge- ratur (Kapitel 6.3) im Anhang zu finden.
grenzt und notwendigen Annahmen zur Wirtschaftlichkeitsberechnung getroffen
1 Links zu den Webanwendungen unten in Tabelle 1
Zurück zum Inhaltsverzeichnis1.3 – Überblick über die Leitfragen –2–
1.3 Überblick über die Leitfragen
Bei der Erstellung dieses Dokuments wurde sich am Initialfragebogen der Initiative • Geschäftsmodell und Aufwand (Kapitel 3.5)
„Dein Dach kann mehr“ der Stadt Freiburg orientiert. Hierbei handelt es sich um Fra- ◦ Soll der PV-Strom lokal genutzt werden?
gen, mit denen Sie sich als zukünftiger Anlageneigner_in gegebenenfalls auseinan- ◦ Welches EEG-Geschäftsmodell kommt für mich in Frage?
der setzen müssen. In Kapitel 3 wird versucht, jeweils die notwendigen Hinter- ◦ Wer soll investieren?
grundinformationen zu liefen und eine schnelle Antwort zu ermöglichen. Dort finden ◦ Zusammenfassung: Geschäftsmodelle
sich die folgenden Leitfragen:
• Ökonomische Eingangsparameter (Kapitel 3.6)
◦ Wie hoch ist der Strompreis?
• Dach und Gebäude (Kapitel 3.2) ◦ Wie hoch ist die EEG-Umlage?
◦ Wie viel Dachfläche steht zur Verfügung? ◦ Wie hoch ist die Einspeisevergütung?
◦ Sind Sie Eigentümer_in der Dachfläche? ◦ Wie teuer ist die PV-Anlage?
◦ Wie ist die Dachfläche ausgerichtet und geneigt? ◦ Wie hoch sind die Betriebskosten?
◦ Wie groß ist die Dachfläche? ◦ Wie teuer ist der Strom aus der PV-Anlage
◦ Gibt es Objekte, die Schatten auf die Dachfläche werfen? ◦ Ist eine steuerliche Optimierung möglich?
◦ Muss das Dach in den nächsten 20 Jahren saniert werden?
◦ Kann das Dach die zusätzliche Last einer PV-Anlage tragen? Infobox: Die Leistung einer PV-Anlage
◦ Welche Dachhaut liegt vor?
Die Leistung einer PV-Anlage wird in Watt (W) angegeben und hängt von der
◦ Wie hoch ist das Gebäude?
Sonneneinstrahlung ab; sie ändert sich also ständig. Um PV-Anlagen verglei-
◦ Steht ihr Gebäude unter Denkmalschutz?
chen zu können, wurde ein standardisiertes Messverfahren entwickelt, bei dem
◦ Gibt es eine Asbestbelastung?
die Leistungsabgabe gemessen wird. Diese wird – abgeleitet von den Standard
• Stromerzeugung (Kapitel 3.3) Testing Conditions – als STC-Leistung, oder Peak-Leistung bezeichnet und in
◦ Welchen Ertrag können Sie erwarten? Abgrenzung zur real erzeugten Leistung in Watt Peak (Wp) angegeben.
• Stromverbrauch und Direktverbrauch (Kapitel 3.4) Hinzu kommen ggf. die Vorsilben kilo (k) für Tausend, mega (M) für Millionen
◦ Wie hoch ist der Stromverbrauch? oder auch giga (G) für Milliarde.
◦ Wird ein Leistungspreis gezahlt? Geht es um die erzeugte Energie, so wird die erzeugte Leistung mit der Zeit
◦ Wer verbraucht den Strom? multipliziert. Bei einer konstanten Leistung von 1 kW werden in 2 Stunden (h)
◦ Könnte sich der Stromverbrauch in den nächsten Jahren ändern? also 2 kWh an Energie (Strom) bereitgestellt.
◦ Welchen Anteil der PV-Energie können Sie lokal nutzen?
Da es in diesem Leitfaden ausschließlich um die STC-Leistung von PVAnlagen
geht, wird diese vereinfachend mit kW und nicht mit kWp angegeben.
Zurück zum Inhaltsverzeichnis2 – Zusammenstellung bestehender Literatur –3–
2 Zusammenstellung bestehender Literatur
Es gibt zahlreiche deutschsprachige Leitfäden zum Thema PV. Diese des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) oder anderer Rechtsvorschriften Gültig-
unterscheiden sich zum einen hinsichtlich der inhaltlichen Schwer- keit besitzen. Dies ist bei der Bewertung und Einordnung der Informationen zu
punktsetzung und zum anderen in der Tiefe und im adressierten Publi- berücksichtigen. Der Leitfaden wurde mit der Veröffentlichung des EEG 2021 aktua-
kum. Die meisten Leitfäden zur Solarenergie liefern ebenfalls einige lisiert und sollte somit den aktuellen Rahmen (2021) abbilden.
technische Erklärungen. Für aktuelle Informationen bietet das Fraunhofer Institut Im Folgenden werden die deutschsprachigen Leitfäden nach der Zielgruppe sortiert
für Solarenergieforschung (ISE) in regelmäßigen Abständen die aktualisierten vorgestellt. Anschließend folgen in einer gemeinsamen Tabelle die referenzierten
„Fakten zur Photovoltaik“ (60). Quellenverweise 1 bis 62. Sie sind nach Leitfäden und Fachbeiträgen, Online-Werk-
Darüber hinaus ist das Energierecht einem andauernden Reformprozess unterwor- zeuge sowie allgemeine Informationen gruppiert und Webseiten und jeweils nach
fen, sodass Hinweise und Empfehlungen mitunter lediglich bis zur nächsten Reform der Aktualität sortiert.
2.1 Allgemeiner Ablauf eines PV-Projekts
Die Leitfäden haben unterschiedliche Zielgruppen und einen unterschiedlichen • Das wirtschaftlichste Angebot wurde anhand von Kosten, technischen
Fokus. Gemeinsamkeiten lassen sich in der Beschreibung des Ablaufs in Vorausset- Komponenten und Vertragsbedingungen gewählt.
zung, Planung und Umsetzung finden (vgl. dazu auch Abbildung 1). Nicht in jedem Ist die Installation erfolgt werden meist noch folgende Punkte benannt:
Leitfaden sind jedoch zu allen Punkten Informationen zu entnehmen.
• Verwaltungsvorgänge und Anmeldung sind abgeschlossen.
Optional: Mieter_innen werden als Kund_innen geworben.
Die Grundlage bilden die allgemeinen Voraussetzungen, die meistens folgende • Es gibt ein Monitoring, eine regelmäßige Abrechnung und Wartung.
Punkte enthalten:
• Es gibt eine potenziell geeignete Fläche, über die direkt oder indirekt ver- Im folgenden Kapitel sind die unterschiedlichen Leitfäden anhand der Zielgruppen in
fügt werden kann. Ein- und Zweifamilienhäuser, Mehrfamilienhäuser, Gewerbe und öffentliche
• Es ist die Motivation für eine PV-Installation vorhanden. Gebäude eingeteilt.
• Die Rollen bei Finanzierung, Bau und Betrieb sind geklärt.
In der Phase der Planung werden zumeist folgende Meilensteine beschrieben:
• Die Planung und Auslegung erfolgte unter Berücksichtigung des techni-
schen Rahmens und der finanziellen Förderung.
Zurück zum Inhaltsverzeichnis2.1 – Allgemeiner Ablauf eines PV-Projekts –4–
Abbildung 1: Ablauf bestehend aus Voraussetzungen, der PV-Planung und der Umsetzung.
Zurück zum Inhaltsverzeichnis2.2 – Ein- und Zweifamilienhäuser –5–
2.2 Ein- und Zweifamilienhäuser
Zahlreiche Leitfäden richten sich an das breite Publikum der Privatpersonen und Ein- Insbesondere bei den steuerrechtlichen Themen können Privatpersonen der Wirt-
und Zweifamilienhausbesitzer_innen. Diese machen hinsichtlich der Anzahl einen schaftlichkeit ihrer PV-Anlage auf die Sprünge helfen. Einen guten Überblick liefert
Großteil der PV-Anlagenbetreiber_innen aus und sind ein wichtiges Fundament der das Merkblatt von solaranlagen-portal.de (29). Vertiefende Informationen können
partizipativen Energiewende. Angesichts der meist kleinen Dachflächen und der bspw. beim pv-magazine unter der Rubrik Steuern gewonnen werden (37) oder aber
geringen zu installierenden PV-Leistung stellen sie jedoch nur einen Bruchteil der in der Sonnenenergie, der Mitgliederzeitschrift der Deutschen Gesellschaft für Son-
gesamten in Deutschland installierten PV-Anlagenleistung. Die Eigenversorgung mit nenenergie (DGS) e.V. (23, 45).
Solarstrom ist hier in der Regel technisch und wirtschaftlich möglich und das Ener- Empfehlenswert sind auch die Fakten- und Aktionsblätter der Freiburger Kampagne
gierecht ist überschaubar. „Dein Dach kann mehr!“ (28). Zentrale Fragen sind auf je zwei Seiten beantwortet
Einfach zugängliche Informationen bieten hierbei die Verbraucherzentralen aus und liefern gute Anknüpfungspunkte. Die Aktionsblätter zeigen in wenigen Schritten
Nordrheinwestfalen (14) und Rheinland-Pfalz (36). Hierbei werden sowohl techni- den Weg zur eigenen Solaranlage auf.
sche Informationen zur PV und Speicher dargestellt als auch wertvolle Hinweise zur Technisch anspruchsvoller wird es, wenn neben dem Haushaltsstrom zusätzlich eine
Bewertung von Angeboten gegeben. Ebenfalls einen breiten Überblick liefert das Wärmepumpe und ein Elektroauto berücksichtigt werden sollen. Hier bietet der Leit-
eBook von Zolar „Eigenen Solarstrom erzeugen“ (43), welches sich zusätzlich steuer- faden Wärmepumpe der Energieagentur NRW gute Anhaltspunkte (32), sowie vertie-
rechtlichen Fragestellungen und dem Eigenverbrauch widmet. fend die Simulationsstudie von Tjaden et al. 2015. Ebenfalls kann die Energiebera-
Tiefergehende Informationen kombiniert mit einfachen Formeln zur Auslegung fin- tung der Verbraucherzentrale NRW bzw. des Bundesverbands der Verbraucherzen-
den sich hingegen im „Schritt für Schritt“-Leitfaden der Firma Enerix (15) und beim tralen informieren.
„Solaranlagen Ratgeber“ von Anondi (39). Der Solaranlagenratgeber ist sehr Es gibt ebenfalls eine ganze Reihe von Online-Werkzeugen, die von der optimalen
umfangreich, bietet aber zusätzlich nach jedem Kapitel eine Checkliste, um zentrale Ausnutzung der Dachfläche mit Solarmodulen über die Auslegung der Wechselrich-
Punkte herauszustellen. ter bis hin zur Wirtschaftlichkeitsberechnung weitreichende Unterstützung bereit-
halten (49-59).
Zurück zum Inhaltsverzeichnis2.3 – Mehrfamilienhäuser –6–
2.3 Mehrfamilienhäuser
Im urbanen Raum ist das Mehrfamilienhaus von großer Bedeutung für die Solarener- Die DGS Franken (23) hat bis 2018 Konzepte und vertragliche Muster zur Selbstver-
gie. bspw. entfallen ca. 40 % des Berliner Solarpotenzials auf Mehrfamilienhäuser. sorgung und Belieferung mit Strom und Wärme aus Sonnenenergie auch in Kombina-
Zahlreiche rechtliche Fallstricke machen eine einfache Umsetzung jedoch komple- tion mit Speichern und weiteren Erzeugungsanlagen in unmittelbarer räumlicher
xer. Nähe erarbeitet. Die umfangreiche Handreichung hilft dabei, für unterschiedliche
Leitfäden für diesen Gebäudetyp sind daher bereits vielschichtiger. Einen Einstieg Anforderungen den richtigen Vertrag zu finden. Die Vertragsmuster werden stets
bieten Informationsbroschüren bspw. von Polarstern (9), Naturstrom (8), KlimaGEN aktualisiert und sind somit auch für das EEG 2021 gültig.
(19) oder auch das Projekt Sonne Teilen (61). Die Energieagentur Rheinlandpfalz hat Etwas spezieller auf Zählermodelle und Geschäftsprozesse fokussiert, aber dennoch
zusammen mit dem Büro für Energiewirtschaft und technische Planung (BET) ver- als Einstieg geeignet, ist der Leitfaden Mieterstrom des Solarclusters Baden-Würt-
schiedene Vermarktungsmöglichkeiten für PV-Strom dargestellt (27). Im Fokus der temberg (31). Dem gleichen Cluster kann auch ein Schritt-für-Schritt-Leitfaden für
Untersuchung stehen unter anderem Mehrfamilienhäuser und Quartiere. Zu jedem Balkon-Module „MACH DEINEN BALKON SCHÖN!“ (6) zugeordnet werden.
Geschäftsmodell werden Checklisten angeboten. Da die Mieterstromlieferung bereits tief in der Materie des Energierechts eintaucht,
Ist das Gebäude im Besitz einer Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG), führt der kann auch eine rechtliche Einordnung zu den sich ergebenden Aufgaben und Pflich-
übersichtliche Leitfaden „Solar-WEG: Schritt für Schritt“ der Energieagentur Regio ten zielführend sein. Einen tabellarischen Überblick liefern Nümann und Siebert auf
Freiburg (1) gut an das Thema heran und zeigt verschiedene Möglichkeiten zum eeg-info.de (7) genauso wie eine Einschätzung zur Abgrenzung von Eigenverbrauch
Betrieb der PV-Anlage auf. und Direktstromlieferung (30). Etwas spezieller aber durchaus verallgemeinerbar
Soll ein wirklich umfassender Eindruck gewonnen werden, können die Publikationen haben die Rechtsanwälte von Bredow, Valentin und Herz im Auftrag der Verbrau-
„Geschäftsmodelle mit PV-Mieterstrom“ (34), der kostenpflichtige Leitfaden „Mie- cherzentrale Nordrhein-Westfalen ein Gutachten zum kleinen Mieterstrom formu-
terstrom in der Praxis“ (24) des BSW oder aber der „Leitfaden Mieterstrom“ (17) aus liert (21). Es hilft zu verstehen, welche Anforderungen an Mieterstrom und gemein-
dem Winner-Projekt zu Rate gezogen werden. schaftlichen Eigenverbrauch gestellt werden.
Zurück zum Inhaltsverzeichnis2.4 – Gewerbe –7–
2.4 Gewerbe
PV-Anlagen auf Gewerbegebäuden sind meist größer als auf Wohnhäusern. In Berlin Soll die PV-Anlage ebenfalls mit Elektromobilität oder einem Speicher betrieben
haben gewerblich genutzte Gebäude ein Solarpotenzial von etwa 2,5 GW und werden, ermöglicht die Veröffentlichung “Photovoltaik und Elektromobilität sinnvoll
machen damit etwa ein Drittel des gesamten Solarpotenzials aus 2. kombinieren - Ein Leitfaden für Gewerbebetriebe in Deutschland“ (11) des For-
Die Gewerbeimmobilien sind in den Leitfäden eindeutig unterrepräsentiert. Der schungsprojekts PV4Grid eine gute Orientierung. Ebenfalls andiskutiert werden hier
Grund hierfür kann in den individuellen Ausgangsbedingungen der Gebäude gefun- die Möglichkeiten der Reduzierung von Lastspitzen und damit der Ausgaben auf-
den werden. Die Höhe des Energiebedarfs und auch die spezifische Form des Last- grund des Leistungspreises. Dieses und weitere Geschäftsmodelle sind mit einem
profils kann von einzelnen Maschinen oder Prozessen geprägt sein, sodass diese Industrie- und Gewerbespeicher denkbar, wie ihn denersol und DGS in ihrem
nicht einfach auf andere Betriebe übertragbar sind. Zusätzlich unterscheidet sich die gemeinsamen Leitfaden unter die Lupe nehmen (25).
Höhe des Strompreises zum Teil deutlich von Haushalten.
Aufgrund der Komplexität sind die Leitfäden auch bereits auf spezielle Fragestellun-
gen zugeschnitten. Einen breiten Überblick bietet der Handelsverband Deutschland
und zeigt anhand von acht Schritten den Weg zur PV-Anlage auf (20).
Auch der Leitfaden „Eigenverbrauch – Industrie und Gewerbe“ der Solarpraxis
GmbH (46) ermöglicht ebenfalls einen Einstieg. Besonders empfehlenswert ist hier
der Schnelltest am Anfang des Dokuments. Die kontinuierlichen Änderungen im
Energierecht sorgen jedoch dafür, dass das Kapitel zur Wirtschaftlichkeit nicht mehr
aktuell ist.
Da die Wirtschaftlichkeit einer PV-Anlage eng mit der Frage des Eigenverbrauchs
und der Direktstromlieferung verknüpft ist, gibt es hierzu zahlreiche Einordnungen.
Die Bundesnetzagentur hat mit ihrem „Leitfaden Eigenversorgung“ (35) ihre Auffas-
sung dargelegt, wann Eigenversorgung möglich ist und wann es sich um eine Strom-
lieferung handelt. Die Stromlieferung muss dabei stets von der privilegierten Eigen-
versorgung abgegrenzt werden.
Der Bundesverband Solarwirtschaft und die Industrie- und Handelskammer wagen
mit „Eigenerzeugung, Eigenversorgung, Mieterstrom und Stromdirektlieferung“ (18)
eine Übersetzung in die Praxis. Darüber hinaus zeigen sie mit „Weiterleitung von
Strom auf dem Betriebsgelände“ (5), wo die Fallstricke der Auslegung der Bundes-
netzagentur liegen und mahnen zur Risikoabkehr eine enge Auslegung an.
2 Siehe Studie Das Berliner Solarpotenzial der HTW Berlin.
Zurück zum Inhaltsverzeichnis2.5 – Kommunale Gebäude –8–
2.5 Kommunale Gebäude
Ein weiterer Teil der Leitfäden richtet sich explizit an kommunale Akteure. Hierbei
sind durchaus große Flächen für Solarenergie verfügbar. Beispielsweise machen in
Berlin Gebäude, die der öffentlichen Daseinsvorsorge dienen (in öffentlicher als auch
privater Trägerschaft), etwa 15 % des Berliner Solarpotenzials aus3. Somit ist ihr
Anteil größer als der der ca. 130.000 Ein- und Zweifamilienhäuser Berlins zusammen.
Aber nicht nur die eigenen Dachflächen können durch kommunale Planung adres-
siert werden.
Das Solarcluster Baden-Württemberg (3) hat hierzu einen politischen Handlungsleit-
faden veröffentlicht, der von den Rahmenbedingungen bis zu Umsetzungsempfeh-
lungen reicht. Ebenso aus Baden-Württemberg stammt das Faktenblatt zu Solar-
parks und der umfangreiche, 2019 erschienene „Handlungsleitfaden für Freiflächen-
solaranlagen“ (10) des baden-württembergischen Umweltministeriums. Anregungen
möchte auch der „Leitfaden zur Zulassung von Photovoltaik-Freiflächen-Anlagen“
(47) mit einem 7-Schritte-Plan zur Zulassung geben.
Eine speziellere Anwendung ist die Installation von PV-Anlagen auf alten Deponien.
Das nordrhein-westfälische Umweltministerium gibt Empfehlungen in „Photovoltai-
kanlagen auf Deponien – technische und rechtliche Grundlagen“ ab (41).
Im urbanen Kontext sind die leistungsstarken PV-Freiflächenanlagen von geringer
Bedeutung, dafür können jedoch über Schulen, Schwimmbädern und Verwaltungs-
gebäuden beachtliche Flächen erschlossen werden.
Das Unabhängiges Institut für Umweltfragen (UFU) und die DGS haben hierzu einen
Leitfaden erstellt, der Initiativen an Schulen unterstützen soll (45). Die schnellen
Änderungen im Energierecht sorgen jedoch dafür, dass einige Aussagen hinsichtlich
ihrer Aktualität geprüft werden müssen.
Auch die Berliner Stadtwerke beschreiben in einem FAQ, wie man Schulen und
andere öffentliche Gebäude mit Solaranlagen erschließen kann und empfehlen hier
das sogenannte Pachtmodell (2).
3 Siehe Studie Das Berliner Solarpotenzial der HTW Berlin.
Zurück zum Inhaltsverzeichnis2.6 – Quellenverweise –9–
2.6 Quellenverweise
Tabelle 1: Leitfäden und weitere Literaturverweise (sortiert nach dem Erscheinungsjahr).
Nr. Titel Hrsg. Jahr Nr. Titel Hrsg. Jahr
Leitfäden und Fachbeiträge 14 Solarstrom und Batteriespeicher - Planung und Kauf Verbraucher- 2019
einer Photovoltaikanlage zentrale NRW
1 Solar-WEG: Schritt für Schritt Energieagentur 2020
Regio Freiburg 15 Schritt für Schritt zur eigenen Photovoltaikanlage Enerix 2019
2 Berlin - Auf dem Weg zur solaren Stadt Berliner 2020 16 Leitfaden Solare Prozesswärme Universität 2019
Stadtwerke Kassel
3 Photovoltaik in den Kommunen Solarcluster BW 2020 17 Leitfaden Mieterstrom für die Wohnungswirtschaft Projekt WIN- 2019
NER
4 PV Steuerupdate DGS 2020
18 Eigenerzeugung, Eigenversorgung, Mieterstrom und BSW und DIHK 2018
5 Weiterleitung von Strom auf dem Betriebsgelände DIHK 2019
Stromdirektlieferung
6 Mach Deinen Balkon schön! Smart Grids BW 2019
19 Ratgeber Mieterstrom KlimaGEN 2018
7 Melde- und Informationspflichten bei Nümann und 2019
20 Die eigene Photovoltaikanlage HDE 2018
Eigenversorgung und bei Stromlieferung vor Ort Siebert
21 Rechtsgutachten „Kleiner Mieterstrom“ und von Bredow, 2018
8 Leitfaden „Gemeinsame Sache: Solar aufs Dach“ Naturstrom 2019
gemeinschaftliche Eigenversorgung Valentin und
9 Wirklich Mieterstrom! Polarstern 2019 Herz
10 Freiflächensolaranlagen Handlungsleitfaden MUKE BW 2019 22 Planungsleitfaden SMA SMART HOME SMA 2018
11 Photovoltaik und Elektromobilität sinnvoll PV4Grid 2019 23 Neue Chancen für die Photovoltaik durch DGS Franken 2018
kombinieren. Ein Leitfaden für Gewerbebetriebe in Versorgung vor Ort
Deutschland 24 Mieterstrom in der Praxis BSW 2018
12 Solarparks – Fakten für Interessierte, Planer und Solarcluster BW 2019 25 Leitfaden für Industrie- und Gewerbespeicher denersol 2018
Kommunen
13 Leitfaden zur Implementierung intelligenter Uni Stuttgart 2019
Fortsetzung der Tabelle auf der folgenden Seite.
Energiesysteme in Wohnquartieren
Zurück zum Inhaltsverzeichnis2.6 – Quellenverweise – 10 –
Nr. Titel Hrsg. Jahr 42 Investorenleitfaden Photovoltaik BSW 2014
26 Leitfaden Photovoltaik Energieagentur 2018 43 Eigenen Solarstrom erzeugen Zolar 2014
NRW
44 Wirtschaftlichkeit von gewerblichen REC Solar 2013
27 Attraktive Geschäftsmodelle mit PV-Anlagen Energieagentur 2017 Eigenverbrauchsanlagen in Deutschland
Rheinland-Pfalz
45 Solarsupport – Ein Leitfaden Solaranlagen auf die UFU und DGS 2012
28 „Dein Dach kann mehr“ Stadt Freiburg 2017 Schulen!
29 PV-Steuern solaranlagen- 2017 46 Leitfaden Eigenverbrauch – Industrie und Gewerbe Solarpraxis 2011
portal.de
47 Leitfaden zur Zulassung von PV-Freiflächen-Anlagen ABSI 2011
30 EEG-Umlage auf Eigenverbrauch Nümann und 2017
48 Gewerblicher Eigenverbrauch von Solarstrom SMA 2010
Siebert (RA)
31 Leitfaden Mieterstrom Solarcluster BW 2017
Fortsetzung der Tabelle auf der folgenden Seite.
32 Leitfaden Wärmepumpe - Kombination von Energieagentur 2017
Wärmepumpe und Photovoltaik NRW
33 Einspeisevergütung durch das EEG ZOLAR 2017
34 Geschäftsmodelle mit PV-Mieterstrom BSW 2016
35 Leitfaden zur Eigenversorgung Bundesnetz- 2016
agentur
36 Photovoltaik für Privathaushalte Verbraucher- 2016
→ Link zur aktualisierten Fassung (2019) zentrale RP
37 9 Schritte zum Mieterstrom pv magazine 2016
38 Stromkosten reduzieren durch gewerblichen WINAICO 2015
Eigenverbrauch
39 Solaranlage Ratgeber ANONDI 2015
40 Update: Steuertipps für Photovoltaikbetreiber DGS 2015
41 Photovoltaikanlagen auf Deponien MKULNV NRW 2014
Zurück zum Inhaltsverzeichnis2.6 – Quellenverweise – 11 –
Nr. Titel Hrsg. Jahr Nr. Titel Hrsg. Jahr
Online-Werkzeuge Allgemeine Informationen, Webseiten
49 Stromrechner IBC Solar 60 Aktuelle Fakten zur Photovoltaik in Deutschland, Fraunhofer ISE 2020
Webseite
50 PV Rechner Energieagentur NRW
61 Sonne teilen BSW Solar
51 PV*SOL Online Valentin Software
62 pv-magazine, Rubrik Steuertipps pv magazine 2020
52 Prokon Prokon eG
53 Sunny Design SMA
Nr. Titel Hrsg. Jahr
54 Solar Planit BayWa r.e.
Weitere unberücksichtigte Leitfäden
55 Lorenz pro Tool Montagesysteme Lorenz
Leitfaden Photovoltaik Sächsische 2021
Energieagentur
56 Fronius Solar Configurator Fronius International GmbH
Photovoltaik-Nutzung in der Landwirtschaft Photovltaic 2020
57 Fronius Solarsimulator Fronius International GmbH
Austria
58 KACO String Sizing Tool KACO new energy
Aggri Photovoltaik: Chance für die Landwirtschaft Fraunhofer ISE 2020
59 Unabhängigkeitsrechner HTW Berlin und Energiewende
Steuertipps zur Energieerzeugung Finanzministe- 2020
rium Ba.-Wü.
Photovoltaikanlagen (Sicherheitsleitfaden) Gesamtverband 2017
der dt Versiche-
rungswirtschaft
PV Brandsicherheit (Abschlussbericht) TÜV Rheinland 2015
Zurück zum Inhaltsverzeichnis3 – Leitfragen für eine Solarstromversorgung – 12 –
3 Leitfragen für eine Solarstromversorgung
3.1 Überblick
Im Vorangegangene Kapitel wurden verschiedene Leitfäden skizziert. Als verbinden- nung erörtert werden. Zudem kann der Gebäude- bzw. Dachzustand mögliche Über-
des Element wurden Fragen wie im Initialfragebogen der Initiative „Dein Dach kann raschungen bei der Planung der PV-Anlage mit sich bringen.
mehr“ identifiziert. In diesem Kapitel werden die Leitfragen erörtert, anhand derer Im zweiten Frageteil geht es um die Höhe des zu deckenden Stromverbrauchs.
eine Wirtschaftlichkeitsprüfung erfolgen kann.
Im dritten Teil wird das Geschäftsmodell für diese Versorgung festgelegt, da dieses
die Wirtschaftlichkeit der PV-Anlage bestimmt.
Im ersten Fragenteil soll sich dem Dach und dem Gebäude gewidmet werden. Ent- Im vierten Teil wird die mögliche Stromerzeugung und der Direktverbrauch energe-
scheidend können z. B. die Eigentumsverhältnisse des Gebäudes sein. Grundsätzlich tisch quantifiziert.
ist die Verfügung über das Dach zu klären. Daneben muss auch die technische Eig-
Letztlich werden im fünften Teil die rein wirtschaftlichen Parameter abgefragt.
3.2 Dach und Gebäude
Wie viel Dachfläche steht zur Verfügung? weise wenn der Strom direkt vor Ort verbraucht wird und Erzeugung und Verbrauch
Die spezifischen Kosten, also die Kosten pro Leistungseinheit (€/kW), für PV-Anlagen zeitlich besser zusammenpassen. Näheres dazu in Abschnitt 3.3.
reduzieren sich deutlich mit der Anzahl der Module und damit mit der installierten Wie groß ist die Dachfläche?
PV-Leistung. Aus diesem Grund ist es ökonomisch sinnvoll, möglichst große Flächen Die verfügbare Dachfläche ist entscheidend für die potenzielle PV-Anlagenleistung.
zu belegen. Auch die Belegung mehrerer kleinerer Flächen kann eine Reduktion der Heutige Module (2020) können eine Leistung von 300 W oder mehr bei einer Fläche
Kosten herbeiführen. von etwa 1,6 m² haben.
Sind Sie Eigentümer_in der Dachfläche? Online-Tools ermöglichen eine schnelle Abschätzung, wie viele Module auf Ihrem
Nur wer das Eigentum am Dach hat, entscheidet, was damit geschieht. Daher ist es Dach platziert werden können4. Eine Faustformel zur Abschätzung ist:
notwendig, entweder selbst über das Dach zu verfügen oder die Entscheidung
PV-Leistung in kW = Dachfläche in m² * 0,16 (1)
beeinflussen zu können, bspw. wenn Sie Gewerbe- oder Wohnungsmieter_in sind.
Das entspricht der Verwendung von PV-Modulen mit 300 W auf 85 % der Dachflä-
Wie ist die Dachfläche ausgerichtet und geneigt?
che.
Der Ertrag einer PV-Anlage ist von ihrer Ausrichtung und Neigung abhängig. In den
deutschen Breitengraden hat eine nach Süden ausgerichtete und um 30° bis 35°
geneigte PV-Anlage den höchsten Stromertrag. Abweichende Ausrichtungen und
Neigungen können dennoch einen wirtschaftlichen Betrieb ermöglichen. Beispiels-
4 Beispielsweise (bspw.): K2, IBC oder Prokon.
Zurück zum Inhaltsverzeichnis3.2 – Dach und Gebäude – 13 –
Gibt es Objekte, die Schatten auf die Dachfläche werfen? Steht ihr Gebäude unter Denkmalschutz?
Bei einer direkten Verschattung reduziert sich die Leistung des betroffenen PV- Technische Systeme wie PV-Anlagen verändern das äußere Erscheinungsbild von
Moduls drastisch. Wird dies nicht in der PV-Anlagenplanung berücksichtigt, kann Gebäuden. Stehen diese unter Denkmalschutz, ist für die PV-Anlage eine Genehmi-
auch der PV-Ertrag der anderen PV-Module beeinträchtigt werden. gung einzuholen. Da jedes Denkmal individuell betrachtet wird, können an dieser
Als Daumenwert gilt: Die Fläche sollte zwischen März und September zwischen Stelle nur allgemeine Hinweise gegeben werden:
10:00 Uhr und 14:00 Uhr unverschattet bleiben. Eine genaue Prüfung kann durch die 1. Einsehbarkeit prüfen: Ist die PV-Anlage aus dem öffentlichen Raum einsehbar?
Anlagenplanerin oder den Anlagenplaner durchgeführt werden. Kann dies ggf. durch eine andere Aufständerung oder einen größeren Randab-
stand verhindert werden?
Muss das Dach in den nächsten 20 Jahren saniert werden?
Um Synergien bei den Installationskosten zu nutzen und ggf. eine aufwändige 2. Vorabzeichnung: Eine Skizze des Gebäudes oder gar eine Illustration erleichtert
Demontage zu vermeiden, sollten Sie die Sanierung Ihres Dachs mit der Installation die Diskussion über eine mögliche ästhetische Beeinträchtigung.
der PV-Anlage abstimmen. 3. Gespräch suchen: Noch vor der Antragseinreichung sollte mit der untere Denk-
malschutzbehörde Kontakt aufgenommen werden. Hierbei sollte auch die
Kann das Dach die zusätzliche Last einer PV-Anlage tragen?
schadlose Montage am Denkmal kommuniziert werden.
Die Statik eines Dachs muss die zusätzliche Last einer Photovoltaikanlage tragen
können. Auf Schrägdächern stellt dies in der Regel kein Problem dar. Auf Flach- Gibt es eine Asbestbelastung?
dächern ist gemäß Planungsleitfaden der Berliner Stadtwerke eine zusätzliche Last Asbest-Staub schädigt die Lunge und kann Krebs verursachen. Daher wird der Bau-
von 20 kg/m² bis 30 kg/m² zu berücksichtigen. stoff heute nicht mehr verwendet. In der Regel führt erst die Bearbeitung zu einer
Welche Dachhaut liegt vor? Belastung, aber auch Abrieb sorgt für einen steten Asbesteintrag in die Umwelt. Ist
Diese Frage bezieht sich neben den Befestigungsmöglichkeiten auf dem Dach auch eine Dacheindeckung aus Asbest vorhanden, sollte eine Sanierung bei der Gelegen-
auf eine potenzielle Erneuerung innerhalb der Betriebszeit. Ziegel- und Kalzipdächer heit der PV-Installation in Betracht gezogen werden. In Tabelle 2 sind Größenord-
ermöglichen eine einfache Befestigung mit Dachhaken bzw. Kalzipklemmen. Für nungen für die entstehenden Kosten angegeben.
andere Flachdachbeläge ist eine Beschwerung oder Klebung der Unterkonstruktion
vorzusehen.
Tabelle 2: Kosten für eine Asbest-Sanierung (nach Energieheld.de).
Wie hoch ist das Gebäude?
Asbestsanierung Kosten (Fachbetrieb)
Ab einer Arbeitshöhe von 3 m müssen Arbeiten gegen Absturz gesichert werden. Auf
Flachdächern kann dies durch einen ausreichend großen Randabstand und soge- Asbest entfernen lassen (mit Entsorgung) 30 €/m² bis 60 €/m²
nannte Sekuranten gewährleistet werden. Bei Schrägdächern ist ein Gerüst erforder-
lich., dessen Kosten etwa 5 €/m² bis 12 €/m² betragen. Neue Dämmung anbringen anlassen 50 €/m² bis 80 €/m²
Dach komplett erneuern (mit Asbest-Sanierung) 200 €/m² bis 300 €/m²
Zurück zum Inhaltsverzeichnis3.3 – Stromerzeugung – 14 –
3.3 Stromerzeugung
Welchen Ertrag können Sie erwarten?
Um eine grundlegende Abschätzung des erwartbaren Ertrages zu erlangen, kann auf
die in der Abbildung 2 dargestellten Werte zurückgegriffen werden. Es handelt es
sich um den Mittelwert der an das Portal pv-ertraege.de gemeldeten spezifischen
Erträge in Kilowattstunden je installiertem Kilowatt PV-Leistung. Der Wert kann mit
der PV-Leistung multipliziert werden und ergibt so den erwarteten Jahresertrag.
Für eine genauere Abschätzung sind folgende Informationen erforderlich:
• Ausrichtung und Neigung des Dachs bzw. der PV-Module
• Jährliche Einstrahlung auf der PV-Modulfläche (standortabhängig)
• Wirkungsgrad der PV-Module bzw. des gesamten PV-Systems
In Abhängigkeit der Ausrichtung des Dachs bzw. der Aufständerung der Module
ändert sich zum einen der Verlauf der Erzeugung (Abbildung 3) und zum anderen die
Menge des Stromertrags (Abbildung 4).
Der Ertragsverlauf von PV-Anlagen, die nicht nach Süden ausgerichtet sind, ent-
spricht häufig besser dem Verlauf des Stromverbrauchs und wird deshalb heute ins-
besondere bei flachen Dächern angestrebt (Ost-West-Aufständerung). Es wird häu-
fig eine Aufständerung mit einer flachen Neigung von unter 15° genutz, um die
Angriffsfläche für den Wind zu reduzieren. Die Mindererträge können im Vergleich zu
30° nach Süden aufgestellten PV-Anlagen werden durch die bessere Ausnutzung der
Dachfläche und die häufigere Gleichzeitigkeit von Erzeugung und Verbrauch kom-
pensiert.
Da der Wirkungsgrad einer PV-Anlage aber unter anderem auch von der jeweils
aktuellen Umgebungstemperatur abhängig ist, gehören detaillierte Ertragssimulati-
onen mittlerweile zum Standard bei Angeboten für PV-Anlagen (vgl. Literaturhin-
Abbildung 2: Mittlerer PV-Ertrag der gemeldeten PV-Anlagen in kWh/kW 2010 bis 2020. Datenquel-
weise auf Seite 10). Zudem können bei der Berechnung über mehrere Jahre auch
le: Solarenergie-Förderverein Deutschland e.V.
Schwankungen in der jährlichen Einstrahlung berücksichtigt werden. Diese können
im Bereich von 10 % im Vergleich zum langjährigen Mittel liegen. Die Auswirkungen
des Klimawandels führen sehr wahrscheinlich künftig zu etwas höheren Erträgen.
Zurück zum Inhaltsverzeichnis3.3 – Stromerzeugung – 15 –
Abbildung 3: Schematische Darstellung verschiedener Ausrichtungen der PV-Anlage und der resul-
tierenden Erzeugungsprofile. Die geringere Maximalleistung der Solaranlage bei nicht nach Süden
ausgerichteten PV-Anlagen ermöglicht den Einsatz kleinerer Wechselrichter. Quelle: Photobucket / Abbildung 4: Einstrahlung der PV-Anlage bezogen auf die Einstrahlung auf die Horizontale. Quelle:
HaraldLaible. Volker Quaschning – 2019 – Regenerative Energiesysteme.
Zurück zum Inhaltsverzeichnis3.4 – Stromverbrauch und Direktverbrauch – 16 –
3.4 Stromverbrauch und Direktverbrauch
Die Wirtschaftlichkeit von PV-Systemen ist eng mit dem Stromverbrauch im elektrische Energie umgestellt wird. Auch die Umstellung auf Elektromobilität kann
Gebäude verknüpft. Der lokal verbrauchte PV-Strom kann teuren Netzstrom erset- sich positiv auf die Wirtschaftlichkeit der PV-Anlage auswirken. Maßnahmen, die
zen und somit Kosten einsparen. Voraussetzung ist jedoch die Zeitgleichheit von Strom einsparen, wirken sich dahingehend dämpfend auf den wirtschaftlichen Erfolg
Erzeugung und Verbrauch. der PV-Anlage aus. Hier zeigen sich die Grenzen einer rein wirtschaftlichen Betrach-
tungsweise der Energieversorgung, da ein verringerter Strombezug dennoch ökolo-
Wie hoch ist der Stromverbrauch?
gisch sinnvoll ist.
Neben der zeitlichen Charakteristik des Stromverbrauchs ist auch die absolute Höhe
(Jahresstromverbrauch) für den Direktstromverbrauch von Relevanz und damit für Welchen Anteil der PV-Energie können Sie lokal nutzen?
die Refinanzierung. Abhängig davon, welche Stromverbräuche über das gewählte Geschäftsmodell ver-
sorgt werden, variiert die Menge des im Gebäude direkt verbrauchten Solarstroms.
Wird ein Leistungspreis gezahlt?
Dieser Wert ist für die Refinanzierung der PV-Anlage entscheidend. Er lässt sich
Haushalte und Gewerbebetriebe mit weniger als 100.000 kWh Jahresstromver-
ohne exakte Kenntnis des (künftigen) Stromverbrauchs nicht genau bestimmen.
brauch zahlen ein pauschales Netzentgelt in Form einer Grundgebühr.
Daher muss entweder eine Abschätzung anhand von Erfahrungswerten oder eine
Ab 100.000 kWh pro Jahr ist eine registrierende Leistungsmessung erforderlich und
genaue Simulationsrechnung durchgeführt werden. Ein Online-Tool für den Anwen-
in der Regel wird ein Leistungspreis anstelle einer Grundgebühr gezahlt. Der Leis-
dungsbereich der Ein- und Zweifamilienhäuser (EFH) findet sich in der Literatur-
tungspreis berechnet sich unter anderem nach der höchsten Leistung in kW im
sammlung (59). In diesem Abschnitt wird eine Abschätzung für EFH ermöglicht.
Abrechnungszeitraum am Netzanschlusspunkt. Wenn ein Leistungspreis gezahlt
Andere Gebäudetypen und Nutzungen finden sich im Anhang im Kapitel 6.1 Bestim-
wird, bietet ein Speicher mit einer PV-Anlage die Möglichkeit, kurz auftretende Last-
mung des Direktverbrauchs .
spitzen sinnvoll zu reduzieren und somit die Kosten für den Leistungspreis zu min-
dern.
Der Direktverbrauch ( Epv2l ) ist die Energie, die lokal zur direkten Deckung der Last
Wer verbraucht den Strom?
genutzt werden kann. Es ist also die Energie der PV-Anlage ( Epv ), die nicht in das
Für die Bewertung der möglichen Geschäftsmodelle ist es wichtig, zu differenzieren,
Netz eingespeist wird ( Epv2g ). Ist kein Speicher vorhanden, entspricht der Direkt-
wer im Gebäude den Strom verbraucht. Kann der bzw. die Stromverbraucher_in auch
verbrauch dem eingesparten Netzbezug:
PV-Anlagenbetreiber_in sein? Kann dies durch Miet- oder Pachtverträge erzielt wer-
den? Näheres zu Geschäftsmodellen finden sich im Kapitel 3.5 Geschäftsmodell und E pv2l=E pv −E pv2g (2)
Aufwand. Wird der Direktverbrauch auf die erzeugte PV-Energie bezogen, ergibt dies den
Könnte sich der Stromverbrauch in den nächsten Jahren ändern? Eigenverbrauchsanteil ( e ):
Ist in den kommenden Jahren eine Investition geplant, die sich auf den Stromver- E pv2l
e= (3)
brauch auswirkt, sollte dies berücksichtigt werden. Der elektrische Energiever- E pv
brauch ändert sich signifikant, wenn die Heizung und Kühlung bspw. von Gas auf
Zurück zum Inhaltsverzeichnis3.4 – Stromverbrauch und Direktverbrauch – 17 –
Um den Direktverbrauch unterschiedlicher Konstellationen von Erzeugung und Ver-
brauch miteinander zu vergleichen, kann die installierte PV-Leistung ( P pv,r ) auf den
Stromverbrauch ( El ) des Gebäudes bezogen werden. Es ergibt sich also ein Ver-
hältnis von Leistung zu Energie in kW/MWh:
P pv ,r
f=
( ) El
(4)
Wird in einer Simulationsrechnung die PV-Anlagengröße variiert, ändert sich dieser
Quotient entsprechend. Wird nun für jede dieser Simulationen auch der Eigenver-
brauchsanteil (in Prozent) bestimmt, ergibt sich eine Kennlinie, wie sie anhand eines
Beispiels in Abbildung 5 dargestellt ist.
Abbildung 5: Schematischer Zusammenhang von Eigenverbrauch und PV-Leistung bei unterschied-
lich hohem Stromverbrauch bzw. unterschiedlich hoher PV-Erzeugung.
Daraus lässt sich nun für ähnliche Verbrauchsverhalten eine Gleichung herleiten, mit Soll die PV-Anlage mit 10 kW die doppelte Leistung liefern, so ist die auf den Ver-
der der Eigenverbrauchsanteil rechnerisch abgeschätzt werden kann. brauch bezogene PV-Leistung 2 kW/MWh. Die zusätzliche PV-Energie führt zu einem
Der geschätzte Eigenverbrauchsanteil efit für EFH lässt sich wie folgt bestimmen: höheren Direktverbrauch von 1.900 kWh sowie zu einer höheren Überschusseinspei-
sung. Insgesamt ändert sich dadurch das Verhältnis von Direktverbrauch zu PV-Er-
P pv ,r −0.55
zeugung: Der Eigenverbrauchsanteil sinkt (graue Pfeile), während der Ertrag der PV-
efit =0,3⋅
( ) El
(5)
Anlage steigt.
Für andere denkbare PV-Leistungen wurden der Direktverbrauch und der Eigenver-
Beispiel aus Abbildung 5: Hat ein Haushalt einen Jahresstromverbrauch von
brauchsanteil ebenfalls ermittelt (grüne Linie). So kann der für die Wirtschaftlich-
5.000 kWh (5 MWh) und soll eine PV-Anlage mit 5 kW installiert werden, so liegt die
keitsberechnung interessante Wert des Eigenverbrauchsanteils auch für andere PV-
auf den Verbrauch bezogene PV-Leistung bei 1 kW/MWh. Es ergibt sich anhand der
Leistungen abgelesen werden. Die Kurve kann zur Formel (5) idealisiert werden. So
PV-Erzeugung und des Verbrauchsverhaltens ein Direktverbrauch von etwa
kann nun für ähnlich geformte Verbrauchsprofile der mögliche Eigenverbrauchsan-
1.500 kWh. Der Eigenverbrauchsanteil beträgt damit 30 % der PV-Energie (schwarze
teil abgeschätzt werden.
Pfeile).
Zurück zum Inhaltsverzeichnis3.5 – Geschäftsmodell und Aufwand – 18 –
3.5 Geschäftsmodell und Aufwand
Einen bedeutenden Einfluss auf die Wirtschaftlichkeit kann das Geschäftsmodell Die Einspeisung ist das oben beschriebene Modell der Volleinspeisung. Gleichzeitig
haben, mit dem die PV-Anlage betrieben wird. Das hochgradig regulierte Energie- greift es auch für überschüssige Strommengen, die nicht lokal genutzt werden
recht hält hier verschiedene Möglichkeiten und Einschränkungen bereit. Für aus- konnten. Es kann ggf. die entstehenden Kosten nicht vollständig decken.
führliche Informationen sei auf die oben genannten Leitfäden verwiesen. Am Ende
dieses Kapitels fasst die Abbildung 8 die zur Ermittlung des geeigneten Geschäfts-
modells wesentlichen Entscheidungen in einem Fragenbaum zusammen.
Soll der PV-Strom lokal genutzt werden?
Bei der Volleinspeisung wird der gesamte Solarstrom ins öffentliche Netz abgege-
ben. Je nach Größe der PV-Anlage kann dafür die für 20 Jahre gleichbleibende Ein-
speisevergütung bezogen werden oder der Strom wird über ein Dienstleistungs-
unternehmen an der Strombörse angeboten (Direktvermarktung). Ein eventuell vor-
handener Stromverbrauch auf dem Gelände wird weiterhin vollständig über das Netz
gedeckt.
Wenn der Strom auf dem selben Grundstück auch direkt verbraucht werden soll,
kommen andere Geschäftsmodelle infrage. Begünstigt ist im EEG eine Stromproduk-
tion auf, im oder am selben Gebäude und im „unmittelbaren räumlichen Zusammen-
hang“. In der Regel ist hierbei das gleiche Grundstück oder Quartier gemeint, wenn
es nicht bspw. durch eine Straße oder einen Fluss durchtrennt ist. Wird das öffentli-
Abbildung 6: Darstellung zum Aufwand verschiedener Geschäftsmodelle und wirtschaftliche At-
che Stromnetz benötigt, handelt es sich um eine „normale“ Stromlieferung, bei der traktivität. (Quelle: BET und Energieagentur RP 2017).
zusätzliche Anforderungen gestellt werden. Diese wird hier nicht betrachtet.
Als die ökonomischste Option und diejenige mit dem geringsten Umsetzungsauf-
Welches EEG-Geschäftsmodell kommt für mich in Frage? wand ist die privilegierte Eigenversorgung anzusehen (als „Eigenverbrauch“ in der
Oft sind mehrere Optionen zum Betrieb einer PV-Anlage möglich. Abbildung 6 ver- Abbildung bezeichnet). Dabei gilt es zu beachten, dass der PV-Anlagenbetrieb und
anschaulicht die Priorisierung anhand der Wirtschaftlichkeit und des Umsetzungs- der Stromverbrauch durch die selbe juristische Person erfolgt („Personenidentität“).
aufwands. Die in der Abbildung genannten Quartierskonzepte 5 oder Systemdienst- Typische Fälle für Eigenversorgung nach der Auffassung der Bundesnetzagentur
leistungen werden aufgrund der Komplexität hier nicht betrachtet 6. sind in Tabelle 3 zusammengefasst7. Ähnlich attraktiv wie die Eigenversorgung,
jedoch mit einem höheren Aufwand verbunden, sind die sogenannten Miet- oder
Pachtmodelle. Sie stellen eine spezielle Art der Eigenversorgung dar, bei der ein
5 Im EEG 2021 wurde der Quartiersbegriff für Mieterstrom eingeführt. Eine zentrale Bedingung bleibt 7 An der Auslegung der Bundesnetzagentur gibt es juristische Bedenken (siehe 21). Diese gegen die
dennoch bestehen: Der Strom darf nicht durch das öffentliche Stromnetz geleitet werden. Netzbetreiberin bzw. den Netzbetreiber durchzusetzen ist jedoch mit einem Risiko verbunden und
6 Nähere Informationen können BET und Energieagentur RP 2017 ennommen werden. sollte vorab geprüft werden.
Zurück zum Inhaltsverzeichnis3.5 – Geschäftsmodell und Aufwand – 19 –
Dienstleistungsunternehmen die Investition übernimmt. Über einen Mietvertrag Wer soll investieren?
wird hierbei die gesamte PV-Anlage durch die bzw. den Stromverbraucher_in gemie- Gute Gründe, die Investition selbst in die Hand zu nehmen, sind:
tet8. Details finden sich im Leitfaden (23). • Es stehen zinsgünstige Kredite zur Verfügung (z. B. über die KfW oder die
Kann auch über das Miet- oder Pachtmodell keine Personenidentität aller Stromver- meisten Hausbanken),
braucher erzielt werden, bleiben verschiedene Optionen. Am Beispiel einer Woh- • die Einsparungen bei den vermiedenen Stromkosten kann dabei die Höhe
nungseigentümergemeinschaft (WEG) sind diese in Abbildung 31 beschrieben. der Tilgung übersteigen,
• die Investitionskosten sind überschaubar (vgl. Abbildung 9) und
Tabelle 3: Privilegierte Eigenversorgung nach der Bundesnetzagentur. • die Lebensdauer der PV-Anlage ist mit über 25 Jahren9 länger als z. B. die
Einspeisevergütung gezahlt wird.
Eigenversorgung Direktstromlieferung Dritter
• Einfamilienhaus (auch Familien und • Mieterstrom Ob Sie selbst investieren oder diese Rolle einem Dienstleistungsunternehmen über-
familienähnliche Konstellationen) • Gewerbebetrieb im Gewerbebetrieb lassen, steht Ihnen zumeist offen. In Abbildung 7 ist am Beispiel eines Mieterstrom-
• Gewerbe mit einer PV-Anlage (bspw. eigenständige Kantine in einem projekts dargestellt, welche Rolle das Dienstleistungsunternehmen übernehmen
• Öffentliche Gebäude Betrieb oder öffentlichen Einrichtung) kann. Hierbei geht es von der Planung über die Finanzierung, Installation und Moni-
(Verwaltung, Schule, Hochschule) • Gewerbehof oder Einkaufszentrum toring bis hin zum Kundenkontakt zu den Mieter_innen.
• Hotel und Krankenhäuser • Hausmeister_in auf dem Betriebsgelände
• Allgemeinstrom und Heizung bzw. • Fremdbetriebene Kaffee- und Snack-
Kühlung im Mehrfamilienhaus automaten
• Studierendenwohnheim oder Altenheim
In Mehrpersonenkonstellationen kommt meist keine Eigenversorgung in Frage. Als
zweite Option sollte daher die Direktstromlieferung an Dritte mit Solarstrom geprüft
werden (hier: „Direktlieferung“). Die Direktstromlieferung ist, durch die sich erge-
benden Verpflichtungen, mit größerem Aufwand verbunden. Die Aufgaben kann ggf.
ein spezialisiertes Dienstleistungsunternehmen übernehmen. Mieterstrommodelle
sind eine Sonderform der Direktstromlieferung für Wohngebäude, die im Allgemei-
nen mit einem Dienstleistungsunternehmen durchgeführt werden.
Abbildung 7: Schematische Darstellung zu den Rollen eines Dienstleistungsunternehmens in einem
Mieterstromprojekt. Quelle: Polarstern.
8 Die sogenannte Scheibenpacht, um als Eigenversorger zu gelten und EEG-Umlage zu sparen, ist nach 9 Zahlreiche Hersteller bieten Produkt und Leistungsgarantien über 25 Jahre an, so dass von einer län-
Auffassung der Bundesnetzagentur nicht zulässig. geren Lebensdauer prinzipiell ausgegangen werden kann.
Zurück zum Inhaltsverzeichnis3.5 – Geschäftsmodell und Aufwand – 20 –
Zusammenfassung: Geschäftsmodelle
In der nebenstehenden Abbildung 8 sind die wesentlichen Fragen zur Entschei- Ist das Dach
Können Sie die
nein Installation einer nein Keine PV-Anlage
dungsfindung anhand eines Fragenbaums dargestellt. Sie können mit Hilfe dieser Ihr Eigentum?
PV-Anlage herbeiführen?
ersten Orientierung das geeignete Geschäftsmodell herausfinden und damit in die
weitere Planung gehen. ja ja
Wenn sich herausstellen sollte, dass ein anderes Geschäftsmodell für den Anwen-
Wird auf dem Gelände
dungsfall günstiger erscheint, ist dies unproblematisch: An der PV-Anlage ändert
Strom verbraucht und soll
sich dadurch nichts und zumeist haben Sie bis dahin eine_n Kooperationspartner_in nein Volleinspeisung
durch Solarenergie
an der Hand, die oder der verschiedene Geschäftsmodelle mit Ihnen umsetzen kann. gedeckt werden?
Zusätzlich kann es auch eine Option sein, separate PV-Anlagen zu betreiben. So ja
könnte auf einem großen Gebäude eine PV-Anlage zur Eigenversorgung installiert
werden und eine weitere PV-Anlage, die die Mieteinheiten mittels eines Dienstleis- Wird dieser durch
nur eine (juristische) nein
tungsunternehmens mit Solarstrom versorgt.
Person verbraucht?
Option: Kann ein Dienstleistungs-
ja mehrere PV-Anlagen unternehmen die nein
separat betreiben PV-Anlage betreiben?
Kann die PV-Anlage ja
selbst betrieben und nein
finanziert werden?
Wird das Gebäude zu
Pachtmodell mindestens 40% zum nein
Wohnen genutzt?
ja
ja
Eigenversorgung „Mieterstrom“ Direktstromlieferung
Abbildung 8: Fragenbaum zur Ermittlung des geeigneten Geschäftsmodells.
Zurück zum Inhaltsverzeichnis3.6 – Ökonomische Eingangsparameter – 21 –
3.6 Ökonomische Eingangsparameter
Zur Rentabilität einer PV-Anlage reicht das Wissen um den Direktverbrauch nicht Wie hoch ist die Einspeisevergütung?
aus. Vielmehr müssen weitere ökonomische Parameter bekannt sein, wie System- Der Strom, der nicht direkt verbraucht werden kann, wird in der Regel eingespeist.
kosten, Strombezugspreis, Einspeisevergütung und Betriebskosten. Für die eingespeiste Energie gibt es nach EEG eine feste Vergütung oder eine an den
Marktpreis gekoppelte Ergänzungszahlung. Ebenfalls im EEG verankert ist eine
Wie hoch ist der Strompreis?
Absenkung der Vergütungshöhe, welche regelmäßig von der Bundesnetzagentur
Für eine langfristige Investition wie die in eine PV-Anlage müssen Annahmen zur
bekannt gegeben wird. In Tabelle 4 sind beispielhafte Zahlen zu finden. Näheres zur
Entwicklung des Strompreises getroffen werden. Die Strompreisentwicklung ist
Wirkung der stetigen Absenkung der Vergütung ist in der Deckelstudie der HTW
jedoch schwer vorherzusagen. Laut BDEW Strompreisanalyse liegt der mittlere
Berlin und im Positionspapier des BNE nachzulesen. Die Vergütung für eine
Strompreis für Haushalte10 2020 bei 31 ct/kWh, enthalten ist jedoch die Grundge-
bestimmte Leistung P pv , r kann mit der folgenden Formel 6 für PV-Anlagen kleiner
bühr. Großverbraucher_innen erhalten in der Regel einen reduzierten Tarif. Für
100 kW oder online bestimmt werden11.
Gewerbe ist dieser mit 18,55 ct/kWh daher etwas geringer. Der Blick in die Vergan-
p10⋅(min(10, Ppv ,r ))
genheit zeigt, dass sich der Haushaltsstrompreis in den vergangenen 20 Jahren um
+70 % erhöhte. Stieg er bis 2013 im Mittel um +4 % pro Jahr, blieb der Haushalts-
strompreis zwischen 2013 und 2018 mit +0,5 % pro Jahr nahezu konstant. Seit 2018
( )
cpv2g = + p40⋅(min(40, Ppv ,r )−min(10 ,P pv,r )) ⋅
+ p100⋅(min(100, Ppv ,r )−min(40 ,Ppv ,r ))
1
P pv,r (6)
bis 2020 steigt der Haushaltsstrompreis wieder mit 3 % pro Jahr. Der Industrie-
strompreis steigt im Mittel der letzten 20 Jahre mit knapp 4 % pro Jahr.
Tabelle 4: Vergütungssätze für PV-Anlagen C pv 2 g . Quelle: Bundesnetzagentur.
Wie sehr sich dieser Trend in die Zukunft projizieren lässt, ist ungewiss, da im Bun-
Wohngebäude, Lärmschutzwände und Sonstige
deskabinett bspw. eine Reduzierung der EEG-Umlage diskutiert wird und eine Gebäude nach § 48 Absatz 3 EEG Anlagen
Reform des Abgabe- und Umlagesystems bereits überfällig ist. Monat der bis 100 kW
bis 10 kW bis 40 kW bis 100 kW
Angesichts dieser Ungewissheit ist keine oder lediglich eine moderate Steigerung Inbetriebnahme
( p 10 ) ( p 40 ) ( p100 )
von ≤ 1 % eine plausible Annahme, die zu einem robusten Ergebnis führen sollte.
Januar 2021 8,16 ct/kWh 7,93 ct/kWh 6,22 ct/kWh 5,61 ct/kWh
Wie hoch ist die EEG-Umlage?
Auf solaren Eigenverbrauch ist die EEG-Umlage zu zahlen, und zwar:
• Zu 100 % bei Direktstromlieferung an Dritte Wie teuer ist die PV-Anlage?
Die Kosten für eine PV-Anlage werden zur besseren Vergleichbarkeit meist spezi-
• Zu 40 % bei Eigenversorgung
fisch in Euro pro Kilowatt installierter PV-Leistung angegeben. Abbildung 9 zeigt die
• Zu 0 % bei Eigenversorgung und einer PV-Leistung unter 30 kW
Kostenzusammensetzung der spezifischen Systempreise bei unterschiedlicher PV-
Die EEG-Umlage wird jährlich neu berechnet. Im Jahr 2021 beträgt sie 6,5 ct/kWh. Anlagenleistung. Die spezifischen Kosten für eine PV-Anlage sinken mit zunehmen-
Sie wird, mit Ausnahme der Privilegierungen, auf den Stromverbrauch abgeführt.
10 Bei einem jährlichen Stromverbrauch von 3.500 kWh. 11 Zum Beispiel (z. B.) unter https://www.interconnector.de/eeg-rechner/.
Zurück zum InhaltsverzeichnisSie können auch lesen