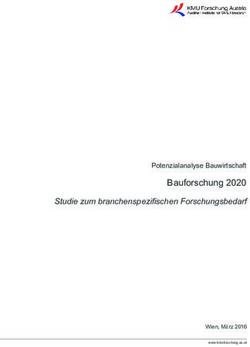Externe Evaluierung der Pädagogischen Hochschule Wien - PH Wien
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Externe Evaluierung der Pädagogischen Hochschule Wien Bericht der Expertinnen und Experten 04.05.2017
Inhaltsverzeichnis
1 Allgemeine Informationen zur externen Evaluierung .......................................... 3
1.1 Ziele und Methode der Evaluierung ................................................................... 3
1.2 Evaluierungsaspekte ....................................................................................... 4
1.3 Ablauf der Evaluierung .................................................................................... 4
2 Informationen zu Pädagogischen Hochschulen ................................................... 5
2.1 Hochschulsystem in Österreich – Pädagogische Hochschulen ................................ 5
2.2 Profil der Pädagogischen Hochschule Wien ......................................................... 7
3 Vorbemerkung der Expert/innen ........................................................................ 8
4 Evaluierungsaspekte .......................................................................................... 9
4.1 Aspekt 1 ....................................................................................................... 9
4.1.1 Feststellungen .................................................................................... 9
4.1.2 Analyse (enthält Stärken, Schwächen, Entwicklungspotentiale) .................10
4.1.3 Vorschläge und Empfehlungen für Verbesserungen ..................................10
4.2 Aspekt 2 ......................................................................................................12
4.2.1 Feststellungen ...................................................................................12
4.2.2 Analyse (enthält Stärken, Schwächen, Entwicklungspotentiale) .................15
4.2.3 Vorschläge und Empfehlungen für Verbesserungen ..................................16
4.3 Aspekt 3 ......................................................................................................17
4.3.1 Feststellungen ...................................................................................17
4.3.2 Analyse (enthält Stärken, Schwächen, Entwicklungspotentiale) .................19
4.3.3 Vorschläge und Empfehlungen für Verbesserungen ..................................21
4.4 Aspekt 4 ......................................................................................................23
4.4.1 Feststellungen ...................................................................................23
4.4.2 Analyse (enthält Stärken, Schwächen, Entwicklungspotentiale) .................24
4.4.3 Vorschläge und Empfehlungen für Verbesserungen ..................................26
4.5 Aspekt 5 ......................................................................................................27
4.5.1 Feststellungen ...................................................................................27
4.5.2 Analyse (enthält Stärken, Schwächen, Entwicklungspotentiale) .................29
4.5.3 Vorschläge und Empfehlungen für Verbesserungen ..................................30
5 Zusammenfassung ........................................................................................... 31
6 Anlagen ............................................................................................................ 33
6.1 Programm des Vor-Ort-Besuchs ......................................................................33
6.2 Hochschul-Evaluierungsverordnung .................................................................35
6.3 Glossar ........................................................................................................39
2/391 Allgemeine Informationen zur externen Evaluierung
1.1 Ziele und Methode der Evaluierung
Die Pädagogischen Hochschulen sind gesetzlich zur Durchführung verschiedener
1
Evaluierungen verpflichtet. Diese sind durch die Hochschul-Evaluierungsverordnung (HEV)
normiert.
In der aktuellen „Evaluierung der gesamten Pädagogischen Hochschule“ (§7 HEV) ist
vorgesehen, dass diese durch externe Expertinnen und Experten nach internationalen
Standards erfolgt. Die Evaluierung ist durch das Rektorat der Pädagogischen Hochschule
regelmäßig im Abstand von höchstens sieben Jahren zu veranlassen und ist erstmalig bis
spätestens 1. Oktober 2017 durchzuführen.
Ziel der externen Evaluierung ist die Sicherung der Qualität der Tätigkeiten der Pädagogischen
Hochschule. Die Tätigkeiten der Pädagogischen Hochschule ergeben sich aus dem
Hochschulgesetz, wonach die Hochschule „sowohl Personen in Lehrberufen sowie nach
Maßgabe des Bedarfs in pädagogischen Berufsfeldern aus-, fort- und weiterzubilden als auch
Bildungsinstitutionen, vornehmlich Schulen, in ihrer Qualitätsentwicklung zu beraten und zu
begleiten hat. In allen pädagogischen Berufsfeldern ist Forschung zu betreiben, um
wissenschaftliche Erkenntnisse zur Weiterentwicklung der Lehre zu erlangen.“ (§ 8 Abs. 1
Hochschulgesetz 2005)
Die externe Evaluierung wird von der AQ Austria als Peer-Review organisiert, in dem die
Expertinnen und Experten eine schriftliche Selbstevaluation der Hochschule erhalten und die
Vertreterinnen und Vertreter der Hochschule in einem Vor-Ort-Besuch als „kritische Freunde“
treffen. In ihrem Bericht beurteilen die Expertinnen und Experten die Stärken und Schwächen
und das Entwicklungspotential der Pädagogischen Hochschule und geben Vorschläge und
Empfehlungen für Verbesserungen.
Name der Expertin/des Experten Institution
Rektorin, Interkantonale Hochschule für
Prof.in Dr.in Barbara Fäh
Heilpädagogik Zürich
Studierende Lehramt Neue Mittelschule an
Mag.a Katharina Harrer
der PH OÖ
Leitung Qualitätsentwicklung und
Dr. Jan Poerschke Evaluation, Behörde für Schule und
Berufsbildung Hamburg
Leiterin der Professur Inklusive Didaktik und
Prof.in Dr.in Tanja Sturm Heterogenität, Pädagogische Hochschule
FHNW
1
Verordnung der Bundesministerin für Unterricht, Kunst und Kultur über die Evaluierungen und das
Qualitätsmanagement an Pädagogischen Hochschulen (Hochschul-Evaluierungsverordnung – HEV) BGBl. II Nr.
214/2009 idgF.
3/391.2 Evaluierungsaspekte
Die Evaluierung hat gem. § 7 Abs. 2 HEV jedenfalls Aufschluss über die folgenden Aspekte zu
geben:
1. Die Erreichung der durch die Pädagogische Hochschule definierten Zielvorgaben nach
Maßgabe des Ziel- und Leistungsplans;
2. die Qualität des Qualitätsmanagementsystems und der Evaluierungsmaßnahmen;
3. die Zweckmäßigkeit und Effizienz der Planungs- und Organisationsstrukturen;
4. die Zweckmäßigkeit und Effizienz der Verwaltung;
5. die Leistungsfähigkeit der Pädagogischen Hochschule im internationalen Vergleich.
1.3 Ablauf der Evaluierung
Verfahrensschritt Zeitpunkt
Vereinbarung über die Durchführung der externen Evaluierung 19.02.2016
Vorstellung des Verfahrens an der Hochschule 11.04.2016
Workshop mit der Hochschule 22.02.2016
Auswahl der Expertinnen und Experten 06.07.2016
Vorbereitungsseminar der AQ Austria mit Expert/innen 04. bzw. 14.11.2016
Übermittlung des Selbstevaluierungsberichts an die
23.12.2016
Expert/innen
Virtuelles Vorbereitungstreffen mit den Expert/innen 03.02.2017
Vorbereitungstreffen mit den Expert/innen vor Ort 27.02.2017
Vor-Ort-Besuch an der Hochschule 28.2. – 02.03.2017
Übermittlung der Erstfassung des Evaluierungsberichts an die
13.04.2017
PH Wien
Stellungnahme der PH Wien zu möglichen Fakten- und
21.04.2017
Formalfehlern im Bericht
Übermittlung des Evaluierungsberichts an die Hochschule 04.05.2017
4/392 Informationen zu Pädagogischen Hochschulen
2.1 Hochschulsystem in Österreich – Pädagogische Hochschulen
Die Institutionen des tertiären Bildungsbereichs auf Hochschulniveau sind folgenden Katego-
rien zuzuordnen:
22 Öffentliche Universitäten – finanziert durch den Bund;
13 Privatuniversitäten – finanziert durch private oder öffentliche Träger;
21 Fachhochschulen, die von privatrechtlich organisierten oder von öffentlichen
Trägern erhalten und die in Form einer Studienplatzfinanzierung öffentlich gefördert
werden;
14 Pädagogische Hochschulen – finanziert durch den Bund oder durch private
Träger;
das Institute for Science and Technology – Austria (IST-Austria), das durch
öffentliche Finanzierung, Forschungsförderungen durch Peer-Review-Begutachtung,
Technologie-Lizenzierung und Spenden unterstützt wird.
Bis Mitte der 1990er Jahre war das Hochschulwesen durch öffentliche Universitäten und küns-
tlerische Hochschulen geprägt. Die öffentlichen Universitäten erhielten mit dem Universi-
2
tätsgesetz 2002 den Status vollrechtsfähiger Einrichtungen. Eine Erweiterung und Diversi-
fizierung des österreichischen Hochschulwesens wurde durch die Schaffung eines neuen
Hochschulsektors, der Fachhochschulen, auf Grundlage des Fachhochschul-Studiengesetzes
3 4
1993 eingeleitet. Das Universitäts-Akkreditierungsgesetz 1999 bildete die Rechtsgrundlage
für die Einrichtung privater Universitäten. Mit der Donau-Universität Krems verfügt Ös-
terreich über eine öffentliche Universität für postgraduale Weiterbildung, die in ihren Struk-
5
turen den öffentlichen Universitäten weitgehend entspricht . Zuletzt erhielten die österreichi-
6
schen Pädagogischen Akademien den Hochschulstatus (Pädagogische Hochschulen) . 2006
7
wurde das Institute of Science and Technology – Austria eingerichtet, dessen Aufgaben
in der Erschließung und Entwicklung neuer Forschungsfelder und der Postgraduiertenausbil-
dung in Form von PhD-Programmen und Post Doc-Programmen liegt.
Pädagogische Hochschulen haben den gesetzlichen Auftrag Aus-, Fort und Weiterbildung in
pädagogischen Berufsfeldern, insbesondere in Lehrberufen, durchzuführen. Die Lehre hat wis-
senschaftlich fundiert zu sein und besteht aus humanwissenschaftlichen, fachwissenschaftli-
chen und fachdidaktischen Komponenten und der schulpraktischen Ausbildung (Praxisschu-
len).8
Pädagogische Hochschulen können per Gesetz eingerichtet sein (öffentliche Pädagogische
Hochschulen als Einrichtungen des Bundes) oder als private Pädagogische Hochschule oder
2 Bundesgesetz über die Organisation der Universitäten und ihre Studien (Universitätsgesetz 2002), BGBl. I 2002/120.
3 Bundesgesetz über Fachhochschul-Studiengänge (Fachhochschul-Studiengesetz- FHStG), BGBl. I 1993/340.
4 Bundesgesetz über die Akkreditierung von Bildungseinrichtungen als Privatuniversitäten (Universitäts-
Akkreditierungsgesetz - UniAkkG), BGBl. I 1999/168.
5 Bundesgesetz über die Universität für Weiterbildung Krems (DUK-Gesetz 2004), BGBl. I 2004/22.
6 Bundesgesetz über die Organisation der Pädagogischen Hochschulen und ihre Studien (Hochschulgesetz 2005), BGBl.
I 2006/30.
7 Bundesgesetz über das Institute of Science and Technology – Austria, BGBl. I 2006/69.
8
§ 8 Abs 1 HG.
5/39private Studiengänge anerkannt werden9. Die neun öffentlichen Pädagogischen
Hochschulen sind Einrichtungen des Bundes10 und stehen damit in einem direkten
Weisungszusammenhang zum zuständigen Bundesminister bzw. zur zuständigen
Bundesministerin. Oberstes Aufsichts- und Kontrollorgan ist der Bundesminister bzw. die
Bundesministerin für Bildung11 12 (mit Ausnahme der Hochschule für Agrar- und Um-
weltpädagogik).
Daneben wird den öffentlichen Pädagogischen Hochschulen eine Teilrechtsfähigkeit 13 (eigene
Rechtspersönlichkeit) zugesprochen, die sich auf über den öffentlich rechtlichen Bildungsauf-
trag hinausgehende Lehr- und Forschungstätigkeiten sowie die Erwachsenenbildung bezieht,
also zum Beispiel Annahme von Forschungsaufträgen oder von Förderungen oder die Bildung
von Forschungskooperationen.14
Fünf Private Pädagogische Hochschulen, die meist in kirchlicher Trägerschaft sind,
unterliegen der Aufsicht (diese umfasst auch die Anerkennung gemäß § 4 HG) durch die
Bundesministerin bzw. den Bundesminister für Bildung. Sie sind zur Führung der Bezeichnung
‚Private Pädagogische Hochschule‘ berechtigt.
Pädagoginnen- und Pädagogenbildung NEU
Die Reform der Lehrerinnen- und Lehrerbildung wurde im Jahr 2013 mit dem Bundesrahmen-
gesetz zur Einführung einer neuen Ausbildung für Pädagoginnen und Pädagogen legistisch
umgesetzt.
Intention des neues Gesetzes war bzw. ist „eine inhaltliche Aufwertung und weitere
Akademisierung des Lehrberufs, eine kompetenzbasierte Ausbildung, die die wissenschaftliche
und professionsorientierte Qualifikation der Absolventinnen und Absolventen sicherstellt und
die Harmonisierung der Ausbildung an Pädagogischen Hochschulen und an Universitäten mit
der Intention von weitreichenden Kooperationen in der Umsetzung.“15
Die Reform der Pädagoginnen- und Pädagogenbildung sieht nicht mehr eine nach Schultypen
(Volksschule, Hauptschule,…) sondern nach Bildungshöhe (Primarstufe, Sekundarstufe) diffe-
renzierte Lehramtsausbildung vor, die sich durch das Angebot von achtsemestrigen
Bachelorstudien und zwei- bis viersemestrigen Masterstudien in die Systematik der Bologna-
Architektur einfügt.
Trägerinnen der Ausbildungen sind Universitäten und Pädagogische Hochschulen, mit dem
Ziel unter Schaffung von Synergien im Bereich ihrer Stärken in enger Kooperation
Lehramtsausbildungen auf tertiärem Niveau anzubieten.
9
§ 4 bis 7 HG.
10
§ 2 Abs 1 HG.
11
BMBF https://www.bmb.gv.at/.
12
Das für die Universitäten sowie Fachhochschulen zuständige Ministerium ist das Bundesministerium für Wissenschaft,
Forschung und Wirtschaft bmwfw http://www.bmwfw.gv.at.
13
Tätigkeiten der Pädagogischen Hochschulen, die im Rahmen der eigenen Rechtspersönlichkeit durchgeführt werden,
unterliegen nicht der Hochschul-Evaluierungsverordnung HEV (§1 Abs 1 HEV). Daher werden die Bestimmungen des
§ 3 HG nicht näher ausgeführt.
14
§ 3 HG.
15
ErlRV 2348 dB NR XXIV. GP.
6/392.2 Profil der Pädagogischen Hochschule Wien
Die folgenden Informationen sind dem Selbstevaluierungsbericht der PH Wien und der
Homepage der Hochschule entnommen.
Die Pädagogische Hochschule Wien ist eine tertiäre Bildungseinrichtung im österreichischen
Hochschul- und Universitätensektor. Sie ist als öffentliche Hochschule des Bundes formal eine
nachgeordnete Dienststelle des Bundesministeriums für Bildung (BMB) im Gegensatz zu den
privaten (meist kirchlichen) Pädagogischen Hochschulen Österreichs. Mit etwa 2700
Studierenden in der Erstausbildung ist die PH Wien die größte der insgesamt 14
Pädagogischen Hochschulen Österreichs.
Im Studienjahr 2014/15 wurden 1619 Lehrveranstaltungen in der Ausbildung abgehalten,
2169 weitere in der Fortbildung, und 200 in der Weiterbildung (Lehrgänge). Insgesamt
wurden dabei 130.357 Prüfungen abgelegt. Unter den 2714 Studierenden in der
Erstausbildung waren 1988 (73,2%) weiblich; es gab 848 (31,2%) erstsemestrige
Studienanfängerinnen und Studienanfänger. In der Fort- und Weiterbildung waren insgesamt
16.794 Personen angemeldet, wobei jede Person durchschnittlich 3,7 Veranstaltungen
besuchte.
Die Pädagogische Hochschule Wien sieht sich in Lehre, Forschung und Qualitätssicherung
nachstehenden Leitlinien verpflichtet.
Impulsgebende und bedarfsorientierte Bildungsangebote
Persönlichkeitsorientierte Professionsbildung
Forschungsgeleitetes praxisbasiertes Lehren und Lernen
Diversitätsfokussierte Potenzialbildung
Nachhaltige Internationalisierung
7/393 Vorbemerkung der Expert/innen
Die in diesem Bericht dargelegten Sachverhalte, Einschätzungen und Empfehlungen basieren
auf den Informationen aus den schriftlichen Unterlagen und den Gesprächen an der Vor-Ort-
Visite. Die Expert/inn/engruppe wurde sehr freundlich empfangen, Fragen wurden
vorbehaltlos und offen beantwortet. Am Schluss jeden Tages stellten sich die Rektorin, die
Vizerektorin Lehre und der Vizerektor Forschung und Qualitätssicherung für Fragen und
vertiefende Gespräche zur Verfügung. Dies wurde von der Expert/inn/engruppe sehr
geschätzt.
Obwohl sich die PH Wien in den letzten Jahren mit vielen Veränderungen konfrontiert sah und
die Mitarbeitenden die hohe Belastung monierten, war die Expert/inn/engruppe beeindruckt
von der hohen Professionalität, der Motivation der Mitarbeitenden und der Begeisterung der
Studierenden.
8/394 Evaluierungsaspekte
Der Selbstevaluierungsbericht der PH Wien stellte für die Expertinnen und Experten eine gute
Grundlage dar, die Fragestellungen für die Gespräche zu entwickeln. Ergänzend dazu war der
gewährte Zugang zum Intranet sehr hilfreich.
Die Expertinnen und Experten haben den Bericht auf der Basis der Mitschrift der Gespräche
durch die AQ Mitarbeiterinnen und der eigenen Notizen erstellt. Für den Bericht zeichneten
jeweils ein bis zwei Mitglieder der Gruppe für das Verfassen eines Kapitels verantwortlich. Die
verschiedenen Kapitel wurden dann von allen Gruppenmitgliedern gegengelesen, ergänzt,
offene Punkte diskutiert oder unterschiedliche Sichtweisen bereinigt. Die Schlussfassung
wurde durch die Vorsitzende erstellt.
Der Bericht widerspiegelt somit die Sicht der Expertinnen und des Experten, den sie sich auf
der Basis des Selbstevaluierungsberichtes, der Gespräche, des Austauschs zwischen den
Gesprächen und den Notizen erstellt hat. Die Gespräche verliefen in einer konstruktiven und
wertschätzenden Atmosphäre, die Expert/inn/engruppe hat den Eindruck, dass die Fragen
offen beantwortet wurden. Zwischen den Gesprächen waren immer wieder Pausen
vorgesehen, die einen Abgleich des Gehörten in der Expert/inn/engruppe ermöglichte.
4.1 Aspekt 1
Erreichung der durch die Pädagogische Hochschule definierten Zielvorgaben nach
Maßgabe des Ziel- und Leistungsplans
4.1.1 Feststellungen
Der „Ziel- und Leistungsplan, Ressourcenplan der Pädagogischen Hochschule Wien des
Bundes“ (ZLP) für die Zeit vom 01.10.2014 bis 30.09.2017 wurde von der Pädagogischen
Hochschule Wien gemäß Hochschulgesetz (§ 30 und § 31 Hochschulgesetz [HG] 2005)
entsprechend der gesetzlichen Erfordernisse erstellt und vom Bundesministerium für Bildung
und Frauen (BMBF) teilgenehmigt. Durch die Umstellung von Studienjahr auf Kalenderjahr
sind aktuell zwei ZLP in Verwendung. Die PH Wien führt mit dem BMB regelmäßig sog.
Begleitgespräche zur Umsetzung des ZLP. Neben dieser formalrechtlichen Bezugnahme dient
der ZLP auch weiteren Stakeholdern der Hochschule als Informationsmöglichkeit, hierzu zählt
vor allem der Wiener Stadtschulrat, der (spätere) Arbeitgeber der Studierenden. Der ZLP wird
vor dem Hintergrund der vom BMB zur Verfügung gestellten Ressourcen und den ebenfalls
vom BMB geforderten strukturellen und inhaltlichen Vorgaben durch das Rektorat erstellt.
Neben den gesetzlichen Vorgaben hat die PH Wien die Möglichkeit, zusätzlich zum
sogenannten Hauptgeschäft bis zu fünf eigene sogenannte „Ausbauvorhaben“ zu benennen.
Ein für die PH Wien wichtiges Entwicklungsprojekt ist die Vermittlung digitaler Kompetenzen
und die Verwendung digitaler Medien („Digitalisierung“). Es ist geplant, dieses Projekt im
kommenden ZLP zu verankern. Dieses Projekt, das im „Institut für übergreifende
Bildungsschwerpunkte der PH Wien“ im „Zentrum für Lerntechnologie und Innovation“ (ZLI)
verortet ist, hat dazu geführt, dass an der PH Wien in diesem Bereich eine hohe Expertise
entwickelt werden konnte. In diesem Zusammenhang sind die Einrichtungen unterschiedlicher
‚Labore’ (z. B. Lego/Robotik) zu sehen, die z.T. extern finanziert werden.
9/39Die Überprüfung der Erreichung und das Herunterbrechen der in einem ZLP festgelegten Ziele
erfolgt innerhalb der regelhaften Besprechungen des Rektorats sowie zwischen diesem und
den sieben Institutsleitungen und im Rahmen der jährlich stattfindenden Mitarbeiterinnen-
und Mitarbeitergespräche (MAG). Die Institutsleitungen wiederum führen jährliche MAG mit
ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Über diese Gespräche erfolgt auch das Monitoring
respektive die Betrachtung des Umsetzungserfolgs des ZLP.
4.1.2 Analyse (enthält Stärken, Schwächen, Entwicklungspotentiale)
Der zurzeit vorgegebene Gültigkeitszeitraum des ZLP von drei Jahren ist für die adäquate
Steuerung der PH Wien derzeit gut geeignet. Im Rahmen der Begleitgespräche mit dem BMB
können zudem Vorhaben und Entwicklungen adaptiert und zusätzliche Leistungen formuliert
werden. Die Entwicklung einer längerfristigen Strategie oder Vision ist nach Aussage des
Rektorats schwierig und wenig sinnvoll, da sich aufgrund der externen Vorgaben durch das
BMB auch thematische Perspektiven ändern können. Auch bedingt durch Wechsel in der
politischen Leitung des BMB kann dies kurzfristig erfolgen. Wenngleich als Langzeitstrategie
die Akademisierung der Hochschule prioritär bearbeitet wird, wird die konkrete Umsetzung
und inhaltliche Gestaltung stark regierungsabhängig erlebt.
Die Institutsleitungen sind in die Erstellung des ZLP – und damit in die Konzeption eines
wichtigen Steuerungsinstruments der PH Wien – nur wenig eingebunden bzw. werden
hierüber lediglich informiert. Hier ist aus Perspektive der Expertinnen und Experten, trotz der
eindeutigen Vorgaben der Inhalte und Strukturen des ZLP durch das BMB, eine stärkere
Einbindung sinnvoll.
Die regelhaft geführten MAG zwischen dem Rektorat und den Institutsleitungen und zwischen
den Institutsleitungen und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dienen insbesondere der
Steuerung der Hochschule bezüglich der Dienstpflicht und der anderen Funktionen der
Mitarbeitenden, eignen sich aber in Teilen auch dafür, die Erfüllung des ZLP regelmäßig zu
überprüfen. Der „Leitfaden Mitarbeiter/innen-Gespräch“ entspricht aktuellen und gängigen
Standards und bildet eine gute Grundlage für eine angemessene und intendierte
Gesprächsführung. Kritisch ist anzumerken, dass die Relation des MAG zum ZLP der PH Wien
vage bleibt, wobei das MAG definitionsgemäß v.a. die Erhebung und Förderung des
Entwicklungspotenzials der einzelnen Mitarbeiterinnen/des einzelnen Mitarbeiters fokussiert.
Dies gilt insbesondere für die Partizipation und Teilhabe an der Gestaltung des ZLP durch die
Mitarbeitenden – und weniger in Bezug auf die Erfüllung des ZLP. Bei der Erarbeitung des ZLP
deutet sich eine top-down-Steuerung entlang des ZLP an, die in einer gewissen Ambivalenz zu
dem Anspruch einer Expertenorganisation steht, bei dem die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
stärker in die inhaltliche Gestaltung und Ausrichtung des Entwicklungsprozesses der
Hochschule einbezogen werden.
Eine regelmäßige (jährliche) intern durchgeführte Gesamtevaluation der PH Wien mit Bezug
auf den ZLP findet nicht statt.
Positiv hervorzuheben ist der Auf- und Ausbau des vom BMB benannten Forschungs- und
Lehrschwerpunkts „Digitalisierung“, wodurch sich die PH Wien eine Expertise angeeignet hat.
4.1.3 Vorschläge und Empfehlungen für Verbesserungen
Die Expertinnen und Experten empfehlen einen stärkeren Einbezug der
Institutsleitungen in die künftige Entwicklung der PH Wien, insbesondere bei der
Erstellung des ZLP. Diese mittlere Führungsebene, die in unmittelbarem Kontakt mit
den Mitarbeitenden und ihren professionell-beruflichen Kompetenzen und Interessen
steht und über die fachliche Expertise zu (international) diskutierten Themenfeldern
10/39verfügt, die in den Instituten vereint/gebündelt sind, sollte in die inhaltliche
Ausgestaltung und Formulierung von Zielen integriert werden.
Über einen für drei Jahre geltenden ZLP hinaus empfehlen die Expertinnen und
Experten der Hochschule, insbesondere der Hochschulleitung, die Entwicklung eines
Plans mit längerfristigen Entwicklungszielen für die Hochschule. Dieser könnte
beispielsweise Aspekte der Akademisierung in der Lehre aufgreifen, die langfristigen
Aufgaben der Institute in Forschung und Lehre, die inhaltliche Fokussierung der
Mitarbeitenden in der Lehre sowie die Förderung und Unterstützung wissenschaftlichen
Nachwuchses.
Es wird empfohlen, das Thema „Digitalisierung“ weiter und verstärkt zu bearbeiten,
um auch zukünftig – insbesondere im Verbund Nord-Ost – ein Alleinstellungsmerkmal
zu sichern und international anschlussfähig zu sein bzw. zu bleiben. Die erfolgreich
besetzte Professur mit dem Schwerpunkt „Digitalisierung“ eröffnet hierfür
entsprechende Möglichkeiten.
Die strukturellen Rahmenbedingungen, die sich der PH im Sinne einer tertiären,
forschungsbasierten Bildungseinrichtung zum einen und einer dem Ministerium
nachgeordneten Dienststelle zum anderen ergeben, sollten kontinuierlich reflektiert
sowie die damit einhergehenden Herausforderungen für die Etablierung als
international anerkannte und konkurrenzfähige Hochschule gegenüber dem
Ministerium thematisiert und ggf. problematisiert werden.
11/394.2 Aspekt 2
Qualität des Qualitätsmanagementsystems und der Evaluierungsmaßnahmen
4.2.1 Feststellungen
Die PH Wien führt entsprechend der Hochschul-Evaluierungsverordnung (gem. § 5 HEV 2009)
semesterweise Evaluationen des Lehrangebots durch die Studierenden durch. Zur technischen
Umsetzung dieser Evaluierung nutzt die PH Wien das Informationsmanagementsystem PH-
Online. PH-Online ist ein Informationsmanagementsystem (basierend auf CAMPUS online der
TU Graz), das sämtliche für die Administration von Lehre und Forschung relevanten Daten in
einer zentralen Datenbank speichert und für alle Abfragen und Bearbeitungsvorgänge „online“
– das heißt aktuell aus der Datenbank generiert – zur Verfügung steht.
Die vorgegebenen Fragebögen zur Evaluierung von Lehrveranstaltungen und Lehrenden im
Bereich der Aus- und Weiterbildung ebenso wie in der Fortbildung sind in der
Evaluationsordnung der PH Wien enthalten und entsprechen den gängigen inhaltlichen und
qualitativen Kriterien einer Lehrevaluation im Hochschulbereich.
Neben der verpflichtenden Lehrevaluation ist durch die Hochschul-Evaluierungsverordnung
auch die Verpflichtung zur Evaluierung der einzelnen Organisationseinheiten der
Pädagogischen Hochschule Wien geregelt (§ 6 HEV 2009).
Die Ziele und Bedeutung dieser beiden Evaluationen sind in der Evaluationsordnung der PH
Wien für das Studienjahr 2016/2017 festgelegt:
(1) Die Evaluationsverfahren dienen der Qualitätssicherung und der Qualitätsentwicklung
der Hochschule und ihrer Aufgabenerfüllung.
(2) Die interne Evaluation unterstützt die Profilbildung der Pädagogischen Hochschule
Wien. Die Qualität von Lehre und Forschung sowie aller darauf bezogenen
Dienstleistungen wird laufend überprüft und verbessert. Das Ziel besteht in der
Selbstbeobachtung und Selbstvergewisserung der Einhaltung der Qualitätsstandards
als Grundlage für Selbststeuerung und für Verbesserungsmaßnahmen.
(3) Evaluationsergebnisse finden Eingang in die Entwicklungsplanung der Pädagogischen
Hochschule Wien. Sie stehen in enger Wechselbeziehung mit der Ziel-, Leistungs- und
Ressourcenplanung. So dienen die Evaluationsergebnisse der Vorbereitung von
Entscheidungen der Organe der Pädagogischen Hochschule Wien und weiteren
Organisationseinheiten der Pädagogischen Hochschule Wien mit Aufsichts- oder
Steuerungsfunktionen. Die Evaluationsergebnisse sollen zu konkreten
Qualitätssicherungs- und –verbesserungsmaßnahmen führen und die Mitglieder und
Angehörigen der Pädagogischen Hochschule Wien sind verpflichtet, zur Erfüllung der
Hochschulaufgaben an den Evaluationen mitzuwirken.
Die Veranlassung von Evaluierungen und die Veröffentlichung von Evaluierungsergebnissen zu
Händen der Organe der PH Wien obliegt dem Rektorat der Pädagogischen Hochschule Wien
(gem. § 15 HG 2005).
Die folgenden Zuständigkeiten und zeitlichen Abläufe sind alle durch die Evaluationsordnung
der PH Wien geregelt: Die Zuständigkeit des Vizerektors für Forschung und Qualitätssicherung
umfasst alle die Forschung und Qualitätssicherung betreffenden Agenden an allen Instituten
der Pädagogischen Hochschule Wien. Für die Erstellung von Maßnahmen zur Evaluation und
Qualitätssicherung der Studienangebote ist das Hochschulkollegium verantwortlich.
12/39Die Rückmeldung zum Ende der Lehrveranstaltung wird an der Pädagogischen Hochschule
Wien in allen Bereichen der Lehre (Aus-, Fort- und Weiterbildung) semesterweise für alle
Lehrveranstaltungen über PH-Online durchgeführt. Ausgenommen von dieser Regelung sind
alle Lehrveranstaltungen des Lehramtes Sekundarstufe Allgemeinbildung im Rahmen des
Kooperationsstudiums im Verbund Nord-Ost. Diese werden über die Qualitätssicherung der
Universität Wien abgewickelt. Die Ergebnisse der Evaluierung im Verlauf und zum Ende der
Lehrveranstaltung dienen den Lehrenden zur Reflexion, Planung und Weiterentwicklung ihrer
Lehre. Rückmeldungen im Verlauf der Lehrveranstaltung in Aus-, Fort- und Weiterbildung sind
dann durchzuführen, wenn dies in Bezug auf die Dauer der Lehrveranstaltung sinnvoll ist. Im
Regelfall soll der Zeitpunkt der Rückmeldung im Verlauf der Lehrveranstaltung nach etwa 2/3
des Veranstaltungszeitraumes liegen, damit sichergestellt ist, dass die Lehrenden die
Ergebnisse der Befragung mit den Studierenden und Teilnehmenden der Lehrveranstaltung in
ausreichendem Maße besprechen können. In der aktuellen Praxis holen sich die meisten
Lehrenden dieses – in der Regel mündliche oder mit wenigen, offenen Fragen schriftliche –
Feedback der Studierenden eigeninitiativ eher in der Mitte der Lehrveranstaltung ein und
nutzen diese Rückmeldungen für evtl. Nachsteuerungen des Inhalts oder des Umfangs der
Lehrveranstaltung.
Die Ergebnisse der Evaluierung aus PH-Online zum Ende der Lehrveranstaltung dienen den
Organen der Pädagogischen Hochschule Wien zur Entwicklung von Maßnahmen zur
Verbesserung der Lehrqualität, als Grundlage für Maßnahmen zur Unterstützung der
Lehrenden und für curriculare Planungsschritte. Das Hochschulkollegium erhält die
Evaluationsergebnisse, um in Absprache mit dem Rektorat einen Bericht zu verfassen (Anzahl
der evaluierten Lehrveranstaltungen/Lehrenden der Aus-, Fort- Weiterbildung;
Beteiligungsquote; Fragebögen im Volltext; Ergebnisse im Überblick; Anregungen für
curriculare Maßnahmen). Der Bericht wird dann über das Rektorat an das BMB weitergeleitet.
In der Praxis der PH Wien erhalten die Studierenden mittlerweile nicht mehr am Ende des
Semesters, sondern einen Tag nach dem letzten Lehrveranstaltungstermin eine E-Mail mit der
Aufforderung, die Lehrveranstaltung über PH-Online zu bewerten. Die PH Wien erhofft sich
dadurch eine Erhöhung der Beteiligungsquote von derzeit ca. 12 auf ca. 25 Prozent.
Festzustellen ist, dass auch eine Beteiligungsquote von ca. 25 Prozent keine repräsentativen
Aussagen über die Qualität einer Lehrveranstaltung zulassen. Zusätzlich zum Studierenden-
Feedback über PH-Online holen sich viele Lehrende ein weiteres Feedback durch die
Studierenden direkt am Ende der letzten Veranstaltung ein. Dies erfolgt häufig durch ein
mündliches Feedback (z. B. im Rahmen eines „Blitzlichts“), aber auch durch kleine
Fragebögen, die von den Lehrenden zum Teil selber entwickelt worden sind. Die im Rahmen
der Evaluierung befragten Lehrenden gaben ausnahmslos an, dass sie dieses Feedback für
wichtig und nützlich halten. Die Einholung so eines Feedbacks erfolgt in Eigenverantwortung
der einzelnen Lehrenden, eine Rückkopplung der Ergebnisse, z. B. mit den Institutsleitungen,
oder ein systematisches Zusammenführen der dezentral verwendeten Instrumente oder
Ergebnisauswertungen erfolgt jedoch nicht.
Kritisch anzumerken ist, dass Lehrveranstaltungen aus der Lehrevaluation ausgeschlossen
werden, wenn mehrere Lehrende die gleiche Lehrveranstaltung durchführen, also im gleichen
Modul lehren. In diesem Fall kann ein/eine Lehrende/r beantragen, dass die eigene
Lehrveranstaltung aus der Evaluation herausgenommen wird.
Während die Lehrenden das Feedback der Studierenden zumindest zu ihren eigenen
Lehrveranstaltungen in PH-Online einsehen können, werden die Studierenden nicht über die
Ergebnisse der Evaluation informiert. Auch die Bereichsleitungen, die verantwortlich für die
13/39Fortbildungsplanung sind, werden nicht über die Ergebnisse der Lehrevaluation informiert und
können diese auch nicht einsehen.
Ein regelhaftes kollegiales Feedback, bei dem sich die Lehrenden untereinander eine
Rückmeldung zu Lehrveranstaltungen geben, gibt es an der PH Wien nicht.
Für den Verwaltungsbereich existieren klare Prozessbeschreibungen. Auch die MAG sind,
neben der Möglichkeit interne Fortbildungen zu besuchen, ein geeignetes Instrument zur
Sicherung und Erhöhung der Qualität der Arbeit. Eine Qualitätssicherung in Form einer
Evaluierung existiert in der Verwaltung jedoch nicht.
Der Bereich der Forschung befindet sich an der PH Wien noch im Aufbau, eine
Qualitätssicherung in diesem Bereich ist daher noch nicht fertig ausgestaltet. Die Evaluation
der Forschung soll laut Evaluationsordnung darauf abzielen, Forschungsprofile und -
schwerpunkte herauszuarbeiten und das interne Forschungsumfeld zu bewerten,
Forschungsleistung und Drittmitteleinwerbung zu verbessern sowie forschungsfördernde
Personalentwicklungsmaßnahmen zu setzen. Der Schwerpunkt der internen
Forschungsevaluation liegt dabei aktuell auf der Sammlung, Bereitstellung und Aufarbeitung
aller einschlägigen Daten und Materialien (Forschungsberichte, Publikationen, Drittmittel,
Projekt- und Netzwerkaktivitäten, wissenschaftliche Veranstaltungen etc.). Die Evaluierung
wird vom Vizerektor für Forschung und Qualitätssicherung veranlasst. Die Arbeitsgruppe der
Forschungskoordinatorinnen und Forschungskoordinatoren unterstützt die Durchführung.
Aktuell ist es v.a. vom individuellen Engagement einzelner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
abhängig, welche Forschungsprojekte zustande kommen. Auch die konzeptionelle Einbindung
und formale Zuständigkeit der institutseigenen Qualitätskoordinatorinnen und -koordinatoren
zusätzlich zu den Forschungskoordinatorinnen und -koordinatoren muss noch erfolgen.
Im Rahmen der Veröffentlichung von Forschungsbeiträgen in (Fach-)Zeitschriften werden
regelhaft die Anträge kollegial gegengelesen. Im Rahmen der Veröffentlichung der
hausinternen Reihe „Forschungsperspektiven“ (seit 2009) sind mittlerweile double-blind
reviews von Publikationsbeiträgen die Regel, die die Qualität der Beiträge sichern sollen.
Im Zuge der Umstrukturierung und Akademisierung findet an der PH Wien aktuell eine
Diskussion darüber statt, welche formalen und inhaltlichen Anforderungen an eine
Bachelorarbeit und zukünftig auch an eine Masterarbeit gestellt werden. Zurzeit sind diese
Anforderungen unter den Lehrenden sehr individuell und unterscheiden sich teilweise deutlich
voneinander. Zur Festlegung der Bewertungskriterien für die Bachelor- und Masterarbeiten
hat die PH Wien eine Arbeitsgruppe eingerichtet, die ihre Arbeit bereits aufgenommen hat.
Die nach der HEV (§ 6 HEV 2009) vorgeschrieben Evaluierung der Organisationseinheiten soll
ab dem Wintersemester 2017 in einem festgelegten Turnus starten. Die Evaluationsordnung
der PH Wien sieht vor, dass alle Organisationseinheiten der PH Wien das Verfahren in einem
intern festgelegten Turnus durchlaufen (zwei Institute pro Semester). Die Evaluierung
geschieht auf Veranlassung des Rektorats. Zusätzlich zu den akademischen
Organisationseinheiten (Lehrinstitute, Zentren) sollen auch andere studien- und
forschungsrelevante Abteilungen (Bibliothek, Studien- und Prüfungsabteilung, IT- und
Medienabteilung, usw.) einer regelmäßigen Evaluierung unterzogen werden. Diese werden
vom Vizerektor für Forschung und Qualitätssicherung beauftragt. Die betroffene Einheit hat
unter Einbezug aktueller Kennzahlen sowie der Ergebnisse der Evaluierung des Lehrangebots
durch Studierende eine Selbsteinschätzung abzugeben und Veränderungsmaßnahmen
vorzuschlagen. Organisationseinheiten sind dazu angehalten über die Evaluierung des
14/39Lehrangebots hinausgehende Erhebungen zur Zufriedenheit der Studierenden durchzuführen,
und an die Organe der Hochschule zu berichten. Die Selbsteinschätzung beruht auf einer
Analyse von Stärken, Schwächen, Chancen und Gefahren (SWOT) durch die
Organisationseinheit. Die interne Evaluation schließt mit einem Selbstbericht ab. Die
Koordinatoren und Koordinatorinnen für Qualitätssicherung in den Instituten unterstützen die
Organisationseinheiten bei der Erstellung des Selbstberichts. Das Rektorat nimmt zu den
Bewertungen und Empfehlungen Stellung und kann gegebenenfalls Maßnahmen zur
Verbesserung der Qualität veranlassen. Die Ergebnisse werden in einem Evaluierungsbericht
an den Hochschulrat und das BMB zusammengefasst.
4.2.2 Analyse (enthält Stärken, Schwächen, Entwicklungspotentiale)
Die aktuelle Evaluationsordnung für das Studienjahr 2016/2017 definiert klar und eindeutig
die Geltungsbereiche, die Ziele und Bedeutung von Evaluationen, die Anforderungen und
Grundsätze und klärt die Zuständigkeiten der jeweils Beteiligten. Die Evaluationsordnung
stellt eine sehr solide Grundlage für die Erfüllung des Evaluationsauftrags des BMB dar.
Das Informationsmanagementsystem PH-Online ist vom Aufbau und von den technischen
Nutzungsmöglichkeiten grundsätzlich gut geeignet, die Lehrevaluation durch die Studierenden
durchzuführen. Auch der Auftrag, nach ca. 2/3 des Veranstaltungszeitraums ein
Zwischenfeedback der Studierenden einzuholen, wird von den Lehrenden regelhaft
durchgeführt und konstruktiv genutzt. Ein Nachteil der Abschlussevaluierung durch PH-Online
sind die geringen Beteiligungsquoten (12 bis maximal ca. 25 Prozent), die weder
repräsentative Aussagen auf der Ebene der einzelnen Lehrveranstaltung, noch auf der Ebene
der Institute oder der gesamten PH Wien zulassen. Die Lösung der Lehrenden, eine eigene
Evaluation im direkten Anschluss an den letzten Termin der Veranstaltung durchzuführen,
scheint demnach sowohl sinnvoll als auch notwendig. Die Ergebnisse dieser individuell
durchgeführten Evaluationen werden von einem deutlich höheren Anteil an Studierenden
angenommen (vermutlich auch aufgrund der direkt und vor Ort gegebenen Möglichkeit eines
Feedbacks) und liefern den Lehrenden offensichtlich wertvolle und interessante Informationen
zur Qualität ihrer Veranstaltung. Die Unterschiedlichkeit der Vorgehensweise bei den
Lehrenden macht jedoch eine zusammenfassende Auswertung dieser individuellen Feedbacks
und eine Nutzung für die Qualitätssicherung der PH unmöglich.
Die Ergebnisse der zentralen Lehrevaluation am Ende eines Semesters, die vom
Hochschulkollegium in einem Bericht für das BMB zusammengefasst werden, werden offiziell
nur über das Rektorat an das BMB weitergeleitet. Das Hochschulkollegium nimmt die
Ergebnisse lediglich zur Kenntnis, eine konstruktive Nutzung der Ergebnisse für die
Qualitätssicherung erfolgt nicht. Grund hierfür mag sicherlich die geringe Aussagekraft der
Ergebnisse aufgrund der nicht-repräsentativen Beteiligungsquote sein. Zurzeit bemüht sich
eine Arbeitsgruppe des Hochschulkollegiums um Lösungen, um die Partizipation der
Studierenden zu erhöhen. Es bleibt allerdings unverständlich, warum weder die
Institutsleitungen noch die Studierenden und die Qualitätskoordinatorinnen und -
koordinatoren Einsicht in diese Ergebnisse erhalten.
An der PH Wien findet kein geregeltes kollegiales Feedbackverfahren statt, durch das die
Qualität der Lehrveranstaltungen einer weiteren Prüfung unterzogen wird und das zur
Sicherung der Qualität der Lehre genutzt werden kann, jedoch ist es im Aufgabenprofil der
Fachgruppen, dass die Kollegenschaft sich zu Lehrmethoden und Prüfungsverfahren abspricht
und selbst reguliert. Es wäre vor dem Hintergrund des Wunsches der PH Wien nach mehr
Autonomie allenfalls sinnvoll und erforderlich, ein solches Feedbackverfahren einzuführen.
15/39Neben existierenden Prozessbeschreibungen, regelmäßig durchgeführten MAG und einem
Angebot an internen sowie externen Fortbildungsmöglichkeiten, wurden zur
Qualitätssicherung an der PH auch die Organisationseinheiten evaluiert. Die Auswahl der zu
evaluierenden Organisationseinheiten wurde bis anhin nach willkürlichen Auswahlkriterien und
sporadisch durchgeführt. Ein etablierter Turnus wurde erst kürzlich beschlossen und wird im
Wintersemester 2017/18 starten. Dies scheint sinnvoll zur Sicherung und Steigerung der
Qualität, insbesondere vor dem Hintergrund einer teilweise hohen Arbeitsbelastung.
Die Bemühungen im Bereich der Qualitätssicherung der Forschung und im Bereich der
Anforderungen an die Abschlussarbeiten (BA und MA) sind zwar noch am Anfang, die PH Wien
hat sich aber inhaltlich und strukturell auf den Weg gemacht und hat erste Strukturen
geschaffen, um diesen Aufgabenbereich systematisch weiter auszubauen.
Während die Lehrevaluation seit einigen Jahren regelhaft durchgeführt wird, wurde die
ebenfalls in der HEV vorgeschriebene Evaluierung der einzelnen Organisationseinheiten der
Pädagogischen Hochschule Wien bis jetzt nicht umgesetzt. Erst mit Beginn des
Wintersemesters 2017 soll diese Evaluation – fortführend jeweils an zwei Instituten pro
Semester – durchgeführt werden.
4.2.3 Vorschläge und Empfehlungen für Verbesserungen
Es wird empfohlen, dass die PH Wien ein übergreifendes Verständnis von
Qualitätssicherung formuliert verbunden mit der Frage, welchen Nutzen verschiedene
Evaluationen, insbesondere eine Lehrevaluation durch Studierende, für die
Qualitätssicherung der PH Wien haben kann.
In Verbindung mit dem ZLP sollte im Rahmen der hochschulischen Qualitätssicherung
neben der regelhaften Evaluation von Lehrveranstaltungen durch PH-Online einmal im
Jahr – zusätzlich zu den MAG – ein Gesamtevaluationskonzept erarbeitet und
durchgeführt werden, mit dem Ziel, Kenntnisse zur Zielerreichung mit Blick auf den
ZLP und vor dem Hintergrund übergreifender Erkenntnisse für Gesamtplanung und –
entwicklung des Lehr- und Forschungsangebots zu erhalten.
Darauf aufbauend wird empfohlen, ein Feedbackverfahren zu entwickeln, das sich
tatsächlich für die Weiterentwicklung der Lehre und die damit verbundenen
Möglichkeiten einer Qualitätssicherung auch und v.a. im Sinne der Akademisierung
eignet. Gegebenenfalls müsste dafür ein Verfahren gewählt werden, das nicht mit PH-
Online durchgeführt wird. Darauf aufbauend sollte über Möglichkeiten nachgedacht
werden, wie ein regelhaftes kollegiales Feedback an der PH installiert werden kann.
Es wird empfohlen, die Bestrebungen zur Sicherung der Qualität der Forschung – vor
allem vor dem Hintergrund der angestrebten Akademisierung – weiter auszubauen.
Hierzu bedarf es eines klaren Konsenses an die Qualität von Forschungsprojekten,
Bewertungskriterien wissenschaftlicher Veröffentlichungen und einer Beschreibung der
Anforderungen an wissenschaftliche Abschlussarbeiten (BA und MA).
Zur Sicherung der wissenschaftlichen Qualität wird die Einrichtung eines externen
Forschungsbeirats zur Begutachtung von Forschungsanträgen und eingereichten
Publikationen empfohlen. Dieser Beirat könnte zudem den Vizerektor für Forschung
und Qualitätssicherung entlasten.
16/394.3 Aspekt 3
Zweckmäßigkeit und Effizienz der Planungs- und Organisationsstrukturen
4.3.1 Feststellungen
Die PH Wien ist eine nachgeordnete Dienststelle des Bundesministeriums für Bildung (BMB).
Sie ist eingebunden im Verbund Nord-Ost gemeinsam mit der KPH Wien/Krems, der PH
Niederösterreich, der Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik und der Universität Wien.
Die PH Wien wurde aus verschiedenen Vorgängerinstituten 2007 gegründet. Der aktuelle
Organisationsplan ist seit 2014 in Kraft. Die PH Wien musste in den letzten Jahren viele
Veränderungen verarbeiten: die PädagogInnenbildung Neu und damit die Neugestaltung der
Curricula, die Zusammenarbeit mit der Universität Wien für die Sekundarstufe und das
Dienstrecht, welches mit 1. September 2017 vollständig umgesetzt sein wird.
Gemäß Selbstevaluierungsbericht hat sich die PH Wien bewusst für eine Matrixstruktur
entschieden. Mit der gewählten Struktur will die PH Wien „bestehenden und zukünftigen
Herausforderungen proaktiv und flexibel“ begegnen. Weiter sollen sowohl das
„Ineinandergreifen von Lehre, Forschung und Entwicklung als auch die Integration von
übergreifenden Schwerpunkten und Schulpraxis“ ermöglicht werden. In den Gesprächen
wurde immer wieder die Angemessenheit der Organisation für eine Expertenorganisation
betont. Man will darauf hinwirken, dass sich Forschung und Lehre stark vernetzen. Im
Rektorat werden die Lehre und die Forschung/Qualitätssicherung in den beiden Vizerektoraten
gebündelt.
In jedem Institut stehen gemäß Bericht Lehre, Forschung, Qualitätssicherung und Entwicklung
gleichberechtigt nebeneinander. Drei Institute bilden die Studienstufen ab (Elementar- und
Primarbildung, Allgemeinbildung in der Sekundarstufe, Berufsbildung). Das Institut für
allgemeine bildungswissenschaftliche Grundlagen und reflektierte Praxis legt seinen
Schwerpunkt auf inhaltlich übergreifende Themen und die Praxisausbildung, die in allen
Ausbildungsstufen ihren Niederschlag finden. Das Institut für übergreifende
Bildungsschwerpunkte bearbeitet die Forschungsschwerpunkte der PH Wien und bringt diese
Inhalte in die Bildungsgänge der Aus-, Fort- und Weiterbildung ein. Das Institut für
weiterführende Qualifikationen und Bildungskooperationen ist zuständig für die internationale
Vernetzung, während das Institut für Hochschulmanagement sich für die Prozesse und
Strukturen des wissenschaftlichen Managements der Hochschule verantwortlich zeichnet.
Einmal in der Woche findet eine Sitzung zwischen dem Rektorat und den Institutsleitenden
statt. In den Gesprächen werden der hohe Kommunikationsbedarf sowie die Prozesse und
Abläufe in der Matrix als Herausforderung bezeichnet.
Um der obengenannten Herausforderung gerecht zu werden, werden sogenannte
„Koordinatorinnen und Koordinatoren“ eingesetzt. Diese sind Funktionsträgerinnen und
-träger einerseits für die Vernetzung über die Institute hinweg und andererseits für die
Kommunikation der Vernetzungstätigkeit in die Institute hinein. Zurzeit gibt es
Koordinatorinnen und Koordinatoren für Forschung, Bachelorarbeiten, Studiengänge,
Fortbildung, Stundenplanung, Raumkoordination, Qualitätssicherung, Website und Facebook.
Jedes so abgesprochene Gebiet wird wiederum von einer Gesamtkoordinatorin/ einem
Gesamtkoordinator koordiniert, die/der dann den jeweiligen Institutsleitungen berichtet. Die
Institutsleitenden machen zum Teil weitere Sitzungen mit dem Koordinator/ der Koordinatorin
ihrer Institute. Die Mitarbeitenden melden sich für gewisse Funktionen selber, bzw. offene
Funktionen werden seit Kurzem im Intranet ausgeschrieben und so transparent gemacht. Im
17/39Bericht wird neben den regelmäßigen vielfältigen Gefäßen die informelle Kommunikation und
der Austausch per Mail betont. Auch werden jeweils am Montagnachmittag nur wenige
Lehrveranstaltungen durchgeführt, um informelle und formelle Treffen zu ermöglichen.
Zurzeit arbeitet die PH Wien daran, das Intranet über SharePoint im Sinne einer
Kollaborationsplattform weiterzuentwickeln. So wird die Kommunikation in mehrfacher Weise
und über mehrere Ebenen sichergestellt.
Ab September 2017 müssen alle Mitarbeitenden der Institute gemäß dem Dienstrecht in
einem gewissen Pensum in der Lehre eingesetzt werden (mindestens 160 Stunden pro
Semester ph1/PH1, mindestens 320 Stunden pro Semester ph2/PH2 und ph3/PH3).
Ausgenommen sind die Institutsleitungen und das Rektorat. Die PH Wien hat große
Anstrengungen unternommen, um ihren Mitarbeitenden fachliche und akademische
Weiterentwicklungen zu ermöglichen. Gleichzeitig wird betont, dass diese, in der realen
Umsetzung doch beträchtliche Lehrverpflichtung hemmend für die Entwicklung der PH Wien
und insbesondere der Forschung angesehen wird. Dabei geht es weniger um den Einsatz in
der Lehre an und für sich, als vielmehr um die Vorschrift, wie viele Stunden in der Lehre
absolviert werden müssen. Die damit fehlende Flexibilität der PH Wien in der Steuerung ihrer
gesamten Leistung wird so beträchtlich akzentuiert. Auch stellt sich die Frage, ob alle
Lehrenden in ihrer Expertise eingesetzt werden können oder ob sie einfach Lehrstunden
übernehmen, damit die Dienstpflicht erfüllt ist.
In der Lehre sind die Mitarbeitenden eines Instituts meist auch in anderen Instituten und
Bildungsgängen in Aus-, Fort- und Weiterbildung tätig. Um diese Komplexität zu meistern,
wird die Organisation der Lehre prioritär jeweils im Januar begonnen und im April
abgeschlossen. Das IHM spielt in der Erstellung dieser Prozesse eine wichtige Rolle und
entwickelt Tools zur einfacheren Abwicklung. So ist es möglich über UNITIS, exPHO und PH-
Online über die PH Wien hinweg die Einsatzplanung aller Mitarbeitenden einzutragen und
auszuwerten. Dies ist für die Institutsleitungen einsichtig. In den Gesprächen wird betont,
dass die Organisation der Lehre sehr aufwändig sei, aber unterdessen zur Routine geworden
ist. Die dazu entwickelten Tools und Instrumente werden als sehr hilfreich wahrgenommen.
Allgemein ist PH-Online akzeptiert, zeigt aber auch Mängel. So ist es nicht möglich, die
Forschungsprojekte abzubilden. Die Wartung erfolgt extern und der Einfluss der PH ist gering.
Dagegen wird das Intranet, welches auf SharePoint basiert, sehr gelobt.
Die PH Wien führt 16 Fachgruppen, in denen der fachliche Austausch über die Studiengänge,
Fort- und Weiterbildungsangebote und Institute hinweg geschieht. Falls die Fachgruppen zu
groß sind, wie z. B. in den Bildungswissenschaften, wird die Fachgruppe nach Studienstufe
geteilt.
Innerhalb eines Instituts finden unter der Leitung der Institutsleitungen regelmäßig Sitzungen
statt, um einerseits die Entwicklungen innerhalb des Instituts und andererseits die Arbeiten in
den Koordinationsgruppen zu diskutieren. Die Institute sind unterschiedlich groß, beinhalten
aber alle zwischen 30 und 50 Mitarbeitende. Die Institutsleitungen führen einmal im Jahr ein
Mitarbeitendengespräch mit „ihrem“ Stammpersonal, in welchem über die Erfüllung der
Dienstpflichten und sonstige Leistungen gesprochen wird, mit der Möglichkeit gegenseitige
Erwartungen und Wünsche zu berücksichtigen, sowie Karrierebestrebungen und Bedürfnisse
der Mitarbeitenden wahrzunehmen. Der Einsatz in der Lehre wird in Stunden festgehalten, die
anderen Aufwendungen werden nicht dotiert. Die Verabschiedung der Dienstpflicht liegt in der
Kompetenz der Rektorin. Das MAG ist das zentrale Element zur Steuerung der Hochschule.
Dort ist es möglich, hochschulische Bedürfnisse und Wünsche der Mitarbeitenden zu
18/39verbinden. Die Institutsleitungen sind belastet mit Personalgesprächen und
Planungsaufgaben.
Die Anstellung von festangestellten Lehrenden (Stammpersonal) wird über das
Bundesministerium für Bildung getätigt. Die Prozesse dafür sind sehr aufwändig und
langwierig. So wird betont, dass die PH Wien schon Personen nicht anstellen konnte, weil das
Ministerium nicht in nützlicher Frist entscheiden konnte, ob und zu welchem Gehalt jemand
angestellt würde. Dies belastet die Entwicklung der PH sehr.
Die Verbindung mit externen Stakeholdern ist der PH Wien sehr wichtig. Die PH Wien versucht
diese in die Entwicklungen miteinzubeziehen. Die PH Wien ist in den Verbund Nord-Ost
eingebunden. Eher schwierig wird die Zusammenarbeit mit der Universität Wien im Rahmen
der PädagogInnenbildung Neu auf Sekundarstufenniveau angesehen. Es wird beklagt, dass
das Bildungsministerium die PH Wien verpflichtet hat mit der Universität Wien
zusammenzuarbeiten, anstatt ihr die Möglichkeit zuzugestehen, mit anderen Universitäten
Kooperationen zu finden. Die institutionelle Zusammenarbeit mit der Universität Wien wird als
schwierig erlebt, während die persönlichen Kontakte auf Augenhöhe wahrgenommen werden.
Die PH Wien hat sehr viel investiert, um die Qualität der Ausbildung zu halten, ihre Expertise
und den Praxisbezug in die neuen Lehrangebote einzubringen. Die Mitarbeitenden der PH
betonen, dass dies weitgehend gelungen sei. Es wird sich im Zuge der Umsetzung zeigen, wie
sich die Ausbildung weiterentwickeln wird.
Die Verwaltung wird in der Matrix separat aufgezeichnet. Die Rektoratsdirektorin ist aber in
den Sitzungen zwischen Rektorat und Institutsleitungen dabei. Es besteht gemäß Aussagen
der Mitarbeitenden sowohl der Verwaltung als auch der Institute eine gute konstruktive
Zusammenarbeit. Die Mitarbeitenden der Verwaltung werden über das Bildungsministerium
angestellt, das auch über den notwendigen Ressourceneinsatz entscheidet. Zurzeit werden
weder Nachbesetzungen noch neue Stellen im Verwaltungsbereich bewilligt, was von den
Führungspersonen und den Mitarbeitenden als sehr schwierig wahrgenommen wird (s. auch
Aspekt 4).
Die Mitarbeitenden aller Einheiten, auch die Lehrbeauftragten und Mitverwendeten, betonen
ihre hohe Identifikation mit der Institution und der Lehrerinnen- und Lehrerbildung. Sie
machen aber auch auf die hohe Arbeitsbelastung und die vielfältigen Aufgaben und
Funktionen aufmerksam, die eine thematische Fokussierung kaum erlauben. Im Zuge der
Akademisierung der Lehrerinnen- und Lehrerbildung und der Gründung der PH Wien sind die
Anforderungen an die Mitarbeitenden gestiegen. Bis vor Kurzem wurde die Erstellung von
Qualifikationsarbeiten wie Promotionen oder Habilitationen durch Zeitentlastungen
(Zeitstipendien des BMB) unterstützt. Dies ist aktuell nicht mehr der Fall, die PH Wien hat
auch keine Möglichkeit, dies auf eigene Initiative hin zu tun. In den Gesprächen wird klar
deutlich, dass dies fehlt und sich die Mitarbeitenden Unterstützung wünschen.
In den Gesprächen wird mehrfach darauf verwiesen, dass die Pädagogischen Hochschulen in
Österreich mehr Autonomie erhalten sollen, analog zu den Fachhochschulen und den
Universitäten. Offenbar gibt es Anzeichen dafür, dass die Pädagogischen Hochschulen in die
Autonomie entlassen werden sollen. Dies wird von Seiten der PH Wien sehr begrüßt.
4.3.2 Analyse (enthält Stärken, Schwächen, Entwicklungspotentiale)
Die gewählte Organisationsform einer Matrix ist aus Sicht der Expert/inn/en adäquat für die
Erwartungen, die die PH Wien damit verbindet. Jede Mitarbeiterin/Jeder Mitarbeiter ist einem
19/39Sie können auch lesen