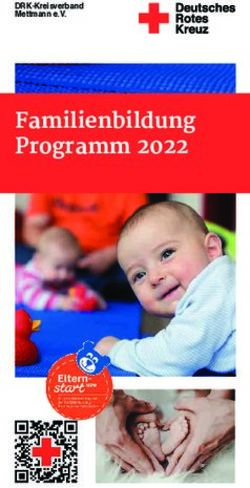GEMEINSAME BETREUUNG DES KINDES NACH DER SCHEIDUNG MIT BESONDEREM BLICK AUF DEN KINDESUNTERHALT
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Eingereicht von
GEMEINSAME Simone Katzmayr
BETREUUNG DES
Angefertigt am
Institut für Umweltrecht
KINDES NACH DER
Beurteiler / Beurteilerin
in a in
Univ-Prof. Mag. Dr.
Erika Wagner
SCHEIDUNG MIT Mai 2020
BESONDEREM BLICK
AUF DEN
KINDESUNTERHALT
Diplomarbeit
zur Erlangung des akademischen Grades
Magistra der Rechtswissenschaften
im Diplomstudium
Rechtswissenschaften
JOHANNES KEPLER
UNIVERSITÄT LINZ
Altenberger Straße 69
4040 Linz, Österreich
jku.at
DVR 0093696EIDESSTATTLICHE ERKLÄRUNG Ich erkläre an Eides statt, dass ich die vorliegende Diplomarbeit selbstständig und ohne fremde Hilfe verfasst, andere als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel nicht benutzt bzw. die wörtlich oder sinngemäß entnommenen Stellen als solche kenntlich gemacht habe. Die vorliegende Diplomarbeit ist mit dem elektronisch übermittelten Textdokument identisch. Ort, Datum Unterschrift 19. Mai 2020 2/41
Abkürzungsverzeichnis
ABGB allgemeines bürgerliches Gesetzbuch
Abs Absatz
Art Artikel
BGBl Bundesgesetzblatt
Bsp Beispiel
bspw beispielsweise
B-VG Bundesverfassungsgesetz
bzgl bezüglich
bzw beziehungsweise
DRM Doppelresidenzmodell
E Entscheidung
EMRK Europäische Menschenrechtskonvention
FaBo+ Familienbonus Plus
Gem gemäß
idF in der Fassung
iHv in Höhe von
iVm in Verbindung mit
KindNamRÄG 2013 Kindschafts-und Namensrechts-Änderungsgesetz
2013
KindRÄG 2001 Kindschaftsrechts-Änderungsgesetz 2001
mAn meiner Ansicht nach
MMn meiner Meinung nach
OGH Oberster Gerichtshof
Rsp Rechtsprechung
Sog sogenannte
stRsp ständige Rechtsprechung
Ua unter anderem
Va vor allem
VfGH Verfassungsgerichtshof
19. Mai 2020 3/41Inhaltsverzeichnis
I. Einleitung ............................................................................................................... 6
II. Obsorge ................................................................................................................. 7
III. Doppelresidenz ...................................................................................................... 8
A. Begriffsdefinition und Abgrenzung .......................................................................... 8
B. Verbreitung des DRM ............................................................................................. 9
C. DRM in der Rechtssystematik .............................................................................. 10
Die Entscheidung des VfGH (9.10.2015, G 152/2015-20) ........................................... 11
D. Voraussetzungen des DRM.................................................................................. 15
E. Internationale Verbreitung .................................................................................... 19
IV. Kindesunterhalt im Allgemeinen ........................................................................... 20
A. §231 ABGB .......................................................................................................... 20
B. Unterhaltsbedarf................................................................................................... 22
C. Art der Unterhaltsgewährung................................................................................ 23
D. Unterhaltsbemessungsgrundlage und Unterhaltshöhe ......................................... 24
V. Betreuungsrechtliches Unterhaltsmodell der Rechtsprechung.............................. 24
A. Drei Betreuungsmodelle ....................................................................................... 24
1. Betreuung im üblichen Ausmaß ........................................................................... 25
2. Betreuung im unüblichen Ausmaß........................................................................ 25
3. Gleichteilige Betreuung, Betreuungsrechtliches Unterhaltsmodell ........................ 26
B. Anwendungsvoraussetzungen für das betreuungsrechtliche Unterhaltsmodell .... 27
1. Gleichwertige Betreuungsleistungen .................................................................... 27
2. Gleich hohes Einkommen .................................................................................... 28
3. Gleichwertige Naturalleistungen ........................................................................... 32
C. Konsequenz des betreuungsrechtlichen Unterhaltsmodells ................................. 33
D. Kritik am betreuungsrechtlichen Unterhaltsmodell ................................................ 33
1. Unzulässige Rechtsfortbildung? ........................................................................... 33
2. Eklatantes „Umspringen“ von der Prozentabzugsmethode zum
betreuungsrechtlichen Unterhaltsmodell?............................................................. 34
E. Die Transferleistungen im betreuungsrechtlichen Unterhaltsmodell ..................... 35
1. Familienbeihilfe .................................................................................................... 35
a) OGH 1 Ob 158/15i ............................................................................................... 35
(1) Kritik Gitschthaler: ................................................................................................ 36
(2) Kritik Neuhauser:.................................................................................................. 36
19. Mai 2020 4/41(3) Kritik Tews: .......................................................................................................... 37 (4) Schwimann/Kolmasch .......................................................................................... 37 b) 4 Ob 8/19h ........................................................................................................... 37 (1) Kritik Gitschthaler ................................................................................................. 38 2. Familienbonus Plus .............................................................................................. 39 VI. Schlussbemerkung ............................................................................................... 39 VII. Literaturverzeichnis .............................................................................................. 40 19. Mai 2020 5/41
I. Einleitung In der österreichischen Gesellschaft lässt sich in den letzten Jahren ein Wandel hinsichtlich der Betreuung der Kinder während aufrechter Ehe und auch nach der Scheidung erkennen. Lange Zeit war es üblich, dass während der Ehe eine traditionelle Rollenverteilung gelebt wurde, nach der es Aufgabe der Frau war, den Haushalt zu erledigen und sich um die Kinder zu kümmern. Die Aufgabe des Mannes war es hingegen die Familie finanziell abzusichern. Da auch immer mehr Frauen nach einer beruflichen Karriere strebten und dadurch nicht mehr die Kinderbetreuung alleine bewerkstelligen konnten, kam es dazu, dass vielfach Eltern ihre Kinder gemeinsam betreuten, um eine Gleichberechtigung von Mann und Frau im Berufsleben gewährleisten zu können. Nach der Scheidung war und ist es zum Teil auch immer noch üblich, dass der Mutter die Obsorge für die Kinder zukam und der Vater zu Unterhaltszahlungen verpflichtet wurde. Doch durch den Umstand, dass viele Eltern während aufrechter Ehe die Kinder gemeinsam betreuten, tendierten viele Eltern dazu, dies auch nach der Scheidung weiterhin so zu praktizieren. Dadurch erlebte das sog Doppelresidenzmodell (DRM) in den letzten Jahren einen enormen Aufschwung und wird als Betreuungsmodell immer beliebter. Aufgrund nicht vorhandener gesetzlicher Grundlagen in der österreichischen Rechtsordnung für das DRM, herrschte diesbezüglich lange Zeit große Rechtsunsicherheit. Auch wenn es zu diesem Thema aktuell eine bereits gefestigte Rechtsprechung gibt, wird der Ruf nach einer gesetzlichen Regelung immer lauter, um die noch immer bestehenden Unklarheiten aus dem Weg zu räumen. Nicht nur als neuartiges Betreuungsmodell brachte das DRM Änderungen in der Rechtsprechung, auch auf das Unterhaltsrecht hatte es weitreichende Auswirkungen. Ging man zuvor bei Haushaltstrennung von einer Betreuung durch den einen Elternteil und von der Geldunterhaltspflicht des anderen aus, so wurden die Gerichte nun mit der Frage konfrontiert, ob es bei gleichteiliger Betreuung nicht einer anderen Regelung bedürfe. 19. Mai 2020 6/41
Da dieses Betreuungsmodell in der gerichtlichen Praxis zu zahlreichen offenen Fragen führte, möchte ich in meiner Diplomarbeit klären, unter welchen Voraussetzungen eine gemeinsame Betreuung des Kindes nach der Scheidung zulässig ist und welche Auswirkungen diese auf den Kindesunterhalt hat. Zu Beginn meiner Diplomarbeit möchte ich die Obsorge in ihren Grundzügen erläutern, da diese eine wichtige Grundlage für das nähere Verständnis des DRM darstellt. Nachfolgend erläutere ich den Begriff des DRM und grenze es zu anderen Betreuungsmodellen ab. Dabei gehe ich auch auf die Stellung des DRM in der österreichischen Rechtsordnung ein und beschäftige mich mit der Rsp des VfGH. Desweiteren erörtere ich die Voraussetzungen des DRM und die Verbreitung dieses Modells in anderen Ländern. Darauf aufbauend behandle ich die Auswirkungen des DRM auf den Kindesunterhalt, wobei ich zuvor die Grundlagen des Unterhaltsrechts erläutere. Neben der diesbezüglichen Rsp setzte ich mich auch mit Kritiken und Meinungen aus der Lehre auseinander. II. Obsorge Die Obsorge beinhaltet gem § 158 Abs 1 ABGB neben der Pflege und Erziehung auch die Vermögensverwaltung und die gesetzliche Vertretung des Kindes. § 177 ABGB gibt Aufschluss darüber, wer mit der Obsorge betraut ist. Gem Abs 1 sind beide Eltern mit der Obsorge betraut, wenn sie bereits bei Geburt des Kindes verheiratet sind bzw ab dem Zeitpunkt der Eheschließung, wenn diese erst nach der Geburt erfolgt.1 Bei Auflösung der Ehe oder der häuslichen Gemeinschaft bleibt gem § 179 Abs 1 ABGB die Obsorge beider Eltern aufrecht. Den Eltern steht es aber frei vor Gericht zu vereinbaren, dass einer von ihnen allein mit der Obsorge betraut sein soll. Soll jedoch die Obsorge beider auch weiterhin aufrecht bleiben, so muss gem § 179 Abs 2 ABGB vor Gericht vereinbart werden, in welchem 1 Deixler-Hübner, Scheidung, Ehe und Lebensgemeinschaft rechtliche Folgen der Ehescheidung und Auflösung einer Lebensgemeinschaft (2019) 196ff. 19. Mai 2020 7/41
Haushalt das Kind hauptsächlich betreut wird. Der Elternteil, der das Kind hauptsächlich betreut wird als Domizilelternteil bezeichnet. Man spricht hierbei auch vom sog Heim erster Ordnung.2 Treffen die Eltern keine Vereinbarung, so hat das Gericht nach § 180 ABGB über die Obsorge zu entscheiden. Zuerst hat das Gericht nach Abs 1 eine vorläufige Regelung der elterlichen Verantwortung zu treffen, man spricht hier auch von der Phase der vorläufigen elterlichen Verantwortung. In dieser Phase wird ein Elternteil für einen Zeitraum von sechs Monaten mit der Obsorge betraut, dem anderen Elternteil wird ein ausreichendes Kontaktrecht eingeräumt. Erst im Anschluss an diese Phase der vorläufigen elterlichen Verantwortung ist vom Gericht endgültig über die Obsorge zu entscheiden. Für den Fall, dass beide Eltern mit der Obsorge betraut werden, muss festgelegt werden, in wessen Haushalt das Kind hauptsächlich betreut wird.3 Diese Verpflichtung der Festlegung des hauptsächlichen Betreuungsortes, sei es durch eine Vereinbarung der Eltern selbst oder durch Festlegung des Gerichtes, stellt eines der zentralen Probleme in Bezug auf die Zulässigkeit des sog DRM dar. III. Doppelresidenz A. Begriffsdefinition und Abgrenzung Für den Begriff DRM gibt es keine Legaldefinition, jedoch haben sich diverse Definitionen in der Literatur entwickelt, die im Kern dasselbe aussagen. Unter DRM ist demnach zu verstehen, dass die Kinder nach der Scheidung oder Auflösung der häuslichen Gemeinschaft von beiden Elternteilen gleichermaßen betreut werden.4 Dies ist unabhängig von der Obsorge zu sehen, es ist somit grundsätzlich irrelevant ob alleinige oder gemeinsame Obsorge besteht.5 2 Deixler-Hübner, Scheidung, Ehe und Lebensgemeinschaft rechtliche Folgen der Ehescheidung und Auflösung einer Lebensgemeinschaft (2019) 196ff. 3 Hinteregger, Familienrecht (2017) 234f. 4 Schoditsch, Grundfragen des Doppelresidenz-Modells, ÖJZ 2019 H 18, 801 (801). 5 Gitschthaler, Unterhaltsrecht (2015) RZ 88 19. Mai 2020 8/41
Das DRM wird teilweise in der Literatur auch als Wechselmodell bezeichnet, dies wegen des Wechsels zwischen den beiden Wohnstätten der Eltern, in denen das Kind abwechselnd lebt. Aber auch Begriffe wie Pendelmodell, Paritätsmodell oder Wandelmodell kommen vor. In Österreich hat sich aber die Bezeichnung als DRM etabliert.6 Abzugrenzen ist das DRM einerseits vom Residenzmodell und andererseits vom Nestmodell. Beim Residenzmodell wird das Kind von einem Elternteil allein betreut, dem anderen Elternteil steht ein Kontaktrecht nach § 187 Abs 1 ABGB zu. Das Residenzmodell ist das Standardmodell, das auch vom österreichischen Gesetzgeber vorgesehen ist.7 Das Nestmodell unterscheidet sich vom DRM insofern, als die Betreuungsorte nicht wechseln, sondern das Kind einen festen Wohnsitz hat in dem es abwechselnd von einem Elternteil betreut wird, während der andere abwesend ist. Hierbei handelt es sich um eine Sonderform des DRM, da auch hier eine gemeinsame Betreuung praktiziert wird.8 Auch wenn sich das Residenzmodell auf den ersten Blick scheinbar leicht vom DRM abgrenzen lässt, ergeben sich hier in der Praxis doch häufig Schwierigkeiten. So ist es nicht immer sofort klar, ob bloß extensiver Kontakt im Rahmen des Kontaktrechts ausgeübt wird und somit das Residenzmodell einschlägig ist, oder ob darüber hinaus bereits schon gleichwertige Betreuung vorliegt und daher das DRM anzuwenden ist. B. Verbreitung des DRM In den letzten Jahren wuchs das Interesse getrennt lebender Familien an dem DRM. Ausschlaggebend für die Beliebtheit dieses Modells sind va die positiven Effekte der gemeinsamen Betreuung für die Beteiligten (Vater, Mutter, Kind). Nachfolgend wird davon ausgegangen, dass, wie es im Rahmen des 6 Raunigg/Willmann, Doppelresidenz: Wechselmodell - Paritätsmodell - Pendelmodell - Wandelmodell, EF-Z 2010 H 6, 245 (245). 7 Schoditsch, Grundfragen des Doppelresidenz-Modells, ÖJZ 2019 H 18, 801 (801). 8 Sünderhauf, Wechselmodell (2013) 57. 19. Mai 2020 9/41
Residenzmodelles häufig vorkommt, die Mutter das Kind betreut und der Vater
lediglich sein Kontaktrecht ausübt. Selbstverständlich ist dies auch umgekehrt
möglich, der Einfachheit halber jedoch auf diese Konstellation bezogen:
Väter können durch das DRM im Leben des Kindes präsenter sein als
bei bloßer Ausübung des Kontaktrechts im Rahmen des
Residenzmodelles. Es wird somit eine stärke Bindung zwischen Vater
und Kind gewährleistet.9
Mütter werden aufgrund der Mitbetreuung durch den Vater entlastet.
Mütter, die ihr Kind alleine betreuen schränken meist ihre
Erwerbstätigkeit ein, um der Betreuung des Kindes angemessen
nachgehen zu können. Durch das DRM wird es für die Mutter erleichtert
ihre Erwerbstätigkeit wie gewohnt auszuüben.10
Kinder fühlen sich oftmals durch die Scheidung verpflichtet sich für einen
Elternteil zu entscheiden. Das DRM ermöglicht es dem Kind mit beiden
Elternteilen annähernd gleich viel Zeit zu verbringen.11
C. DRM in der Rechtssystematik
In der österreichischen Rechtsordnung findet sich keine Regelung in Bezug auf
das DRM, obwohl es in den letzten Jahren häufig praktiziert wurde.
Dadurch, dass das DRM gesetzlich nicht vorgesehen ist, stellt sich die Frage,
ob ein solches Modell zulässig ist bzw ob es mit jenen Regelungen des ABGB,
welche die Festlegung eines hauptsächlichen Betreuungsortes nach der
Scheidung bzw Auflösung der häuslichen Gemeinschaft vorsehen zu
vereinbaren ist. Denn hat man das Modell der Doppelresidenz vor Augen, bei
dem beide Eltern das Kind betreuen, und somit keine hauptsächliche Betreuung
durch einen Elternteil gegeben ist, stellt sich die Frage, wie sich dies auf die
Verpflichtung der Festlegung eines hauptsächlichen Betreuungsortes nach den
§§ 179 Abs 2 und 180 Abs 2 ABGB auswirkt.
Aufschluss darüber gibt die Entscheidung des VfGH G 152/2015-20.
9
Sünderhauf, Wechselmodell (2013) 30.
10
Sünderhauf, Wechselmodell (2013) 30.
11
Sünderhauf, Wechselmodell (2013) 30.
19. Mai 2020 10/41Die Entscheidung des VfGH (9.10.2015, G 152/2015-20)
Das Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien hat einen Antrag auf Aufhebung
der folgenden Bestimmungen beim VfGH gestellt12:
§ 177 Abs 4 erster Satz ABGB idF BGBl I 15/2013: «Sind beide
Elternteile mit der Obsorge betraut und leben sie nicht in häuslicher
Gemeinschaft, so haben sie festzulegen, bei welchem Elternteil sich das
Kind hauptsächlich aufhalten soll.»13,
§ 179 Abs 2 ABGB idF BGBl I 15/2013: «Im Fall einer Obsorge beider
Eltern nach Auflösung der Ehe oder der häuslichen Gemeinschaft haben
diese vor Gericht eine Vereinbarung darüber zu schließen, in wessen
Haushalt das Kind hauptsächlich betreut wird. »14 und
§ 180 Abs 2 letzter Satz ABGB idF BGBl I 15/2013: «Wenn das Gericht
beide Eltern mit der Obsorge betraut, hat es auch festzulegen, in wessen
Haushalt das Kind hauptsächlich betreut wird. »15
Begründet wurde dieser Antrag damit, dass durch die Festlegung des
hauptsächlichen Betreuungsortes eine Privilegierung eines Elternteiles erfolge
und dies das Recht auf Achtung des Familienlebens gem Art 8 EMRK, das
Diskriminierungsverbot gem Art 14 EMRK, das Gleichbehandlungsgebot gem
Art 7 B-VG und auch das Bundesverfassungsgesetz über die Rechte von
Kindern (BGBl. I 4/2011) verletze. Der VfGH wurde dadurch vor die Frage
gestellt, ob die Verpflichtung der Festlegung des hauptsächlichen
Betreuungsortes überhaupt verfassungskonform ist.16
Der VfGH stellte daraufhin fest, dass der Antrag zwar zulässig, aber
unbegründet ist.17
Denn die Bestimmungen bilden zwar einen Eingriff in das Recht auf Achtung
des Familienlebens nach Art 8 EMRK, doch stellt hierbei die Sicherstellung des
Kindeswohles ein legitimes Ziel des Gesetzgebers dar. Die Festlegung eines
hauptsächlichen Betreuungsortes dient insofern dem Kindeswohl, als dem Kind
12
VfGH 09.10.2015, G 152/2015.
13
§177 Abs 4 ABGB
14
§179 Abs 2 ABGB
15
§180 Abs 2 ABGB
16
VfGH 09.10.2015, G 152/2015.
17
VfGH 09.10.2015, G 152/2015.
19. Mai 2020 11/41dadurch eine gewisse Klarheit und Sicherheit gewährt wird. Auch wenn dieser Eingriff in das Recht auf Achtung des Familienlebens ein legitimes Ziel verfolgt, müsse er darüber hinaus auch verhältnismäßig sein. Die Verhältnismäßigkeit wäre laut VfGH jedenfalls nicht gegeben, wenn die Verpflichtung zur Festlegung eines hauptsächlichen Betreuungsortes eine gleichteilige Betreuung gänzlich ausschließen würde, da es sehr wohl auch Fälle gibt, in denen dem Kindeswohl nur durch eine gleichteilige Betreuung entsprochen werden kann.18 Auch wenn es zu diesem Zeitpunkt noch keine Stellungnahme des OGH zu diesem Thema gab, setzte sich bereits die Literatur damit auseinander.19 Kathrein20 hielt eine gleichteilige Betreuung nicht durch das Gesetz als ausgeschlossen, sondern erachtete es vielmehr als zulässig, die Festlegung des hauptsächlichen Betreuungsortes als bloß nominelle Verpflichtung anzusehen. Dies jedoch nur in solchen Fällen, in denen eine gleichteilige Betreuung dem Kindeswohl besser entspricht. Dieser Ansicht folgte auch der VfGH und legte die Bestimmungen im Einklang mit Art 8 EMRK daher so aus, dass die Festlegung eines hauptsächlichen Betreuungsortes eine gleichteilige Betreuung nicht ausschließt, sofern es dem Kindeswohl entspricht. Die Verpflichtung zur Festlegung eines hauptsächlichen Betreuungsortes wird vielmehr so verstanden, dass sie zur Anknüpfung für diverse andere Rechtsfolgen, darunter ua zur Bestimmung des Hauptwohnsitzes, erforderlich ist.21 Angesichts dessen beurteilt der VfGH den Eingriff in das Recht auf Achtung des Familienlebens als verhältnismäßig, somit liegt nach seinem Verständnis auch kein Verstoß gegen Art 8 EMRK vor. Aus denselben Gründen ergibt sich, dass die angeführten Bestimmungen des ABGB auch nicht gegen Art 1 BVG über die Rechte von Kindern, den Gleichheitsgrundsatz und das Diskriminierungsverbot des Art 14 EMRK verstoßen, somit verfassungskonform sind.22 Es besteht somit auch nach diesem Erkenntnis die Pflicht bei gleichteiliger Betreuung einen hauptsächlichen Betreuungsort festzulegen. Damit erklärt der 18 VfGH 09.10.2015, G 152/2015. 19 VfGH 09.10.2015, G 152/2015. 20 Kathrein, Kindschafts- und Namensrechts-Änderungsgesetz 2013 (FN, ÖJZ 2013 H 5, 197 (204). 21 VfGH 09.10.2015, G 152/2015. 22 VfGH 09.10.2015, G 152/2015. 19. Mai 2020 12/41
VfGH die gleichteilige Betreuung und somit das DRM für zulässig, falls dies dem Kindeswohl am besten entspricht.23 Dieses Erkenntnis fand in Literaturkreisen aber nicht nur Anklang sondern erweckte auch Kritiker. So hatte Khakzadeh-Leiler24 mMn zu Recht festgehalten, dass aus einer wörtlichen und systematischen Interpretation der betreffenden Bestimmungen hervorgeht, dass der Gesetzgeber hier gerade kein DRM vorgesehen hat. Darüber hinaus sprechen auch die Materialien zum KindRÄG 2001 dafür, dass sich der Gesetzgeber bewusst gegen eine Regelung des DRM entschieden hat. In diesen Materialien legte er das Residenzmodell mit dem Grundsatz des Heimes erster Ordnung fest, ohne das DRM als Ausnahmefall anzuführen.25 Auch im KindNamRÄG 2013 wurde an dieser Ansicht nichts geändert, womit sich auch hier der Gesetzgeber neuerlich indirekt gegen die Einführung eines DRM aussprach. Khakzadeh-Leiler26 kritisiert nicht die Zulässigkeit des DRM als solche, sondern vielmehr den Lösungsweg, den der VfGH gewählt hat. Ihrer Ansicht nach hätte der VfGH vielmehr die betreffenden Bestimmungen aufheben müssen. Zu Recht weist Schoditsch27 in Bezug auf das rezente Erkenntnis auch auf ein verfassungsrechtliches Problem hin: Der VfGH wurde durch das B-VG als negativer Gesetzgeber konzipiert, mit der Kompetenz verfassungswidrige Gesetze aufzuheben. Im Erkenntnis hebe der VfGH nach Ansicht Schoditschs allerdings nicht ein verfassungswidriges Gesetz auf, vielmehr erzeuge er selbst eine neue Regelung. Die Erzeugung von Gesetzen ist aber nicht dem VfGH oder sonstigen Gerichten vorbehalten, sondern ausschließlich dem Gesetzgeber, dem Parlament. Letztlich habe aber der VfGH und OGH das DRM eigenhändig eingeführt und somit Recht geschaffen. Hierbei könne nicht mehr von einem negativen Gesetzgeber gesprochen werden. Vielmehr übernehme der VfGH und OGH 23 VfGH 09.10.2015, G 152/2015. 24 Khakzadeh-Leiler, Doppelresidenz eines Kindes kann zulässig sein, EF-Z 2016 H 1, 35 (38). 25 Khakzadeh-Leiler, Doppelresidenz eines Kindes kann zulässig sein, EF-Z 2016 H 1, 35 (38). 26 Khakzadeh-Leiler, Doppelresidenz eines Kindes kann zulässig sein, EF-Z 2016 H 1, 35 (38). 27 Schoditsch, Grundfragen des Doppelresidenz-Modells, ÖJZ 2019 H 18, 801 (803). 19. Mai 2020 13/41
hier die Rolle des Gesetzgebers: »Sie werden zu neuen Gesetzgebern im
Familienrecht«.28
Kritik gab es auch zu dem vom VfGH angewandten Prüfungsmaßstab, denn im
Erkenntnis führte der VfGH aus, dass die gleichteilige Betreuung von den Eltern
vereinbart oder vom Gericht festgelegt werden kann, wenn „dies aus der Sicht
des Gerichtes dem Kindeswohl am besten entspricht“29. Grundsätzlich ist in
§ 190 Abs 2 ABGB aber folgender Prüfungsmaßstab vorgegeben:
§190 (1) Die Eltern haben bei Vereinbarungen über die Obsorge, die
persönlichen Kontakte sowie die Betreuung des Kindes das Wohl des
Kindes bestmöglich zu wahren.
Abs (2) Die Bestimmung der Obsorge (§ 177 Abs. 2) und vor Gericht
geschlossene Vereinbarungen nach Abs. 1 bedürfen zu ihrer
Rechtswirksamkeit keiner gerichtlichen Genehmigung. Das Gericht hat die
Bestimmung der Obsorge und Vereinbarungen der Eltern aber für
unwirksam zu erklären und zugleich eine davon abweichende Anordnung
zu treffen, wenn ansonsten das Kindeswohl gefährdet wäre.
Hiernach ist eine derartige Vereinbarung vom Gericht nur bei sonstiger
Gefährdung des Kindeswohls für unwirksam zu erklären. Beck30 sieht es nicht
bereits dann als zulässig eine von der Vereinbarung abweichende Anordnung
zu treffen, wenn diese für das Kindeswohl besser wäre, sondern eben erst –
wie in § 190 Abs 2 ABGB vorgesehen – wenn sonst das Kindeswohl gefährdet
wäre.
In diesem Erkenntnis wandte der VfGH einen neuartigen Prüfungsmaßstab an,
in dem das Gericht zu prüfen hat, ob die Vereinbarung der Doppelresidenz
durch die Eltern im konkreten Fall dem Kindeswohl am besten entspricht.
Dieses Vorgehen widerspricht jedoch dem Wortlaut des § 190 Abs 2 ABGB.31
MMn ist das Erkenntnis des VfGH nicht mit den Vorstellungen des
Gesetzgebers in Einklang zu bringen. Es sei dahingestellt, dass
Interpretationen immer einen gewissen Spielraum eröffnen, um den Inhalt
entsprechender Bestimmungen zu erweitern oder klarer abzugrenzen, jedoch
hat diese Interpretation durch den VfGH nach meinem Empfinden nichts mehr
mit einer Interpretation im herkömmlichen Sinne gemein. Vielmehr wird dadurch
28
Schoditsch, Grundfragen des Doppelresidenz-Modells, ÖJZ 2019 H 18, 801 (803).
29
VfGH 09.10.2015, G 152/2015.
30
Beck, Doppelresidenz: Der Vorhang zu und alle Fragen offen?, iFamZ 2015 H 6, 264 (267).
31
Beck, Doppelresidenz: Der Vorhang zu und alle Fragen offen?, iFamZ 2015 H 6, 264 (267f).
19. Mai 2020 14/41genau das ermöglicht, was der Gesetzgeber bewusst nicht geregelt hat. Denn
wie bereits oben angeführt, zeigen die Materialien zum KindRÄG2001, dass
das DRM zwar angedacht wurde, aber dennoch nur das Residenzmodell
gesetzlich verankert wurde. Es liegt hier mAn auch keine planwidrige Lücke vor,
die geschlossen werden müsste. Vielmehr hat sich der Gesetzgeber bewusst
gegen das DRM entschieden.
Die Konsequenz dieses Erkenntnisses ist mMn, dass die konkreten
gesetzlichen Normen ihren „Wert“ verlieren. Obwohl das DRM im Gesetz nicht
geregelt ist, wird es dennoch von den Gerichten als zulässig erachtet, somit
scheint beinahe gleichgültig zu sein, was das Gesetz vorsieht. Das ist für mich
nicht mit dem Verständnis eines funktionierenden Rechtssystems zu
vereinbaren.
Der VfGH leitet durch dieses Erkenntnis eine richterliche Rechtsfortbildung ein,
die der OGH fortführt.
Es besteht keine Bindung der Gerichte an eine verfassungskonforme
Normauslegung des VfGH. Dennoch schloss sich der OGH dem VfGH an und
betonte in seinen Entscheidungen die Zulässigkeit des DRM aufgrund einer
verfassungskonformen Interpretation der §§177 ff ABGB. Der OGH erachtete
wie der VfGH die Festlegung des hauptsächlichen Betreuungsortes zumindest
als nominellen Anknüpfungspunkt weiterhin bei gleichteiliger Betreuung für
notwendig. Er verpflichtete in weiterer Folge die Gerichte zur Einhaltung einer
speziellen Spruchformel. In der E 9 Ob 82/16y ordnete er explizit an, dass
Hinweise auf die mit der nominellen Anknüpfung verbundenen Rechte in den
Spruch aufzunehmen sind.32
D. Voraussetzungen des DRM
Nicht nur Richter wurden in den vergangenen Jahren immer häufiger mit dem
Thema Doppelresidenz konfrontiert, auch psychologische Sachverständige
waren dazu angehalten, sich mit diesem Modell näher auseinanderzusetzen.
32
Schoditsch, Grundfragen des Doppelresidenz-Modells, ÖJZ 2019 H 18, 801 (802).
19. Mai 2020 15/41Folgende Kriterien für eine gutachterliche Empfehlung der Doppelresidenz
wurden dabei ausgearbeitet:
räumliche Voraussetzungen,
elterliche Erziehungsfähigkeit,
elterliche Kooperation und elterliches Konfliktverhalten,
Eltern-Kind- Beziehungen,
Alter und Entwicklungsstand des Kindes
Wille des Kindes33
Eine grundlegende Voraussetzung dafür, dass sich das DRM in der Praxis
umsetzen lässt ist eine zumutbare Entfernung zwischen den beiden
Wohnstätten der Eltern. Nur wenn die räumliche Distanz einen häufigen
Wohnortwechsel des Kindes ohne besondere Erschwernisse zulässt bietet sich
die Möglichkeit eines DRM überhaupt erst an.34 Ob es sich um eine zumutbare
Entfernung handelt, ist immer im Einzelfall zu entscheiden, festgeschriebene
Distanzen wären hierbei nicht zielführend.
Beim Kriterium der elterlichen Erziehungsfähigkeit ist erheblich, ob beide
Elternteile dem Kind eine angemessene Erziehung und einen dem Kindeswohl
entsprechenden Alltag gewährleisten können.35
Wesentlich ist auch die Kooperationsfähigkeit der Eltern. Es ist insb erforderlich,
dass die Eltern dazu in der Lage sind sich relevante Informationen über das
Kind gegenseitig mitzuteilen. Ebenso müssen beide Elternteile fähig sein nicht
die Entscheidungen des anderen im täglichen Leben anzuzweifeln und zu
bekämpfen. Insb fortwirkende Entscheidungen wie bspw die Anmeldung zu
einem Sportkurs sollten vom anderen Elternteil respektiert werden, damit das
Kind die Möglichkeit hat, den Kurs auch dann zu besuchen, wenn es sich beim
anderen Elternteil aufhält.36
Beim Kriterium der Eltern-Kind- Beziehung ist die Zeit vor der Scheidung oder
Auflösung der häuslichen Gemeinschaft ausschlaggebend. Es geht hierbei
33
Khalili-Langer, Doppelresidenz und psychologische Begutachtung, iFamZ 2017 H 5, 356
(356).
34
Khalili-Langer, Doppelresidenz und psychologische Begutachtung, iFamZ 2017 H 5, 356
(356).
35
Khalili-Langer, Doppelresidenz und psychologische Begutachtung, iFamZ 2017 H 5, 356
(356).
36
Khalili-Langer, Doppelresidenz und psychologische Begutachtung, iFamZ 2017 H 5, 356
(356f).
19. Mai 2020 16/41darum, dass sich die Betreuungssituationen durch die Eltern vor und nach der Scheidung ähneln sollten, um eine „Betreuungskontinuität“ zu wahren. Nur, wenn auch vor der Scheidung zu beiden Elternteilen eine intensive Beziehung bestand, und beide eine wichtige Ansprechperson für das Kind darstellten, soll dies auch nach der Scheidung erhalten bleiben, und dies durch eine Doppelresidenzregelung ermöglicht werden. Andernfalls ist von einer derartigen Regelung abzuraten, da dies dazu führen würde, dass das Kind mit jenem Elternteil, zu dem vor der Scheidung kaum eine intensive emotionale Bindung bestand, nun mehr Zeit verbringen müsste und dafür weniger Kontakt zu ihrer eigentlichen emotionalen Ansprechperson hätte. Dies ist vor allem dann der Fall, wenn der eine Elternteil die meiste Zeit gearbeitet hat und kaum zu Hause war, während der andere Elternteil fast gänzlich das Kind allein betreut hat und dadurch zu diesem eine engere Bindung besteht. Insgesamt ist es also von Bedeutung, dass die familiären Strukturen nach der Scheidung so gut wie möglich jenen vor Auflösung des gemeinsamen Haushalts entsprechen. 37 Ausschlaggebend für das Funktionieren des DRM ist auch das Alter bzw der Entwicklungsstand des Kindes. Auch wenn es keine generelle Altersgrenze gibt, bei der man davon ausgehen kann, dass das Praktizieren der Doppelresidenz problemlos möglich ist, wird zumeist im Kreise der Entwicklungspsychologen das vierte bzw fünfte Lebensjahr des Kindes als Untergrenze angesehen.38 Wie auch überall sonst im Kindschaftsrecht steht auch hier der Wille des Kindes an oberster Stelle. Nur wenn das DRM dem Kindeswillen entspricht wird es auch erfolgreich sein. Auch dieses Kriterium hängt stark vom Alter des Kindes ab, denn je älter es ist, desto eindeutiger kann es seine Meinung dazu äußern.39 MMn ist jedenfalls neben einer geringen räumlichen Distanz va eine ausreichende Kooperationsfähigkeit der Schlüssel zum Erfolg des Doppelresidenzmodelles. Im Gegensatz zur bloßen Ausübung des Kontaktrechts durch den Geldunterhaltspflichtigen im Residenzmodell, bei dem 37 Khalili-Langer, Doppelresidenz und psychologische Begutachtung, iFamZ 2017 H 5, 356 (357). 38 Khalili-Langer, Doppelresidenz und psychologische Begutachtung, iFamZ 2017 H 5, 356 (357). 39 Khalili-Langer, Doppelresidenz und psychologische Begutachtung, iFamZ 2017 H 5, 356 (357f). 19. Mai 2020 17/41
durch die fixen Besuchszeiten kaum zusätzlicher Kommunikationsbedarf
zwischen den beiden Elternteilen besteht, ist es beim DRM häufig notwendig,
zusätzlich Kontakt zum anderen Elternteil aufzunehmen. Va um diverse
Alltagsentscheidungen adäquat regeln zu können, da es zu vermeiden gilt,
ständig das Kind als Boten einzusetzen. Nur wenn die Eltern ein gutes
Verhältnis zueinander haben, wird eine nahezu reibungslose Umsetzung
möglich sein.
Liegen die Voraussetzungen für die Ausübung des DRM vor, so können sich
durch diese Betreuungsform zahlreiche Vorteile ergeben, ua:
»Intensive Emotionale Bindung der Kinder an beide Eltern
Bessere psychische Entwicklung der Kinder
Bessere soziale Situation der Kinder und Schulsituation
Gleichmäßiger Kontakt zu beiden Eltern (infolge dessen auch besserer
Kontakt zu Großeltern u.a. Verwandten)
Zwei gleichwertige Zuhause (Lebensmittelpunkte)
Bessere physische Gesundheit bei Eltern und Kindern
Deeskalation zwischen den Eltern im Trennungskonflikt und Vermeidung
oder Beendigung eines gerichtlichen Sorgerechtsstreits
Vermeidung/ Reduktion von Loyalitätskonflikten des Kindes
Verbesserung der Beziehung zw. den Eltern (Co-Parenting)
Teilhabe der Kinder an den Ressourcen beider Eltern
Reduktion der Doppelbelastung (Arbeit + Kinderbetreuung) durch
Verteilung der Belastungen auf beide Eltern
Ökonomische Besserstellung der Kinder durch Teilhabe an finanziellen
Ressourcen beider Eltern und Erwerbsmöglichkeit beider Eltern
Gleichberechtigte Geschlechterrollen als Vorbild
Erlernen von Mobilität und Selbstorganisation der Kinder
Zufriedenheit mit dem Betreuungsmodell und der familiären Situation bei
Müttern, Vätern und Kindern«40
40
Sünderhauf, Wechselmodell (2013) 599.
19. Mai 2020 18/41Trotz dieser Vorteile können sich durch das DRM aber auch Nachteile ergeben,
so bspw:
»Einschränkung der Elternmobilität (erforderliche Wohnortnähe)
Organisatorischer Mehraufwand, um in zwei Wohnungen zuhause zu
sein (Wohnungsausstattung und Gepäck)
Verlust von Unterhaltsansprüchen (Betreuungs- u. Kindesunterhalt)«41
E. Internationale Verbreitung
Der Bedarf einer gesetzlichen Regelung des DRM in Österreich ist zweifelsfrei
gegeben, dies nicht nur aufgrund der stetig steigenden Beliebtheit dieses
Modells in der Gesellschaft, sondern auch um die Rechtssicherheit zu wahren.
Bereits im Oktober 2015 verabschiedete die parlamentarische Versammlung
des Europarates einstimmig die Resolution 2079, in der die Mitgliedstaaten
dazu aufgefordert werden, das DRM in ihre Gesetze aufzunehmen. In dieser
Resolution wird überdies gefordert, dass das DRM das Regelmodell nach der
Scheidung darstellen soll und nur bei gravierenden Fällen Ausnahmen vom
Grundsatz des DRM zur Anwendung kommen sollen, dies bspw bei
Kindesmisshandlung oder Vernachlässigung.
Diese Resolution begründet aber keine Verbindlichkeit zur Umsetzung, sie stellt
bloß einen politischen Beschluss dar.42
41
Sünderhauf, Wechselmodell (2013) 600.
42
Deutscher Bundestag, Fragen zum Wechselmodell,12.
(27.11.2019)
19. Mai 2020 19/41Nachstehend ein Überblick über die internationale Verbreitung des DRM:
Staat Regelung zum DRM
Schweden Gesetzlicher Regelfall
Norwegen Gesetzlicher Regelfall
Belgien Gesetzlicher Regelfall
Frankreich Gesetzliche Alternative
Deutschland Nicht gesetzlich verankert
Italien Gesetzlicher Regelfall soweit das
Kindeswohl dem nicht entgegensteht
43
Tabelle 1: Internationale Verbreitung
IV. Kindesunterhalt im Allgemeinen
A. §231 ABGB
Rechtsgrundlage für den Kindesunterhalt ist § 231 ABGB.
§ 231. (1) Die Eltern haben zur Deckung der ihren Lebensverhältnissen
angemessenen Bedürfnisse des Kindes unter Berücksichtigung seiner
Anlagen, Fähigkeiten, Neigungen und Entwicklungsmöglichkeiten nach
ihren Kräften anteilig beizutragen.
(2) Der Elternteil, der den Haushalt führt, in dem er das Kind betreut, leistet
dadurch seinen Beitrag. Darüber hinaus hat er zum Unterhalt des Kindes
beizutragen, soweit der andere Elternteil zur vollen Deckung der
Bedürfnisse des Kindes nicht imstande ist oder mehr leisten müsste, als es
seinen eigenen Lebensverhältnissen angemessen wäre.
(3) Der Anspruch auf Unterhalt mindert sich insoweit, als das Kind eigene
Einkünfte hat oder unter Berücksichtigung seiner Lebensverhältnisse
selbsterhaltungsfähig ist.
Voraussetzung für den Unterhaltsanspruch des Kindes gegen den
Geldunterhaltspflichtigen ist neben der zumindest teilweisen
Einkommenslosigkeit des Kindes, dass es noch nicht selbsterhaltungsfähig
ist.44
43
Deutscher Bundestag, Fragen zum Wechselmodell,13f
(27.11.2019).
44
Schwimann/Kolmasch, Unterhaltsrecht (2019) 111.
19. Mai 2020 20/41Die Unterhaltspflicht der Eltern gegenüber dem Kind beginnt bereits ab Geburt des unterhaltsberechtigten Kindes und endet spätestens mit dem Tod des Kindes, beziehungsweise schon früher bei Erreichen der Selbsterhaltungsfähigkeit.45 Die Selbsterhaltungsfähigkeit wird grundsätzlich dann angenommen, wenn das Kind die zur Deckung seines Unterhalts erforderlichen Mittel selbst erwirbt oder zu erwerben imstande ist, es also in der Lage ist, seine gesamten Lebensbedürfnisse angemessen aus eigenem Einkommen zu decken. 46 Der Eintritt der Selbsterhaltungsfähigkeit ist unabhängig vom Alter des Kindes.47 Nach § 231 Abs 1 steht nicht selbsterhaltungsfähigen Kindern ein Anspruch auf angemessenen Unterhalt zu. Die Elternteile haben zur Deckung dieses angemessenen Unterhalts anteilig beizutragen. 48 § 231 Abs 2 ABGB besagt, dass jener Elternteil, der das Kind im Haushalt betreut, bereits dadurch seinen Beitrag leistet. Die Betreuung des Kindes im eigenen Haushalt wird somit vom Gesetzgeber als vollwertiger Unterhaltsbeitrag angesehen und einer Geldunterhaltsleistung gleichgestellt. 49 Die Haushaltstrennung der Eltern führe somit in dem Regelfall, den der Gesetzgeber vor Augen hatte, dazu, dass sich zwei verschiedene Aufgaben ergeben. Zum einen eine persönliche Betreuung, die jener Elternteil übernimmt, der mit dem Kind im gemeinsamen Haushalt lebt, und zum anderen die Finanzierung der Aufwendungen die durch die persönliche Betreuung entstehen durch den anderen Elternteil.50 In den Ausnahmefällen des § 231 Abs 2 Satz 2 ABGB ist der betreuende Elternteil darüber hinaus auch noch zu Geldunterhalt verpflichtet. 45 Schwimann/Kolmasch, Unterhaltsrecht (2019)112. 46 OGH 12.01.1993, 4 Ob 502/93. 47 Schwimann/Kolmasch, Unterhaltsrecht (2019)183. 48 Schwimman/Kolmasch, Unterhaltsrecht (2019)111. 49 Schwimann/Kolmasch, Unterhaltsrecht (2019)117. 50 OGH 29.01.2002, 1Ob305/01m. 19. Mai 2020 21/41
B. Unterhaltsbedarf
Ausschlaggebend für das Ausmaß des Unterhaltsanspruches sind zum einen
die Leistungsfähigkeit der Unterhaltspflichtigen und zum anderen der Bedarf
des Kindes.
Durch den Unterhalt soll grundsätzlich der gesamte Lebensbedarf des Kindes
gedeckt werden. Welche konkreten Lebensbedürfnisse ein Kind hat, hängt va
vom Alter ab. Unterschieden wird hierbei zwischen Regel- und Sonderbedarf.51
Regelbedarf ist jener Bedarf, «den jedes Kind einer bestimmten Altersstufe in
Österreich ohne Rücksicht auf die konkreten Lebensverhältnisse seiner Eltern
an Nahrung, Kleidung, Wohnung und zur Bestreitung der weiteren Bedürfnisse,
wie etwa kulturelle und sportliche Betätigung, sonstige Freizeitgestaltung und
Urlaub hat.»52
Sonderbedarf hingegen ist gekennzeichnet durch Außergewöhnlichkeit,
Dringlichkeit und Individualität. Dazu zählen ua besondere Ausbildungskosten
und medizinische Sonderkosten.53
Entscheidend für den Bedarf ist die Angemessenheit, der Bedarf muss hierbei
nicht nur in Hinblick auf die Lebensverhältnisse der Eltern angemessen sein,
sondern auch den Anlagen, Fähigkeiten, Neigungen und
Entwicklungsmöglichkeiten des Kindes entsprechen.54
Jährlich werden mit 1. Juli für ein Jahr die Regelbedarfssätze festgeschrieben,
nachfolgend die aktuellen Bedarfssätze gültig von 01.07.2019 bis 30.06.2020:
Alter Betrag in €
00-03 Jahre 212,00
03-06 Jahre 272,00
06-10 Jahre 350,00
10-15 Jahre 399,00
15-19 Jahre 471,00
19-28 Jahre 590,00
55
Tabelle 2: Regelbedarfssätze
51
Limberg in Kletečka/Schauer, ABGB-ON § 231 RZ 2 und 3 (Version 1.06 Stand 1.10.2018).
52
Gitschthaler, Unterhaltsrecht (2015) RZ 571.
53
Limberg in Kletečka/Schauer, ABGB-ON § 231 RZ 7 (Version 1.06 Stand 1.10.2018).
54
Limberg in Kletečka/Schauer, ABGB-ON § 231 RZ 5 (Version 1.06 Stand 1.10.2018).
55
(27.11.2019).
19. Mai 2020 22/41Beim Regelbedarf wird rein auf den Bedarf eines durchschnittlichen Kindes einer bestimmten Altersgruppe abgestellt, die Leistungsfähigkeit der Eltern hingegen wird außer Acht gelassen.56 Die Regelbedarfssätze sind für die Unterhaltsbemessung nicht von allzu großer Bedeutung, sie sind eher als Kontrollgröße zu verstehen. Vielmehr wird die Prozentwertmethode (hierzu siehe IV.D.) herangezogen.57 C. Art der Unterhaltsgewährung Während aufrechter Ehe bzw häuslicher Gemeinschaft ist der Kindesunterhalt grundsätzlich in Natura zu gewähren. Durch den Naturalunterhalt werden die Bedürfnisse des Kindes unmittelbar durch Sach-oder Dienstleistungen gedeckt. Unerheblich ist hierbei ob diese Leistungen durch den Unterhaltspflichtigen selbst erbracht werden, oder ob er einen Dritten für die Erbringung bezahlt. 58 Nach der Scheidung oder Auflösung der häuslichen Gemeinschaft ist hingegen Geldunterhalt zu leisten, es kommt also zur Wandlung des Naturalunterhaltsanspruches in einen Geldunterhaltsanspruch des Kindes.59 Diese Wandlung ist darin begründet, dass es durch die Auflösung der häuslichen Gemeinschaft für denjenigen Unterhaltspflichtigen, der nicht im gemeinsamen Haushalt mit dem Kind lebt, erheblich schwieriger wird, angemessene Naturalleistungen zu erbringen.60 Anspruchsberechtigt ist das Kind selbst. Der Unterhalt ist gem § 1418 ABGB am Monatsersten fällig, da dieser dem Unterhaltsberechtigten jeden Monat zur Verfügung stehen muss.61 56 Gitschthaler, Unterhaltsrecht (2015) RZ 571. 57 Limberg in Kletečka/Schauer, ABGB-ON § 231 RZ 6 (Version 1.06 Stand 1.10.2018). 58 Limberg in Kletečka/Schauer, ABGB-ON § 231 RZ 16 und 17 (Version 1.06 Stand 1.10.2018). 59 Neuhauser in Deixler-Hübner (Hrsg) Handbuch Familienrecht (2015) 388. 60 Schwimann/Kolmasch, Unterhaltsrecht (2019) 197. 61 Gitschthaler, Unterhaltsrecht (2015) RZ 36f. 19. Mai 2020 23/41
D. Unterhaltsbemessungsgrundlage und Unterhaltshöhe
Bemessungsgrundlage für den Kindesunterhalt ist grundsätzlich das
tatsächliche Nettoeinkommen des Unterhaltspflichtigen.62
Ungeachtet dessen, dass bei Festsetzung des Kindesunterhaltes immer auf die
Umstände des Einzelfalles Bedacht zu nehmen ist, kann in einer Vielzahl von
Fällen auf die von der Rsp entwickelten Prozentwertmethode zurückgegriffen
werden. Hierbei sind Prozentsätze in Abhängigkeit vom Alter festgelegt
worden.63
Prozent des monatlichen
Alter
Nettoeinkommens
00-06 Jahre 16%
06-10 Jahre 18%
10-15 Jahre 20%
Ab 15 Jahre 22%
64
Tabelle 3: Prozentsätze
V. Betreuungsrechtliches Unterhaltsmodell der Rechtsprechung
A. Drei Betreuungsmodelle
Die Rsp hat drei unterhaltsrechtliche Betreuungsmodelle entwickelt: Betreuung
im üblichen Ausmaß, Betreuung im unüblichen Ausmaß und etwa gleichteilige
Betreuung. Letzteres wird wie bereits unter III. A. ausgeführt, als
Doppelresidenz bezeichnet.
Der Erläuterung der einzelnen Modelle ist vorauszuschicken, dass es hierbei
nicht darauf ankommt ob gemeinsame Obsorge besteht. Allein die tatsächliche
Betreuung ist entscheidend.65
62
Kolmasch in Loderbauer (Hrsg), Kinder-und Jugendrecht (2016) 41.
63
Gitschthaler, Unterhaltsrecht (2015) RZ 541.
64
(27.11.2019).
65
Gitschthaler, Unterhaltsrecht (2015) RZ 88.
19. Mai 2020 24/411. Betreuung im üblichen Ausmaß Von Betreuung im üblichen Ausmaß wird gesprochen, wenn ein Elternteil das Kind hauptsächlich betreut und damit bereits seinen Unterhalt leistet und der andere Elternteil bloß sein übliches Kontaktrecht ausübt und dadurch zu Geldunterhaltsleistungen verpflichtet ist. Die Betreuung durch den geldunterhaltspflichtigen Elternteil gilt als üblich, wenn alle zwei Wochen an den Wochenenden Besuche stattfinden. Darüber hinaus besteht in den Ferien die Möglichkeit von vier Wochen zusätzlichen Besuchsrechts. In Tagen gerechnet ergibt sich somit ein Spielraum von 52 bis 80 Tagen pro Jahr. Betreut der geldunterhaltspflichtige Elternteil sein Kind zwischen 52 und 80 Tagen pro Jahr so gilt diese Betreuung als üblich und hat somit keine Änderungen an seiner Geldunterhaltspflicht zur Folge.66 Dieses Betreuungsmodell ist trotz des stark wachsenden Interesses an gleichteiliger Betreuung immer noch sehr beliebt und sozusagen das Standardmodell. 2. Betreuung im unüblichen Ausmaß Betreuung im unüblichen Ausmaß liegt vor, wenn die Betreuung durch den geldunterhaltspflichtigen Elternteil über das Ausmaß der üblichen Betreuung hinausgeht. Aus dieser überdurchschnittlichen Betreuung folgt eine Reduktion der Geldunterhaltspflicht. Zur Berechnung wird die sog Prozentabzugsmethode herangezogen.67 Dieses Modell kommt zur Anwendung, wenn das Kind an mehr als 80 Tagen im Jahr durch den geldunterhaltspflichtigen Elternteil betreut wird. Es entwickelte sich eine 10%-Rechtsprechung bei der die Unterhaltspflicht um 10% pro zusätzlichen Betreuungstag in der Woche reduziert wird. Ausgangspunkt sind hierbei aber nicht 80 Tage, sondern 52 Tage pro Jahr.68 Zum Beispiel betreut der geldunterhaltspflichtige Vater sein Kind im Durchschnitt an 104 Tagen im Jahr sind von diesen 104 Tagen 52 Tage als übliches Betreuungsausmaß abzuziehen. Die Differenz von 52 muss durch die 66 Gitschthaler, Kinderbetreuung und Kindesunterhalt - ein Überblick, EF-Z 2018 H 1, 11 (11). 67 Gitschthaler, Kinderbetreuung und Kindesunterhalt - ein Überblick EF-Z 2018 H 1, 11 (11). 68 Gitschthaler, Kinderbetreuung und Kindesunterhalt - ein Überblick , EF-Z 2018 H 1, 11 (11f). 19. Mai 2020 25/41
Anzahl der Wochen eines Jahres, demnach 52, dividiert werden. Das Ergebnis
beträgt 1, somit wird das Kind durch den Vater um einen Tag mehr als üblich
pro Woche betreut. Dieser Betreuungstag pro Woche, der über dem üblichen
Ausmaß liegt, führt dann zu einer 10-prozentigen Reduktion der
Geldunterhaltspflicht. Relevant sind grundsätzlich ganze Tage, mitunter können
aber auch halbe Tage herangezogen werden. Außer Acht zu lassen sind
jedenfalls einzelne Stunden, die über das übliche Maß hinausgehen.69
Sinn dieser Rsp ist es, dem geldunterhaltspflichtigen Elternteil, der das Kind
überdurchschnittlich häufig betreut, durch eine Reduktion der Unterhaltspflicht
entgegen zu kommen.
Aber je höher die Anzahl der Betreuungstage pro Woche ist desto weniger
erscheint die 10%-Rechtsprechung als passend. In der E 5 Ob 2/12y wurde in
treffender Weise festgehalten, dass die 10%- Rechtsprechung tendenziell eher
eine Untergrenze signalisiert und nur als Richtschnur dient. Nähert sich die
Betreuungssituation aber einer gleichwertigen Betreuung an, wird diese
Abzugsmethode der Betreuung durch den Geldunterhaltspflichtigen nicht mehr
gerecht. Daher erfolgte hier eine 20-prozentige Reduktion der
Geldunterhaltspflicht pro zusätzlichem Betreuungstag.70
Die Anwendung der Prozentabzugsmethode im Falle der gleichteiligen
Betreuung durch beide Elternteile würde insofern nicht gerecht erscheinen, als
die Geldunterhaltspflicht eines Elternteiles aufrecht bliebe, obwohl beide
gleichwertige Betreuungsleistungen erbringen.
3. Gleichteilige Betreuung, Betreuungsrechtliches Unterhaltsmodell
Die bei der Betreuung im unüblichen Ausmaß angewandte
Prozentabzugsmethode der Rsp ist wie bereits oben erwähnt bei gleichteiliger
Betreuung nicht zielführend. Um den Unterschieden dieser Betreuungsmodelle
gerecht zu werden, entwickelte die Lehre das sog betreuungsrechtliche
Unterhaltsmodell.
Hintergedanke hierbei ist, dass gem § 231 Abs 2 ABGB (wie bereits unter IV. A.
erläutert) dem hauptsächlich betreuenden Elternteil eine Unterhaltsbefreiung
69
Gitschthaler, Kinderbetreuung und Kindesunterhalt - ein Überblick , EF-Z 2018 H 1, 11 (12).
70
Gitschthaler, Kinderbetreuung und Kindesunterhalt - ein Überblick , EF-Z 2018 H 1, 11 (12).
19. Mai 2020 26/41zukommt. Bei gleichteiliger Betreuung gibt es aber einen solchen
Domizilelternteil nicht. Um diesem Umstand Rechnung zu tragen, kann daher
das Unterhaltsprivileg des § 231 Abs 2 ABGB nicht nur für einen Elternteil
Anwendung finden, sondern müssen beide gleichermaßen von der
71
Verpflichtung Geldunterhalt zu leisten, befreit werden.
B. Anwendungsvoraussetzungen für das betreuungsrechtliche
Unterhaltsmodell
Nach Rsp des OGH erfordert die Anwendung des betreuungsrechtlichen
Unterhaltsmodells ganz allgemein eine nahezu gleichwertige Betreuung durch
beide Elternteile im zeitlichen Sinne. Darüber hinaus sind auch annähernd
gleichwertige Naturalleistungen erforderlich. Zusätzlich ist auch das Einkommen
der Eltern ein wichtiger Aspekt.72
1. Gleichwertige Betreuungsleistungen
Wann die Betreuungsleistungen tatsächlich als gleichwertig angesehen werden
wurde jedoch vom OGH in den letzten Jahren unterschiedlich beantwortet.
So nahm er in seiner E 4 Ob 16/13a vom März 2013 eine etwa gleichteilige
Betreuung an, wenn „kein Elternteil mindestens zwei Drittel der Betreuung
durchführt“, somit bei einem Verhältnis von 2:1.73
Auf diese E folgte Kritik aus der Literatur. Schwimann und Kolmasch74
wendeten diesbezüglich ein, «dass eine faire Lösung nicht darin liegen kann,
den Fall, in dem kein Elternteil geldunterhaltspflichtig ist, durch eine
nivellierende Betrachtung von mehr als bloß geringfügigen […]
Betreuungsunterschieden möglichst weit auszudehnen.»
Bereits Ende 2015 ging der OGH in der E 8 Ob 69/15b von der ursprünglichen
Definition der gleichteiligen Betreuung wieder ab, und wandte bei einer
71
Gitschthaler, Kinderbetreuung und Kindesunterhalt - ein Überblick, EF-Z 2018 H 1, 11 (12).
72
Rohrer/Gruber, Das unterhaltsrechtliche Betreuungsmodell ÖJZ 2018 H 9 414 (418).
73
Schoditsch, Grundfragen des Doppelresidenz-Modells, ÖJZ 2019 H 18, 801 (805).
74
Schwimann/Kolmasch, Unterhaltsrecht (2019) 121f.
19. Mai 2020 27/41Betreuungsleistung im Ausmaß von 34% die Prozentabzugsmethode statt dem betreuungsrechtlichen Unterhaltsmodell an.75 Im Jahr 2016 forderte der OGH in der E 4 Ob 206/15w ein Verhältnis von 4:3 an Betreuungstagen um von einer annähernd gleichteiligen Betreuung ausgehen zu können.76 In Bezugnahme auf die oben erwähnte Kritik aus der Literatur, hielt der OGH in einer späteren E fest, dass «eine Differenz von einem Drittel zwischen den jeweiligen Betreuungsleistungen einen nicht unbeträchtlichen Abstand zu einer annähernd gleichteiligen Betreuung schafft.»77 Vereinzelt forderte der OGH völlig gleichwertige Betreuungsleistungen. Begründet wurde dies aber nicht. 78 Wiederum ein Jahr später hält der OGH in seiner E 8 Ob 89/17x fest, dass von gleichwertigen Betreuungsleistungen nur bei ganz geringfügigen Unterschieden auszugehen ist, sie somit „nahezu gleichwertig“ sind.79 Letztlich wird es aber auf ein Verhältnis von 4:3 ankommen.80 Wie aber Gitschthaler81 bereits 2016 zutreffend festgehalten hat, sind immer die konkreten Umstände entscheidend und es ist daher von fixen Prozentsätzen für die Anwendung des betreuungsrechtlichen Unterhaltsmodells abzusehen. 2. Gleich hohes Einkommen Für die Anwendung des betreuungsrechtlichen Unterhaltsmodelles und damit in weiterer Folge für den Entfall der Geldunterhaltspflicht, muss auch das Einkommen in etwa gleich hoch sein. Von einem gleich hohen Einkommen ist auch noch bei Unterschieden von nicht mehr als einem Drittel auszugehen.82 Einer anderen Beurteilung bedürfen jedoch Fälle, in denen zwar beide Elternteile das Kind zu gleichen Teilen betreuen, aber über unterschiedlich 75 Gitschthaler, gleichteilige Betreuung jedenfalls bei 4:3, EF-Z 2016 H 3, 151 (152). 76 Gitschthaler, gleichteilige Betreuung jedenfalls bei 4:3, EF-Z 2016 H 3, 151 (152). 77 OGH 23.02.2016, 4 Ob 206/15w. 78 OGH 13.10.2016, 7 Ob 172/16v. 79 Gitschthaler, Kinderbetreuung und Kindesunterhalt - ein Überblick, EF-Z 2018 H 1, 11 (12). 80 Gitschthaler, Kinderbetreuung und Kindesunterhalt - ein Überblick, EF-Z 2018 H 1, 11 (12). 81 Gitschthaler, fließende Grenzen gemeinsamer Betreuung, EF-Z 2016 H 2, 91 (92). 82 Gruber, Gemeinsame Betreuung von Kindern und deren unterhaltsrechtliche Auswirkungen, ÖRPfl 2019 H 1, 10 (13). 19. Mai 2020 28/41
hohes Einkommen verfügen. Mit einem solchen Fall musste sich der OGH
erstmals in seiner E 1 Ob 158/15i auseinandersetzen.83
Demnach kommt trotz Einkommensdifferenzen das betreuungsrechtliche
Unterhaltsmodell zur Anwendung, doch steht dem Kind ein
Restgeldunterhaltsanspruch gegen den leistungsfähigeren Elternteil zu. Dieser
Restgeldunterhaltsanspruch bezweckt einen Ausgleich dafür, dass das Kind die
Zeit, die es beim schlechter verdienenden Elternteil verbringt, nur an einem
geringeren Lebensstandard teilhaben kann. Durch den zusätzlichen
Geldunterhaltsanspruch wird es dem Kind ermöglicht, auch in der Zeit, die es
beim schlechter verdienenden Elternteil verbringt, an dem höheren
84
Lebensstandard des anderen teilzuhaben.
Entscheidend für den Restgeldunterhaltsanspruch kann aber nach Neuhauser
nicht bloß das Einkommen an sich sein, da sonst andere relevante Umstände
außer Acht gelassen werden würden, bspw weitere Sorgepflichten für andere
Kinder des besserverdienenden Elternteils.85
Der OGH umgeht diese Problematik dadurch, dass er bei der Berechnung auf
die fiktive Unterhaltspflicht der Eltern abstellt. Er folgt dem Rechenansatz von
Neuhauser:
1. Ermittlung der fiktiven Unterhaltsansprüche des Kindes gegenüber den
Eltern nach der Prozentwertmethode
2. Aufteilung der Familienbeihilfe im Verhältnis dieser fiktiven
Geldunterhaltsansprüche und in weiterer Folge Abzug des
entsprechenden Anteils bei jenem Elternteil, der die Familienbeihilfe
nicht bezieht
3. Halbierung der ermittelten Beträge
4. Ermittlung der Differenz dieser beiden Beträge86
83
Gitschthaler, Das betreuungsrechtliche Unterhaltsmodell bei Einkommensdifferenzen, EF-Z
2016 H 3, 15 (15).
84
Schwimann/Kolmasch, Unterhaltsrecht (2019) 122.
85
Neuhauser in Schwimann/Kodek (Hrsg), ABGB Praxiskommentar Band 1 §231 RZ 490
(2018).
86
OGH 17.09.2015, 1 Ob 158/15i.
19. Mai 2020 29/41Sie können auch lesen