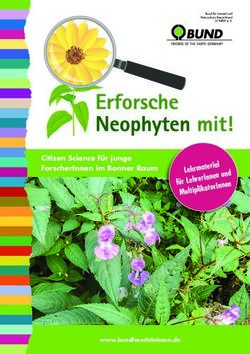Heft 18 / 2020 - Auenzentrum Neuburg-Ingolstadt
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Heft 18 / 2020 Auenmagazin Magazin des Auenzentrums Neuburg a. d. Donau In Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Landesamt für Umwelt
INHALT
INHALT
Perspektiven
Retentionspotenzialanalyse von Renaturierungsmassnahmen an bayerischen Gewässern4���������������������������� 4
Michael Neumayer, Sonja Teschemacher, Fabian Merk, Markus Disse
Der River Ecosystem Service Index in der Modellregion
„Donauauen zwischen Neu-Ulm und Donauwörth“...............................................................................................10
Marion Gelhaus, Kai Deutschmann, Barbara Stammel
Ergebnisse aus dem Projekt AQUACROSS...................................................................................................................17
Andrea Funk, Florian Borgwardt, Daniel Trauner, Javier Martínez-López, Kenneth J. Bagstad, Stefano Balbi,
Ainhoa Magrach, Ferdinando Villa, Thomas Hein
Berichte und Projekte
Nebenrinnen am Niederrhein – Raum für europäische Flussnatur an der Wasserstrasse2��������������������������21
Klaus Markgraf-Maué, Dr. Thomas Chrobock
Auenbewohner
Erfassung von Mollusken in den Donauauen zwischen Lech- und Usselmündung........................................27
Julia Sattler, Manfred Colling, Siegfried Geißler, Maria Nißl & Francis Foeckler
Laufkäfer – Ufer- und Auenbewohner......................................................................................................................36
Kathrin Januschke & Karsten Hannig
Aus der Forschung
Indikatoren zur Beurteilung von Eingriffen an Umlagerungsflüssen am Beispiel Obere Isar.....................46
Alisa Zittel, Johannes Kollmann, Gregory Egger
Beiträge, die nicht ausdrücklich als Stellungnahme des Herausgebers gekennzeichnet sind, stellen die
persönliche Meinung der Verfasser / innen dar. Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Rich-
tigkeit, die Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben sowie für die Beachtung privater Rechte Drit-
ter. Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht in jedem Fall die Meinung der Redaktion wieder;
aus der Veröffentlichung ist keinerlei Bewertung durch die Redaktion ableitbar!
2 Auenmagazin 18 / 2020VORWORT
Liebe Leserinnen und Leser,
mit etwas Verspätung liegt Ihnen nun das erste (und hoffentlich letzte) „Corona“-Heft vor.
Klimatisch hat das Jahr trocken begonnen, aber gerade die letzten Wochen haben sich
feucht gezeigt. Diese Extreme beuteln zwar die Landwirtschaft, tun aber den Auen gut,
denn gerade sie leben von dieser Dynamik. Die Bedeutung der Dynamik als das wesentliche
Kennzeichen intakter Auen zeigt sich direkt oder indirekt in allen Beiträgen dieses Heftes.
Neumayer et al. quantifizieren in ihrem Beitrag aus der Wissenschaft die hydrologische
Wirksamkeit von Renaturierungsmaßnahmen und Auen für den natürlichen und dezen-
tralen Rückhalt. Methodisches Rüstzeug sind Modellansätze in Szenarienrechnungen an
Modellgebieten bayerischer Gewässer. Scheitelabminderungen und –verzögerungen sind
vor allem bei häufigen Ereignissen geringer Jährlichkeiten in den Modellgebieten nach-
weisbar, werden indes vielfach durch lokale Effekte überlagert.
Gelhaus et al. nehmen im Praxistest die geplanten Hochwasserrückhalteräume an der
Donau zwischen Neu-Ulm und Donauwörth ins Visier und vergleichen verschiedene Sze-
narien mit Hilfe des River Ecosystem Services Index RESI, der im Auenmagazin 16 in der
Übersicht bereits vorgestellt wurde. Fazit: Die Verrechnung verschiedener Ökosystemleis-
tungen mit RESI ist ein wertvolles und taugliches Werkzeug zur Darstellung und Vermitt-
lung der Auswirkungen von Maßnahmen und kann eine Entscheidungshilfe bei Maßnah-
menplanungen sein.
Im Mittelpunkt des Beitrags von Funk et al. steht im Projekt AQUACROSS die Wiederher-
stellung und Erhaltung der Multifunktionalität von Fluss-Auen-Systemen, bei dem ein ein-
heitlicher Kriterienansatz länderübergreifend entlang der gesamten Donau von Regensburg
bis zur Mündung eingesetzt wird. Allerdings hat dieser integrative Managementansatz,
der die Multifunktionalität der Auen berücksichtigt, auch seine Grenzen: Regionale Prio-
risierungen oder die Planung von Maßnahmen kann er nicht ersetzen.
In der letzten Ausgabe wurde bereits ein kurzer Rückblick zur Abschlussveranstaltung
zweier EU-LIFE-Projekte am Niederrhein gegeben. In diesem Heft folgt nun der ausführli-
che Bericht, in dem Markgraf-Maué und Dr. Chrobock über die zwei erfolgreichen Maß-
nahmen zur Schaffung einer durchströmten Nebenrinne und eines angebundenen Seiten-
arms am Unteren Niederrhein informieren.
Gleich zwei Artikel im vorliegenden Heft widmen sich ausführlich den „Auenbewohnern“:
Sattler et al. haben am Beispiel der Mollusken das Potenzial geplanter Dynamisierungs-
maßnahmen im Bereich der Auenwälder zwischen Lech- und Usselmündung westlich von
Neuburg an der Donau untersucht, eines der Schlüsselprojekte des Masterplans Bayeri-
sche Donau. Die darin geplanten Dynamisierungs-maßnahmen werden sich positiv auf die
Molluskenfauna auswirken. Wie Januschke und Hannig eindrucksvoll zeigen, gilt dies auch
für Laufkäfer, die sich als Ufer- und Auenbewohner sehr gut an die Dynamik terrestrischer
Auenlebensräume angepasst haben und wertvolle Bioindikatoren sind.
Nun wünschen wir Ihnen viel Freude beim Lesen dieses neuen Auenmagazins und wei-
terhin beste Gesundheit.
Auenmagazin 18 / 2020 3PERSPEKTIVEN M. Neumayer et al. Retentionspotenzialanalyse von Renaturierungsmaßnahmen an bayerischen Gewässern 4-9 RETENTIONSPOTENZIALANALYSE VON RENATURIERUNGSMASSNAHMEN AN BAYERISCHEN GEWÄSSERN Michael Neumayer, Sonja Teschemacher, Fabian Merk, Markus Disse Das ProNaHo-Projekt des Lehrstuhls für Hydrologie und Flussgebietsmanagement der TU München hat das Ziel, bay- ernweit gültige Aussagen über die Wirksamkeit von natürlichen und dezentralen Hochwasserschutzmaßnahmen zu erlangen (Rieger et al. 2017). Neben der Untersuchung von dezentralen Kleinrückhaltebecken, Landnutzungsänderun- gen in der Fläche und dem hydraulischen Einfluss von Biberdämmen möchten die Forscher die Wirksamkeit von Rena- turierungsmaßnahmen am Gewässer und in der Aue quantifizieren. Das Szenario des potenziell natürlichen Zustands der Gewässer und der Auenlandschaft wird anhand eines gebietsspezifischen und gewässermorphologischen Leitbilds erstellt. Das Ziel der beschriebenen Untersuchung ist die Abschätzung des maximal möglichen Retentionspotenzials und soll nicht als Planung für die praktische Umsetzung der Maßnahmen dienen. Abb. 1: Anthropogen beeinflusster (oben) und weitestgehend natürlicher (unten) Fließgewässerabschnitt des Otterbachs. (Foto oben: Johanna Springer, Foto un- ten: René Heinrich) 4 Auenmagazin 18 / 2020
PERSPEKTIVEN
M. Neumayer et al. Retentionspotenzialanalyse von Renaturierungsmaßnahmen an bayerischen Gewässern 4-9
Hintergrund duziert und teilweise durch wassersensible lungsbereiche identifiziert und im Modell
Strukturen ( z. B. Siedlungs- und Industrie- belassen werden.
Unter Renaturierung versteht man die na- flächen) ersetzt worden (vgl. Abbildung 1).
turnahe Wiederherstellung anthropogen be- Basierend auf den Ist-Ohne-Modellen er-
einflusster Ökosysteme bzw. die Erhaltung Der folgende Beitrag soll Aufschluss über stellten die Autoren potenziell natürliche
und Förderung von natürlichen Ökosystemen das Retentionspotenzial natürlicher Fließ- Modellszenarien (Renat-Szenarien). Dabei
(STMUV 2014). Bezogen auf Fließgewässer- gewässer- und Auenstrukturen im Vergleich streben sie als Szenarienziel der Modellre-
und Auenökosysteme liegt der Schwerpunkt zum heutigen Zustand der Flächen geben. naturierungen ein natürlich funktionieren-
dieser Studie auf der Untersuchung von Re- Hierfür selektierten die Autoren jeweils ei- des Gewässer in einer unbewirtschafteten,
naturierungs- und Auengestaltungsmaßnah- nen Untersuchungsabschnitt an den bayeri- d. h. waldbestandenen, Auenlandschaft an.
men, mit Fokus auf deren möglichen Beitrag schen Gewässern Weißer Main, Roter Main, Im Laufe des Projektes hat sich dabei die
zur Stärkung des natürlichen Rückhalts und Mangfall, Glonn und Otterbach und ana- Methodik zur zweidimensionalen hydro-
damit zum Hochwasserschutz. lysierten diesen mit Hilfe des zweidimen- dynamischen Modellierung von Renaturie-
sionalen hydraulischen Modells HYDRO- rungs- und Auengestaltungsmaßnahmen
Die vorherrschenden Standortbedingungen AS-2D. immer weiterentwickelt. Die unterschiedli-
- Klima, Geologie, Tektonik, Boden und Ve- chen Ansätze lassen sich in insgesamt vier
getation und der davon abhängige Oberflä- verschiedene Methoden unterteilen (siehe
chenabfluss und Landflächenabtrag - prä- Erstellung der potenziell Abbildung 2). Hierbei stellt die Nummerie-
gen natürliche Fließgewässer individuell. natürlichen Modellszenarien rung der Methoden gleichzeitig die chrono-
(Jürging 2001). Dabei bilden sich stand- logische Reihenfolge der Entwicklung dar.
ortspezifische Charakteristika in den dyna- Um den hydraulischen Einfluss von anthro-
mischen Ökosystembausteinen Abflussge- pogenen und gebietsabhängigen Bauwer- Nach Methode 1 werden die unterschied-
schehen, Feststoffhaushalt, Morphologie, ken (wie z. B. den Talraum querenden Stra- lichen Renaturierungsmaßnahmen aus ei-
Wasserqualität und Lebensgemeinschaften ßendämmen oder Bahntrassen) zu redu- ner eher konzeptionellen Laufverlängerung,
(Jürging 2001). Unsere Vorfahren haben zieren, erstellten die Wissenschaftler einen Querprofiländerung und Auwaldentwicklung
in den letzten Jahrhunderten die meisten bauwerksreduzierten Ist-Zustand (Ist-Ohne) getrennt und in Kombination modelliert so-
Fließgewässer in Bayern ausgebaut, um in- als Ausgangs- und Vergleichszustand für wie analysiert. Da Methode 1 aber mit ihren
tensivere Landnutzung und Besiedelung zu die Renaturierung. Die Umsetzung dieses vereinfachten Einzelmaßnahmen das ange-
ermöglichen. Im Zuge von Begradigungen Szenarios berücksichtigt die für das bay- strebte Renaturierungsziel einer potenziell
und Laufverkürzungen sind eine Vielzahl in- erische Auenprogramm erstellte Restrikti- natürlichen Gewässermorphologie und Au-
dividueller Charakteristika verloren gegan- onsanalyse von Pan (2016), auf deren Basis enlandschaft nur ungenügend widerspiegelt,
gen, sowie natürliche Retentionsräume re- wichtige Infrastrukturelemente oder Sied- wurde die Methode 1 nicht weiter verfolgt.
Gewässer- und Auenanalyse
Konzeptionelle Renaturierungs- Intensive Landschafts- und gewässertypspezifische
und Auengestaltungsmaßnahmen morphologische Leitbildentwicklung
Unspezifische
Unspezifische Morphologische Parameter
Laufverlängerung Restriktionen
Methode 1 Auwald-
Unspezifische entwicklung
Gewässeraufweitung
Anzahl und Variation
Detaillierungsgrad Gewässerstruktur Modellierung der Ja Nein
Maßnahmenkombination Querprofile (Breite/Tiefe) Auenstruktur
niedrig mittel hoch niedrig mittel hoch niedrig mittel hoch
Methode 2 Methode 3 Methode 4
Abb. 2: Unterschiedliche Methoden zur Modellierung von Renaturierungs- und Auengestaltungsmaßnahmen. (Grafik: Neumayer et al. 2018, verändert)
Auenmagazin 18 / 2020 5PERSPEKTIVEN
M. Neumayer et al. Retentionspotenzialanalyse von Renaturierungsmaßnahmen an bayerischen Gewässern 4-9
Die Methoden 2 bis 4 basieren demge- Untersuchungsgebiete Dabei hat die absolut und relativ größte
genüber auf einem ganzheitlichen, ge- Fließwegverlängerung im Gebiet der
wässerspezifischen Renaturierungsansatz Abbildung 3 stellt die Lage sowie die wich- Glonn mit einer Zunahme um ca. 11,8 Ki-
im Modellaufbau. Die Methoden erlauben, tigsten Kenngrößen der fünf hydraulischen lometer (dies entspricht 87 Prozent) statt-
das spezifische hydromorphologische Leit- Untersuchungsabschnitte dar. Die Gebiets- gefunden. Dahingegen ergibt sich für das
bild einer potenziell natürlichen Auenland- eigenschaften wie das induzierte Einzugs- Renat-Modell des Otterbachs, der zum
schaft anhand von gewässer- und vorland- gebiet am Modellauslass, die Talmittellinie Großteil in sehr engen Kerb- und Kerb-
morphologischen Untersuchungen sowie sowie das durchschnittliche Geländege- sohlentälern verläuft, mit 1,4 Kilometern
auf Grundlage von Literatur zur Gewäs- fälle sind für das Ist-Modell und das je- (ca. neun Prozent) die geringste Fließweg-
sertypologie (Pottgiesser & Sommerhäu- weilige Renaturierungsszenario identisch. verlängerung.
ser 2008, Dahm et al. 2014, Koenzen 2005,
Briem 2002) abzuleiten und in Modellpa- Die untersuchten Einzugsgebietsgrößen am Zudem bedingt die Fließwegverlängerung
rameter umzusetzen. Auslass der Modellabschnitte liegen zwi- in allen Renat-Modellen einen höheren
schen 570 Quadratkilometer (Weißer Main) Windungsgrad und ein flacheres Sohlge-
Insgesamt betrachtet, erhöhen sich mit an- und 91 Quadratkilometer (Otterbach). In fälle im Vergleich zum Ist-Zustand. Im po-
steigender Methodennummer der Detail- allen Untersuchungsabschnitten führen tenziell natürlichen Szenario an der Glonn
lierungsgrad der modellierten Auenent- die Renaturierungsmaßnahmen zu einer wird der Einfluss der großen Fließwegver-
wicklung, der Datenbedarf, der Aufwand Verlängerung des Fließweges, da die Ge- längerung auf den Windungsgrad deut-
der Modellerstellung sowie die Parame- wässer durch anthropogene Verbauungen, lich. Dieser hat sich mit einer Zunahme von
trisierungsmöglichkeiten und die Simula- meist aufgrund der Erhöhung der agrar- 1,0 auf 1,9 fast verdoppelt. In den beiden
tionsdauer. wirtschaftlichen Nutzung im Auenbereich, Maingebieten hat sich im Renat-Modell
begradigt wurden. Der Umfang der Fließ- der Windungsgrad jeweils um 0,3 erhöht,
Detaillierte Untersuchungen haben gezeigt, wegverlängerung ist dabei in jedem Unter- wobei der Rote Main aufgrund der engen
dass Methode 3 unter den genannten As- suchungsgebiet von dem heutigen Ausbau- Talprofile im oberen Modellierungsab-
pekten und der Güte der Modellergebnisse zustand sowie dem jeweils zu erwartenden schnitt insgesamt einen niedrigeren Win-
die wirtschaftlichste Variante darstellt. natürlichen Windungsgrad abhängig. dungsgrad aufweist.
Weißer Main Roter Main
Einzugsgebietsgröße: 570 km2 Einzugsgebietsgröße: 335 km2
Talmittellinie: 17,6 km Talmittellinie: 21,5 km
Flusslänge: 24,2 | 30,8 km Flusslänge: 26,1 | 31,8 km
Ø Vorlandgefälle: 4,1 ‰ Ø Vorlandgefälle: 3,5 ‰
Deutschland Ø Sohlgefälle: 2,89 | 2,41 ‰
Ø Sohlgefälle: 3,04 | 2,33 ‰
Windungsgrad: 1,37 | 1,75 Bayern Windungsgrad: 1,22 | 1,48
Otterbach Mangfall
Einzugsgebietsgröße: 91 km2 Einzugsgebietsgröße: 343 km2
Talmittellinie: 13.5 km Talmittellinie: 8,6 km
Flusslänge: 15,6 | 17,0 km Flusslänge: 9,1 | 10,9 km
Ø Vorlandgefälle: 10,1 ‰ Ø Vorlandgefälle: 7,4 ‰
Ø Sohlgefälle: 8,87 | 8,15 ‰ Ø Sohlgefälle: 7,05 | 5,83 ‰
Windungsgrad: 1,15 | 1,25 Windungsgrad: 1,06 | 1,27
Glonn Parameter
Einzugsgebietsgröße: 104 km2 grün:Renaturiertes Modellszenario
Talmittellinie: 13,1 km blau: Ist-Zustand
Flusslänge: 13,6 | 25,4 km Einzugsgebietsgrößen
Ø Vorlandgefälle: 1,5 ‰ > 500 km2
Ø Sohlgefälle: 1,46 | 0,78 ‰ 151 – 500 km2
Windungsgrad: 1,04 | 1,94 0 - 150 km2
Abbildung 3: Übersicht der wichtigsten Gebiets- und Modellcharakteristika aller fünf Untersuchungsabschnitte der Renat-Szenarien im Vergleich zu denen des
Ist-Zustands. (Grafik: Neumayer 2019 et al., verändert)
6 Auenmagazin 18 / 2020PERSPEKTIVEN
M. Neumayer et al. Retentionspotenzialanalyse von Renaturierungsmaßnahmen an bayerischen Gewässern 4-9
30
Scheitelabminderung (%) / Scheitelverzögerung (h)
konv-HQ5 Scheitelabminderung
25 konv-HQ20 Scheitelabminderung
adv-HQ5 Scheitelabminderung
adv-HQ20 Scheitelabminderung
20 adv-HQ100 Scheitelabminderung
adv-HQ300 Scheitelabminderung
konv-HQ5 Scheitelverzögerung
15 konv-HQ20 Scheitelverzögerung
adv-HQ5 Scheitelverzögerung
adv-HQ20 Scheitelverzögerung
10 adv-HQ100 Scheitelverzögerung
adv-HQ300 Scheitelverzögerung
5
0
-5
Weißer Main Roter Main Mangfall Glonn Otterbach
Abb. 4: Gebietsübergreifende Darstellung der Retentions- und Translationseffekte zwischen den Hochwasserscheiteln der Modellszenarien Ist-Ohne und Renat
am Gebietsauslass. (Grafik: Michael Neumayer)
An der Mangfall und am Otterbach erhöht jeweiligen Gebietsauslass für jedes unter- abminderungen und -verzögerungen von
sich der ursprüngliche Windungsgrad von suchte Hochwasserereignis dar. Eine posi- bis zu 28,1 Prozent und 7,75 h konnten die
1,1 auf 1,3. Auch hier sind die vorherr- tive Scheitelabminderung bedeutet einen Autoren beim konvektiven HQ5 im Unter-
schenden engen Talformen sowie die Cha- niedrigeren Scheitelabfluss im Renat-Sze- suchungsgebiet der Glonn, das durch breite
rakteristika der Fließgewässer für die ge- nario. Des Weiteren bedeutet eine posi- und relativ flache Vorländer charakterisiert
ringe Laufverlängerung und den daraus tive Scheitelverzögerung eine zeitlich ver- ist, feststellen. Damit sind die erreichten
resultierenden niedrigen Windungsgrad zögerte Hochwasserspitze im renaturierten Scheitelabminderungen über fünf Mal so
ausschlaggebend. Modell. Sind die Werte dahingegen nega- groß wie die des Weißen Mains (570 Qua-
tiv, dreht sich der beschriebene Effekt um. dratkilometer), welcher am Gebietsauslass
Gebiets- und ereignisunabhängig stellen im Mittel die zweithöchsten Abminderun-
Skalenübergreifender Vergleich sich im renaturierten Szenario vergrößerte gen aufweist. Mit knapp über 100 Quadrat-
der resultierenden Scheitelab- Überflutungsbereiche durch erhöhte Was- kilometern zählt das Untersuchungsgebiet
minderungen und -verzögerungen serstände im Vorland sowie aufgrund von der Glonn zusammen mit dem Otterbach
günstigeren Ausuferungsbedingungen ein. (91 Quadratkilometer) zu den kleinsten Un-
Insgesamt wurden fünf Hochwasserereig- tersuchungsgebieten dieser Studie. Trotz
nisse unterschiedlicher Jährlichkeit und zu- In allen Gebieten, mit Ausnahme des Ot- der zur Glonn ähnlichen Gebietsgröße des
grundeliegender Niederschlagscharakteris- terbachs, zeigen die Renaturierungsmaß- Otterbachs resultieren hier die Maßnah-
tik in jedem Untersuchungsgebiet simuliert. nahmen bei den kleinvolumigeren kon- men nicht in ähnlich hohen Wirksamkei-
Hierfür unterschieden die Autoren die Nie- vektiven Hochwasserereignissen größere ten, sondern führen zum Großteil sogar
derschlagsereignisse nach konvektiven Scheitelabminderungen als bei den kor- zu Scheitelerhöhungen am Gebietsauslass.
(hohe Niederschlagsintensität, kurz: „Som- respondierenden advektiven Ereignissen. Detaillierte Analysen haben gezeigt, dass
mergewitter“) und advektiven (mittlere In- Ebenso nimmt die Wirksamkeit der umge- der gegen Modellende einmündende ab-
tensität, lange: „Dauerregen“) Ereignissen. setzten Maßnahmen gebietsübergreifend, flussstarke Sulzbach die durch die Rena-
Im Gebiet der Glonn wurde zusätzlich ein unabhängig von der dem Hochwasser zu- turierungsmaßnahmen erreichten Schei-
300-jährliches advektives Extremereignis grundeliegenden Niederschlagscharakte- telabminderungen und -verzögerungen am
berechnet. Abbildung 4 stellt die sich er- ristik, mit zunehmender Jährlichkeit ab. Gebietsauslass des Otterbachs maßgeblich
gebenden Abminderungen und Verzöge- Die Scheitelverzögerungen zeigen ähnli- verringert. Vor dem Zusammenfluss ha-
rungen des Hochwasserscheitels zwischen che Tendenzen wie die Scheitelabminde- ben sich hier Scheitelabminderungen bis zu
dem Ist-Ohne und dem Renat-Szenario am rungen. Die insgesamt größten Scheitel- 8,2 Prozent ergeben.
Auenmagazin 18 / 2020 7PERSPEKTIVEN
M. Neumayer et al. Retentionspotenzialanalyse von Renaturierungsmaßnahmen an bayerischen Gewässern 4-9
Tabelle 1 stellt den Verlauf der Scheitel-
abminderung und -verzögerung entlang
des Otterbachs dar. Hierbei wird der starke
Einfluss des Sulzbachs, welcher zwischen
Kontrollquerschnitt fünf („Vor Unterlich-
tenwald“) und sechs („Auslass“) in den Ot-
terbach einmündet, ersichtlich.
Im Untersuchungsgebiet der Mangfall hin-
gegen haben die Renaturierungsmaßnah-
men basierend auf den Ergebnissen entlang
des Fließgewässerverlaufs und am Gebiets-
auslass mit maximal 0,6 Prozent Schei-
telabminderung und 2 h Verzögerung den
geringsten Einfluss auf den Hochwasser-
scheitel gezeigt. Die Mangfall gehört da-
bei mit 343 Quadratkilometern zusammen
Lage der Kontrollquerschnitte in den Untersuchungsabschnitten. (Lageplan Kontrollpunkte: Michael Neumayer, mit dem Roten Main (335 Quadratkilome-
Geobasisdaten: ATKIS Basis-DLM25 © Bayerische Vermessungsverwaltung, 2014) ter) zu den mittelgroßen hydraulischen Un-
tersuchungsgebieten. Die Maßnahmen am
Tab. 1: Maximale Scheitelabflüsse sowie zugehörige Retentionen und Translationen an charakteris- Roten Main zeigen ähnlich große Wirk-
tischen Abschnitten des Otterbachs. samkeiten wie am Weißen Main, werden
jedoch stärker durch Überlagerungseffekte
Ereignis ID Kontroll- EZG- Scheitel- Scheitel- Scheitel- mit seitlichen Zuflüssen beeinflusst. Dies
querschnitt Größe abfluss [m3/s] abminderung [%] verzögerung [h]
[km2] IstOhne Renat Renat/IstOhne Renat/IstOhne
führt im Falle des advektiven 20-jährli-
chen Ereignisses sogar zu einer leichten
adv HQ5 1 Steinsölden 24 5,71 5,68 0,6 0,75 Scheitelerhöhung.
2 Vor Himmelmühlbach 26 6,12 6,06 0,9 0,75
3 Vor Steinseige 41 10,30 9,94 3,4 0,75
4 Vor Diebsgraben 45 11,47 11,04 3,8 0,50
Fazit
5 Vor Unterlichtenwald 50 13,20 12,60 4,5 1,00
6 Auslass 91 18,30 18,04 1,4 2,25
Insgesamt konnten die Autoren in allen
adv HQ20 1 Steinsölden 24 8,36 8,32 0,4 1,00 Gebieten nachweisen, dass lokale Wellen-
2 Vor Himmelmühlbach 26 8,92 8,87 0,5 0,25 überlagerungseffekte die Auswirkungen
3 Vor Steinseige 41 14,01 13,86 1,1 0,25 der Renaturierungs- und Auengestaltungs-
4 Vor Diebsgraben 45 15,32 15,23 0,6 -0,25
maßnahmen auf den Hochwasserverlauf
5 Vor Unterlichtenwald 50 17,36 17,12 1,4 1,00
beeinflussen. Dies ist besonders gut am
6 Auslass 91 26,41 26,50 -0,4 0,25
Beispiel des Otterbachs an der Einmün-
adv HQ100 1 Steinsölden 24 12,18 12,10 0,6 0,00 dung des Sulzbachs zu erkennen. Basierend
2 Vor Himmelmühlbach 26 12,94 12,90 0,3 0,25 auf den vorhandenen Analysen ist anzu-
3 Vor Steinseige 41 19,55 19,47 0,4 0,25 nehmen, dass sowohl die Lage der Mün-
4 Vor Diebsgraben 45 21,24 21,11 0,6 -0,25
dung eines Zuflusses im Modellierungs-
5 Vor Unterlichtenwald 50 23,34 23,26 0,4 0,25
abschnitt als auch dessen relativer Anteil
6 Auslass 91 37,60 37,71 -0,3 0,25
am Gesamtabfluss eine entscheidende
konv HQ5 1 Steinsölden 24 8,89 8,80 1,0 0,25 Rolle für den Grad der Auswirkungen der
2 Vor Himmelmühlbach 26 8,98 8,94 0,5 0,25 Überlagerungseffekte spielt. Diese Über-
3 Vor Steinseige 41 12,30 11,69 4,9 1,50
lagerungseffekte variieren zwischen den
4 Vor Diebsgraben 45 12,63 11,86 6,0 1,50
Gebieten und Ereignissen in Folge unter-
5 Vor Unterlichtenwald 50 13,08 12,01 8,2 1,75
schiedlicher Gewässerstrukturen und Nie-
6 Auslass 91 16,87 17,05 -1,0 0,50
derschlagsverteilungen teilweise sehr stark
konv HQ20 1 Steinsölden 24 13,06 12,90 1,3 0,25 und können sowohl positive als auch ne-
2 Vor Himmelmühlbach 26 13,28 13,12 1,2 0,00 gative Einflüsse auf die Scheitelabminde-
3 Vor Steinseige 41 18,03 17,57 2,5 0,25
rungen und -verzögerungen haben. Dies
4 Vor Diebsgraben 45 18,27 17,88 2,1 0,25
zeigt, dass ein Zusammenspiel vieler ge-
5 Vor Unterlichtenwald 50 18,83 18,20 3,4 0,50
biets- und ereignisspezifischer Faktoren die
6 Auslass 91 24,91 25,09 -0,7 0,25
Wirksamkeit der Maßnahmen beeinflusst.
8 Auenmagazin 18 / 2020PERSPEKTIVEN
M. Neumayer et al. Retentionspotenzialanalyse von Renaturierungsmaßnahmen an bayerischen Gewässern 4-9
Da diese nur bedingt vorhergesagt werden Literatur wirkenden Restriktionen (Restriktions-
können, erfordert dies die entsprechende analyse). Hg. v. Bayerisches Landesamt
Modellierung eines zu untersuchenden Ge- Briem, E. & Mangelsdorf, J. (2002): Fließ- für Umwelt, Referat 64. München.
biets. Insgesamt resultieren die modellier- gewässerlandschaften in Bayern. Hg. Pottgiesser, T. & Sommerhäuser, M. (2008):
ten Renaturierungs- und Auengestaltungs- v. Bayerisches Landesamt für Was- Beschreibung und Bewertung der
maßnahmen, mit Ausnahme der Glonn, in serwirtschaft. Wasserwirtschaftsamt deutschen Fließgewässertypen - Steck-
vergleichsweise niedrigen Wirksamkeiten Deggendorf. briefe und Anhang. Hg. v. Umwelt-
in Bezug auf die Abminderung von Hoch- Dahm, V., Kupilas, B., Rolauffs, P., Hering, bundesamt, Bund / Länder-Arbeits-
wasserereignissen, was auf die geringen D., Haase, P., Kappes, H., Leps, M., gemeinschaft Wasser (LAWA).
zusätzlich aktivierten Retentionsvolumina Sundermann, A., Döbbelt-Grüne, S., Rieger, W., Teschemacher, S., Haas, S.,
zurückzuführen ist. Die für kleine Hoch- Hartmann, C., Koenzen, U., Reuvers, Springer, J. & Disse M. (2017): Mul-
wasserereignisse verhältnismäßig große C., Zellmer, U., Zins, C. & Wagner, F. tikriterielle Wirksamkeitsanalysen
Retentionswirkung des modellierten Re- (2014): Hydromorphologische Steck- zum dezentralen Hochwasserschutz.
nat-Szenarios an der Glonn ist auf meh- briefe der deutschen Fließgewässer- In: Heimerl S. (eds) Vorsorgender und
rere Faktoren zurückzuführen. Zum einen typen. Anhang 1 von „Strategien zur nachsorgender Hochwasserschutz.
begünstigt die stark anthropogen geprägte Optimierung von Fließgewässer-Re- Springer Vieweg, Wiesbaden.
Gewässer- und Auenlandschaft in Kombi- naturierungsmaßnahmen und ihrer StMUV (2014): Hochwasserschutz: Akti-
nation mit breiten und flachen Vorländern Erfolgskontrolle“. Hg. v. Umweltbun- onsprogramm 2020plus. München:
eine Aktivierung zusätzlicher Retentions- desamt. Dessau-Roßlau. StMUV.
volumina im Renat-Szenario. Zum anderen Jürging, P. (2001): Wasserbauliche Aspekte
wirken sich die während der untersuchten bei der Renaturierung von Fließge-
Ereignisse auftretenden Überlagerungs- wässern, Fließgewässerdynamik und
effekte positiv auf die Scheitelabminde- Offenlandschaften. In: Bayerisches Kontakt:
rung aus. Landesamt für Umwelt (Hrsg.). Fach-
tagung, 7–18. Technische Universität München
Des Weiteren haben natürliche Fließge- Koenzen, U. (2005): Fluss- und Stromauen in Lehrstuhl für Hydrologie
wässer und Auenlandschaften unabhän- Deutschland - Typologie und Leitbil- und Flussgebietsmanagement
gig von der Retentionswirkung im Hoch- der -. Ergebnisse des F+E-Vorhabens Arcisstraße 21
wasserfall positive Synergieeffekte auf die „Typologie und Leitbildentwicklung 80333 München
angrenzenden Ökosysteme. So können bei- für Flussauen in der Bundesre-
spielsweise durch die verbesserte Fluss- publik Deutschland“ des Bundesam- M. Sc. Michael Neumayer
Aue-Vernetzung neue Feuchtbiotope ge- tes für Naturschutz; FKZ: 803 82 100. Tel.: +49 (89) 289 - 23226
schaffen werden. Zugl.: Köln, Univ., Diss., 2005. Bonn- E-Mail: michael.neumayer@tum.de
Bad Godesberg: Bundesamt für Na-
turschutz (Angewandte Landschafts- M. Sc. Sonja Teschemacher
Danksagung ökologie, 65). Tel.: +49 (89) 289 - 23218
Neumayer, M., Heinrich, R., Rieger, W. & E-Mail: sonja.teschemacher@tum.de
Wir bedanken uns beim Bayerischen Lan- Disse, M. (2018): Vergleich unter-
desamt für Umwelt und dem Bayerischen schiedlicher Methoden zur Model- M. Sc. Fabian Merk
Staatsministerium für Umwelt und Ver- lierung von Renaturierungs- und Tel.: +49 (89) 289 - 23227
braucherschutz für die Betreuung und Fi- Auengestaltungsmaßnahmen mit E-Mail: fabian.merk@tum.de
nanzierung des Projektes ProNaHo. Des zweidimensionalen hydrodynamisch-
Weiteren danken wir auch der Hydrotec numerischen Modellen. – Forum für Prof. Dr.-Ing. Markus Disse
Ingenieurgesellschaft für Wasser und Um- Hydrologie und Wasserbewirtschaf- Tel.: +49 (89) 289 - 23916
welt mbH und dem Leibniz Rechenzentrum tung 39. E-Mail: markus.disse@tum.de
für die freundliche Unterstützung bei der Neumayer, M., Teschemacher, S. & Disse, M.
Realisierung der im Rahmen des Projektes (2019): Modelling river restoration
durchzuführenden Simulationen. and floodplain measures in Bavaria
on different scales. Poster. European
Geosciences Union, Vienna.
Weitere Informationen: PAN (2016): Planungsbüro für angewand-
Dieser Beitrag enthält Auszüge aus dem ten Naturschutz GmbH. Entwicklung
Tagungsbeitrag von Neumayer et al. und Anwendung einer Methodik zur
(2018). Analyse der innerhalb der Auenkulisse
Auenmagazin 18 / 2020 9PERSPEKTIVEN
M. Gelhaus et al. Der River Ecosystem Service Index in der Modellregion „Donauauen zwischen Neu-Ulm und Donauwörth“ 10-16
Berücksichtigung vielfältiger Ökosystemleistungen bei der Planung von Hochwasserschutzmaßnahmen
DER RIVER ECOSYSTEM SERVICE INDEX IN DER MODELLREGION
„DONAUAUEN ZWISCHEN NEU-ULM UND DONAUWÖRTH“
Marion Gelhaus, Kai Deutschmann, Barbara Stammel
Geplante Hochwasserrückhalteräume an der Donau in Bayern bilden das Grundgerüst für Szenarien, in denen Öko-
systemleistungen für einen Alternativenvergleich herangezogen wurden. Der Vergleich wurde mit Hilfe des River Eco-
system Services Index RESI erstellt, der im Auenmagazin 16 vorgestellt wurde. Der RESI ergänzt die klassischen mo-
netären Bewertungsverfahren wie etwa die Kosten-Nutzen-Analyse durch eine fünfstufig skalierte Bewertung von
27 Ökosystemleistungen, basierend auf einer quantitativen und räumlich expliziten Erfassung (Pusch et al. 2019). Für
das Fallbeispiel Donau zeigt er klar die Vor- und Nachteile verschiedener Planungszustände für unterschiedliche Sek-
toren auf und ermöglicht so eine integrative Entscheidungsfindung.
Ökosystemleistungen an der Donau nutzen die Bewohner der Donaugegend die Mensch und mittlere bis geringe Risiken für
Ökosystemleistungen noch, wenn auch in die Schutzgüter Umwelt, Kulturerbe (abge-
Die Donau als seit Jahrtausenden genutz- anderer Art und Weise oder mit anderer sehen von Regensburg als UNESCO-Welt-
ter Transportweg war früh auch Sied- Bedeutung (z. B. Hochwasserretention, Re- kulturerbe) und Wirtschaft. Für ein Extrem-
lungs- und befestigter Grenzraum. In Bay- tention von Nährstoffen, Bereitstellung von hochwasser ist das Risiko für die Schutz-
ern zeugen hiervon nicht nur keltische und Trinkwasser). güter Mensch und Wirtschaft mittel bis
römische Gründungen wie Manching oder hoch, für Umwelt hoch bis gering, für Kul-
Regensburg, sondern eine Reihe von Or- tur überwiegend gering (LfU 2015). Risiko-
ten mit teilweise im Mittelalter entstande- Hochwasserschutz an der Donau schwerpunkte insbesondere für das Schutz-
nen historischen Stadtkernen. Für die Be- gut Wirtschaft sind entlang der Donau u.a.
wohner all dieser Orte waren seit jeher die Hochwasserrisiken an der Donau in Bayern die Planungseinheiten von Neu-Ulm bis vor
Ökosystemleistungen der Donau und ih- Die gesamte Donau in Bayern ist als Ge- Regensburg (StMUV 2015). Im Bereich ei-
rer Auen essentiell, beispielsweise für den wässer mit besonderem Hochwasserrisiko nes extremen Hochwassers liegen in Bayern
Fischfang, den Transport auf dem Wasser- eingestuft (LfU 2010). Dabei besteht für ein 163 Ortslagen, 15 Industrie- und Gewerbe-
weg, den Einschlag von Bau- und Nutzholz hundertjährliches Hochwasser ein über- gebiete (Abb. 1) sowie 23 Staue mit Was-
und die Beweidung der Aue. Auch heute wiegend mittleres Risiko für das Schutzgut serkraftanlagen überregionaler Bedeutung.
Gewässer Siedlungsbebiet Flutpolder
Donau Gewerbe/Industrie im Bau
Donau (Untersuchungsgebiet) Wohngebiete u.a. in Planfeststellung
Donau (Bundeswasserstraße) ROV abgeschlossen
Main-Donau-Kanal Vorplanung
Abb. 1: In Bayern liegende Strecke der Donau mit Siedlungsgebieten, Wasserstraßenfunktion, Rückhalteräumen und untersuchtem Abschnitt (gelb).
(Hintergrundkarte: © Bayerische Vermessungsverwaltung, 2019)
10 Auenmagazin 18 / 2020PERSPEKTIVEN
M. Gelhaus et al. Der River Ecosystem Service Index in der Modellregion „Donauauen zwischen Neu-Ulm und Donauwörth“ 10-16
Hinzu kommen 37 Anlagen, welche die sind die Ziele des Naturschutzes allerdings im Jahr möglich. Im Gegensatz dazu sind im
entsprechenden Stellen in das Europäische hochrangig. Bei den forstwirtschaftlichen Planungszustand 2 (PZ 2) die Retentionsflä-
Schadstoff-Freisetzungs- und Verbringungs- Zielsetzungen ist zu beachten, dass erhebli- chen um landwirtschaftliche Flächen erwei-
register (E-PRTR) aufgenommen haben che Flächenanteile zum Staatswald und zum tert und ökologische Flutungen deswegen
(Stand 2017, www.thru.de), was bedeutet, Körperschaftswald gehören (StMELF 2019). nicht vorgesehen.
dass Hochwasser an diesen Orten schwer-
wiegende Auswirkungen haben können. Die Maßnahmenplanung an der
Notwendigkeit des Schutzes vor Hochwas- schwäbischen Donau Praxisbeispiel für die Entwicklung
ser und des Hochwasserrückhalts in diesem In einem Hochwasserdialog definierten Inte- und Erprobung des River Ecosystem
Raum wird dadurch offensichtlich. ressensvertreter zentrale Anliegen, darunter Service Index (RESI)
die Verbesserung des Grundschutzes gegen
ein hundertjährliches Hochwasser auch durch Ökosystemleistungen im RESI
Situation an der „schwäbischen Donau“ Deichrückverlegungen und den vorrangigen Die vielfältigen Auswirkungen der verschie-
Um den Hochwasserrückhalt an der Donau zu Rückhalt in den Auwäldern. Hieraus folgte denen Planungszustände nicht nur auf den
verbessern, führt der Freistaat Bayern derzeit die Suche nach geeigneten Rückhalteräu- Hochwasserschutz, sondern auch auf den
an sieben Standorten Planungsvorhaben für men mit einem erzielbaren Speichervolumen Menschen und seine Nutzung von Ökosys-
den gesteuerten Rückhalt von Extremabflüs- von mindestens fünf Millionen Kubikmetern, temleistungen werden durch den River Eco-
sen durch. Ein Schwerpunktgebiet liegt dabei vorzugsweise auf Wald- und Wasserflächen. system Service Index (RESI) bewertet. Der
an der schwäbischen Donau. Diese Planun- Es ergaben sich zwölf mögliche Standorte, RESI ist ein Werkzeug, welches Anwen-
gen sind eingebettet in das Aktionsprogramm die sich nach weiterer Untersuchung auf zu- dern erlaubt Maßnahmen in Flussauen in-
Hochwasserschutz 2020plus (StMUV 2014). nächst acht, dann auf die drei möglichen tegrativ, also nicht sektoral, in ihrer Wir-
Standorte Neugeschüttwörth, Leipheim und kung auf den Menschen zu untersuchen.
Das für den Abschnitt von der Iller- bis Helmeringen reduzierten, und die als Entlas- Nähere Erläuterungen dazu finden sich im
unterhalb der Lechmündung zuständige tung für den Extremhochwasserfall gedacht Auenmagazin 16 (Pusch et al 2019) oder im
Wasserwirtschaftsamt Donauwörth hat sind und nur dann zum Einsatz kommen sol- RESI-Handbuch (Podschun et al. 2018), die
das Hochwasserschutz-Aktionsprogramm len. Hinzu kommen sechs ungesteuerte Re- online frei verfügbar sind. Hier sind auch die
„Schwäbische Donau“ aufgestellt. Teil die- tentionsräume, die bereits bei einem kleine- einzelnen Berechnungsmethoden in Daten-
ses Aktionsprogramms ist das erweiterte ren Hochwasser anspringen sollen. Für diese blättern zusammengefasst. Aus der Liste von
Rückhalte-Projekt, das die Verbesserung insgesamt neun Rückhalteräume bereitet das 27 Ökosystemleistungen (ÖSL) (Podschun et
des Hochwasserrückhalts durch zusätzli- Wasserwirtschaftsamt Donauwörth derzeit al. 2018) wurden an der „Schwäbischen Do-
che Rückhaltemaßnahmen an der Donau ein gemeinsames Raumordnungsverfahren nau“ 13 ÖSL (siehe Tabelle 2) zunächst ein-
bewirken soll (WWA Donauwörth 2019). vor. (WWA Donauwörth 2019). zeln in einer 5 stufigen Skala bewertet und
anschließend zu einem Indexwert zusam-
Die monetären Schadenspotenziale liegen In zwei unterschiedlichen Planungszuständen mengefasst. Die Bewertung erfolgte anhand
dort bei fast drei Milliarden Euro Schaden wurden neben der Abhängigkeit von der Art von ein Kilometer langen Fluss-Auen-Seg-
im Fall eines extremen Hochwassers, wäh- des Hochwassers und der Steuerung dieser menten (Brunotte et al. 2009), die sich wie-
rend bei einem HQ100 (ohne Deichversagen) Flächen auch Flächen, Landnutzungen und derum in die Kompartimente Fluss, rezente
rund 120 Millionen Euro Schaden zu erwar- ökologische Flutungen betrachtet. Im Pla- Aue und Altaue einteilen lassen. Je nachdem,
ten sind. Betroffen wären ca. 19.000 Men- nungszustand 1 (PZ 1) sind landwirtschaft- ob der Fluss oder mehrere Kompartimente
schen bei einem extremen Hochwasser bzw. liche Flächen aus dem Retentionsraum aus- die ÖSL bereitstellen, ziehen Nutzer entwe-
ca. 4.000 bei einem hundertjährlichen Hoch- geschlossen und somit ökologische Flutungen der das Gesamtsegment oder Kompartimente
wasser (Franz Fischer Ingenieurbüro 2017). der Wald- und Wasserflächen bis zu dreimal zur Berechnung der ÖSL heran (Tabelle 2).
Der Anteil der rezenten Aue ist im Amtsbe-
reich des Wasserwirtschaftsamtes Donau- Tab. 1: Unterschiede der Planungszustände 1 und 2 der gesteuerten Rückhalteräume.
wörth deutlich größer als an der gesam-
ten Donau in Bayern, gleiches gilt für den Planungszustand 1 Planungszustand 2
Waldanteil. Dagegen sind die Anteile von Einsatz bei HQextrem Einsatz bei HQextrem
Acker- und Siedlungsflächen geringer. Mit
dem Ziel im Hintergrund, in möglichst ge- Keine landwirtschaftlichen Flächen Landwirtschaftliche Flächen betroffen
ringem Maß in privatwirtschaftlich genutzte Ökologische Flutungen bis zu 3 mal im Jahr Keine ökologischen Flutungen
Flächen einzugreifen und die Betroffenheit
von Siedlungen bestmöglich zu vermeiden, Anzahl betrachteter Polder: 2 Anzahl betrachteter Polder: 3
ist die Aue der „Schwäbischen Donau“ so- Gesamtfläche aller Polder: 874,1 ha Gesamtfläche aller Polder: 2831,0 ha
mit vergleichsweise gut für den Hochwas-
Fläche Leipheim: 505,8 ha Fläche Leipheim: 620,5 ha
serrückhalt geeignet. In den rezenten Auen
Auenmagazin 18 / 2020 11PERSPEKTIVEN
M. Gelhaus et al. Der River Ecosystem Service Index in der Modellregion „Donauauen zwischen Neu-Ulm und Donauwörth“ 10-16
Tab. 2: Alle an der „Schwäbischen Donau“ bewerteten ÖSL und ihr jeweiliger Bewertungsraum.
ÖSL Klasse Bewertete ÖSL Bewertungsraum
Versorgende
Landwirtschaftliches Ertragspotenzial Kompartiment (rezente Aue, Altaue)
Leistungen
Regulative Phosphor-Retention Kompartiment (Fluss, rezente Aue)
Leistungen Stickstoff-Retention Kompartiment (Fluss, rezente Aue)
Hochwasserregulation Segment
Niedrigwasserregulation Kompartiment (Fluss)
Sedimentregulation Kompartiment (Fluss)
Bodenbildung Kompartiment (rezente Aue, Altaue)
Kühlwirkung Segment
Habitatbereitstellung Kompartiment (rezente Aue, Altaue)
Kulturelle Landschaftsbild Kompartiment (Fluss, rezente Aue, Altaue)
Leistungen* Natur- und Kulturerbe Kompartiment (Fluss, rezente Aue, Altaue)
Unspezifische Interaktion mit der Flusslandschaft Kompartiment (Fluss, rezente Aue, Altaue)
Wasserbezogene Aktivitäten Kompartiment (Fluss, rezente Aue, Altaue)
*Die kulturellen ÖSL wurden für den Bezugszustand berechnet. Für die Planungszustände erfolgte eine textliche Stellungnahme, aber keine Berechnungen.
Bewertung der einzelnen ÖSL am Beispiel Abbildung 2 veranschaulicht exemplarisch ein bzw. zwei Wertestufen in drei Segmen-
des gesteuerten Rückhalteraums Leipheim die ÖSL landwirtschaftliches Ertragspoten- ten, die insgesamt aber eine größere Fläche
Der RESI wurde für alle neun geplanten zial, Hochwasserregulation und Habitatbe- als die im PZ 1 einnehmen. Die ÖSL Habi-
Retentionsräume im Bereich des WWA Do- reitstellung in den drei Zuständen (BZ, PZ tatbereitstellung wird im BZ unterschiedlich
nauwörth für den Bezugszustand und für 1, PZ 2) für den gesteuerten Rückhalteraum mit den Werten 2 bis 4 bewertet. Durch die
die beiden Planungszustände berechnet. Leipheim. Die ÖSL landwirtschaftliches Er- ökologischen Flutungen im PZ 1 kommt es
Die ÖSL wurden anhand ihrer Intensität tragspotenzial weist im BZ Werte von 1 und im gesamten Rückhalteraum zu einer Stei-
der Bereitstellung auf einer Skala von 1 bis 2 auf. Im PZ 1 sind keine Veränderungen in gerung der Habitatbereitstellung, da sich
5 bewertet. Dabei ist 5 die höchst mög- der Bereitstellung dieser ÖSL zu erwarten, auentypischere Lebensräume entwickeln
liche Ausprägung, wohingegen ein Wert da keine landwirtschaftlichen Flächen in der können. Dahingegen kommt es bei einer
von 1 eine fehlende bis sehr geringe Be- Raumabgrenzung des Rückhalteraums vor- Flutung des Rückhalteraums nur im Ext-
reitstellung angibt. handen sind. Im PZ 2 kommt es dagegen in remhochwasserfall (PZ 2) zu einer Schädi-
den Segmenten, in denen Landwirtschaft gung der Lebensräume (Ausnahme west-
Für die Visualisierung der bereitgestell- betrieben wird, zu einer Verschlechterung lichstes Segment, da schon im BZ geringe
ten ÖSL im Bezugszustand (BZ) sind die der Bereitstellung um einen Wert von 1 für Ausprägung) und zu einer Verschlechterung
im Retentionsraum liegenden Segmente das Jahr der Flutung. Der sehr geringe Wert um eine Wertstufe.
bzw. Kompartimente farblich markiert (Ab- (1) der ÖSL Hochwasserregulation im der-
bildung 2). Für einen Vergleich der Ver- zeitigen Zustand verbessert sich durch die
änderungen zwischen Bezugs- und Pla- Steuerung im Hochwasserfall HQextrem und Zusammenführung
nungszustand wird dagegen die jeweilige bei ökologischen Flutungen (PZ 1) in drei zu einem RESI-Indexwert
Differenz in ganzzahligen Wertestufen Segmenten um zwei Wertestufen. In einem Die einzelnen ÖSL können Nutzer auf ver-
dargestellt (Abbildung 2). Die Differenz- Segment kommt es zu einer Aufwertung um schiedene Weisen zusammenführen. Die
darstellung ermöglicht eine schnellere eine Stufe. Im westlichsten Segment, wel- Summe aller ÖSL kann Auskunft über die
Erfassung der Segmente bzw. Kompar- ches im Bezugszustand eine geringe Reten- Ausprägung aller im Segment bereitgestell-
timente, in denen es durch die geplan- tionsfähigkeit (2) aufweist, verändert sich ten ÖSL geben (Tabelle 3). Dadurch lassen
ten Maßnahmen zu Veränderungen in der die ÖSL-Bereitstellung durch die Maßnah- sich auch Segmente mit besonders hohem
ÖSL-Bereitstellung kommt. men nicht. Auch im PZ 2 kommt es zu ei- ÖSL-Angebot (sogenannte Hotspots) leicht
nem Anstieg der Hochwasserregulation um identifizieren.
12 Auenmagazin 18 / 2020PERSPEKTIVEN
M. Gelhaus et al. Der River Ecosystem Service Index in der Modellregion „Donauauen zwischen Neu-Ulm und Donauwörth“ 10-16
Bezugszustand Planungszustand 1 Planungszustand 2
Intensität der ÖSL-Bereitstellung Differenz zum Bezugszustand Differenz zum Bezugszustand
fehlend bis sehr gering +2 +1 0 -1 +2 +1 0 -1
gering mittel
hoch sehr hoch
Landwirtschaftliches Ertragspotenzial
Geringe Werte (1-2), da sehr Keine Veränderung, da keine Verschlechterung in zwei Segmen-
wenige landwirtschaftliche Landwirtschaft im Rückhalteraum ten um eine Stufe, da durch Flutung
Ertragsflächen vorhanden sind. von den Flutungen betroffen ist. mit Ertragsausfall zu rechnen ist.
Hochwasserregulation
Sehr geringe Werte, da der Deich Verbesserung um bis zu zwei Stufen. Verbesserung um bis zu zwei Stufen.
derzeit nah am Fluss ist.
Habitatbereitstellung
Räumliche Unterschiede Verbesserung im Verschlechterung um eine Stufe für
mit Werten von 2 bis 4. gesamten Rückhalteraum (RH) fast den gesamten RH durch den ne-
um ein bis zwei Stufen aufgrund gativen Effekt bei Flutung im Extrem-
der ökologischen Flutungen. hochwasserfall ohne vorherige Anpas-
sung durch ökologische Flutungen.
Abb. 2: Flächenspezifische Auswertung von drei ÖSL für die untersuchten Zustände (Bezugszustand, Planungszustand 1 und 2) für den gesteuerten
Rückhalteraum Leipheim. Die Farbkodierung für den Bezugszustand bezieht sich auf die RESI-Skala und gibt die Intensität der ÖSL-Bereitstellung an.
In den Planungszuständen wird nur die Differenz zum Bezugszustand farblich dargestellt.
Auenmagazin 18 / 2020 13PERSPEKTIVEN
M. Gelhaus et al. Der River Ecosystem Service Index in der Modellregion „Donauauen zwischen Neu-Ulm und Donauwörth“ 10-16
Im Rückhalteraum Leipheim erreicht ein Tab. 3: Summen der neun berechneten ÖSL für die einzelnen Segmente des Rückhalteraums Leipheim für
Segment im PZ 1 mit 35 die höchste Summe die drei Zustände. BZ: Bezugszustand, PZ: Planungszustand. Die maximale Summe kann einen Wert von
45 (neun ÖSL x 5) erreichen. Die Fluss-Auen-Kilometer entsprechen den Segmenten (DON-327000 = öst-
aller ÖSL, während im BZ und im PZ 2 der lichstes Segment; DON-331000 = westlichstes Segment).
höchste Wert jeweils unter 30 liegt. Den-
noch kann in diesem Fall (PZ 1: Summe 35) Fluss-Auen-Kilometer Summe BZ Summe PZ 1 Summe PZ 2
nicht von einem ÖSL-Hotspot gesprochen
DON-327000 18 26 25
werden, da die maximale Summe von 45
weit unterschritten wird. DON-328000 24 35 27
DON-329000 28 34 26
Aufzeigen von Wechselwirkungen
Der River Ecosystem Service Index kann DON-330000 26 27 23
auch Synergien oder negative Wechsel- DON-331000 22 24 24
wirkungen (Trade-offs) zwischen einzel-
nen ÖSL identifizieren. So kann die ÖSL
landwirtschaftliches Ertragspotenzial nur
dann hoch sein, wenn die ÖSL Hochwas- Die Nährstoffretentionsleistungen für Stick- Multifunktionalität im RESI
serregulation im selben Raum gering ist. stoff und Phosphor verändern sich gegen- Eine weitere Möglichkeit ist die multifunk-
Abbildung 3 stellt die Veränderung der über dem Bezugszustand nicht. Allerdings tionale Bewertung durch den Multifunkti-
ÖSL-Bereitstellung im gesamten Rückhal- beeinträchtigt die Flutung die Ausprägun- onalitätsindex (RESI-MuFu, Formel 1). Der
teraum Leipheim durch die Planungszu- gen der ÖSL Habitatbereitstellung und RESI-MuFu ermöglicht einen schnellen Über-
stände dar. landwirtschaftliches Ertragspotenzial nur blick darüber, inwieweit sich das Verhältnis
im Extremhochwasserfall negativ. Die bei- der Anzahl von ÖSL mit hoher oder sehr ho-
Im PZ 1 profitieren die ÖSL Stickstoff(N)- den Planungszustände beeinflussen die ÖSL her Bereitstellung zu der Anzahl von ÖSL mit
und Phosphor(P)-Retention, Hochwas- Niedrigwasserregulation, Sedimentregula- fehlender bis mittlerer Bereitstellung durch
serregulation, Bodenbildung sowie Ha- tion und Kühlwirkung in ihrer Leistungsfä- verschiedene Planungsvarianten oder Sze-
bitatbereitstellung durch die geplanten higkeit weder positiv noch negativ. narien verändert. Eine Lokalisation von ÖSL-
Maßnahmen. Im PZ 2 erreicht die ÖSL Hotspots, also Segmenten mit vielen ÖSL mit
Hochwasserregulation für den Gesamtraum hoher Bereitstellung, ist damit genauso mög-
Leipheim die gleiche Regulationsleistung lich, wie Veränderungen durch Maßnahmen
wie im PZ 1. in der ÖSL-Bereitstellung zu identifizieren.
Abb. 3: Dargestellt sind die Veränderungen der ÖSL-Bereitstellung in den beiden Planungszuständen im Vergleich zum Bezugszustand. Die ausgefüllten Säulen
geben die Differenz zwischen Bezugszustand und Planungszustand 1 für alle ÖSL des Rückhalteraums Leipheim an. Die schraffierten Säulen zeigen die Differenz
zwischen Bezugszustand und Planungszustand 2. ÖSL, bei denen sich keine Veränderungen durch die Planungszustände ergeben, haben keine Säulen.
14 Auenmagazin 18 / 2020PERSPEKTIVEN
M. Gelhaus et al. Der River Ecosystem Service Index in der Modellregion „Donauauen zwischen Neu-Ulm und Donauwörth“ 10-16
Der RESI ist zudem an die jeweiligen Ziele lisierung ein wertvolles Werkzeug bei der
einer Maßnahmenumsetzung anpassbar. leichtverständlichen Vermittlung der Aus-
So können Planer den Fokus auf alle ÖSL wirkungen von Maßnahmen bei den ein-
oder nur bestimmte ÖSL, z.B. nur in Auen zelnen Interessensgruppen und in der Öf-
Formel 1: Berechnung des vorkommende, legen. Darüber hinaus kann fentlichkeit sein.
RESI-Multifunktionalitätsindex (RESI-MuFu) der RESI Korrelationen zwischen einzelnen
ÖSL identifizieren, also wie sich einzelne
Für alle fünf Fluss-Auen-Segmente im Rück- ÖSL gegenseitig positiv oder negativ be- Danksagung
halteraum Leipheim hat der RESI-MuFu des einflussen. Durch die Summen- oder Mul-
Bezugszustands Werte zwischen 0,5 und 2,3 tifunktionalitätsdarstellung des RESI las- Dieser Artikel beruht auf Ergebnissen, die
(Abbildung 4). Die höchsten Werte (2,1 und sen sich räumliche ÖSL-Hotspots abbilden. während der RESI-Projektlaufzeit entstan-
2,3) erreichen die beiden mittleren Seg- Somit können Räume mit einem besonders den sind. Weitere Informationen zu den RESI-
mente im Stauhaltungsbereich. Die ÖSL hohen Angebot an verschiedenen ÖSL bei Bewertungen im Projektgebiet „Schwäbische
Stickstoff-Retention, Kühlwirkung, Niedrig- Planungsvorhaben berücksichtigt werden, Donau“ können im RESI – Anwendungshand-
wasserregulation erreichen hier hohe bis so dass sich diese durch die Maßnahmen- buch (Podschun et al. 2018) nachgelesen wer-
sehr hohe Bereitstellungswerte. Der nied- umsetzung nicht verschlechtern. Diese den. Wir bedanken uns bei den Projektpart-
rige MuFu-Wert im zweiten Segment (von ganzheitliche Betrachtung eines Maßnah- nern, dem Bayerischen Landesamt für Umwelt
links) beruht auf der geringen Bereitstellung menraums durch den RESI-Ansatz kann in (Referat 14: Bibliotheken, Internet und Da-
der meisten Ökosystemleistungen, nur Phos- Zukunft ein erster Schritt für die Entschei- tenstelle) sowie dem Wasserwirtschaftsamt
phorretention und Kühlwirkung zeigen eine dungsfindung bei Maßnahmenplanungen Donauwörth für die gute Zusammenarbeit
hohe Bereitstellung. sein und darüber hinaus kann die Visua- und Bereitstellung der benötigten Daten.
Durch die Maßnahmen im PZ 1 erhöht sich
die Anzahl der ÖSL mit hoher bis sehr hoher Bezugszustand: in einem Segment
Bereitstellung in drei Segmenten, besonders sind ÖSL mit geringer bis mittlerer
im mittleren Bereich des Rückhalteraums. Bereitstellung stärker vertreten als
Keines der Segmente hat einen RESI-MuFu- ÖSL mit hoher Bereitstellung (0,5).
Wert kleiner 1. Im PZ 2 kommt es in den bei- In vier Segmenten dominieren ÖSL
den mittleren Segmenten zu einer Verrin- mit hoher Bereitstellung, in zwei da-
gerung der Anzahl von ÖSL mit hoher oder von nur leicht; Höchstwert 2,3.
sehr hoher Bereitstellung. In den verblei-
benden drei Segmenten kommt es zu keiner
Änderung der Bereitstellungsleistung. Der PZ 1: Erhöhung der Anzahl an ÖSL
Höchstwert liegt bei 2,0. Der RESI-MuFu mit hoher bzw. sehr hoher Bereit-
verdeutlicht, wie die Bereitstellung vieler stellung in drei Segmenten;
ÖSL durch die mögliche Anpassung der Aue (Werte von 1,1 bis 4,7).
durch die ökologischen Flutungen im PZ 1
zunimmt, wohingegen der RESI-MuFu im
PZ 2 unter den Werten des BZ und des PZ 1
bleibt, bzw. es zu keiner Änderung kommt.
PZ 2: Veränderung des ÖSL-Dargebots
Der RESI als zukunftsträchtiges in zwei Segmenten durch Abwertung.
Werkzeug im Planungsalltag Keine Veränderung in den
Der RESI ist durch seinen integrativen An- restlichen drei Segmenten;
satz gut geeignet, Maßnahmen in Fluss- (Werte von 0,5 bis 2,0).
Auen-Lebensräumen zu bewerten und die
Auswirkungen dieser auf das ÖSL-Angebot
abzubilden. Vor allem der Vergleich ver-
schiedener Planungszustände oder Szena-
rien lässt sich durch die Differenzdarstel- 0–0,5 1,1–1,5 1,6–2,0 2,1-2,5 3,6–4,0 4,5–5,0
lung gut illustrieren. Somit können Planer
diverse Interessen bei Planungsvorhaben
Abb. 4: Der RESI Multifunktionalitätsindex (RESI-MuFu) gibt an, wie das Verhältnis von ÖSL mit hoher oder
berücksichtigen oder sogar einzelne ÖSL sehr hoher Bereitstellung zu den ÖSL mit sehr geringer bis mittlerer Bereitstellung ist; hier dargestellt für die
von besonderem Interesse in den Vorder- neun ÖSL Landwirtschaftliches Ertragspotenzial, Stickstoff-Retention, Phosphor-Retention, Hochwasserregu-
grund ihrer Planung stellen. lation, Niedrigwasserregulation, Sedimentregulation, Bodenbildung, Kühlwirkung und Habitatbereitstellung.
Auenmagazin 18 / 2020 15Sie können auch lesen