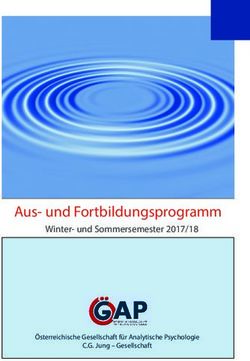Informatische Bildung und Medienerziehung - Impulsvortrag auf der Mitgliederversammlung des JFF - Professur für ...
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Informatische Bildung und Medienerziehung
Impulsvortrag auf der Mitgliederversammlung des JFF
Prof. Dr. Peter Hubwieser
TUM School of Education
Peter.Hubwieser@tum.de Unsere Publikationen finden Sie auf
www.ddi.tum.de/publikationen/
JFF München, 27.4.2018 1Überblick 1. Digitale Herausforderungen für Schule und Gesellschaft 2. Medienbildung, Medienerziehung und informatische Bildung 3. Informatik an bayerischen Schulen (C) Peter Hubwieser | Mitgliederversammlung des JFF, München am 27.4.2018 2
Digitale Herausforderung der Gesellschaft
2008 stellt Michal Kosinski die App MyPersonality in Facebook ein.
Nutzung von Instrumenten zum OCEAN-Modell (Offenheit für Erfahrungen,
Gewissenhaftigkeit, Extraversion, Verträglichkeit, Neurotizismus).
2012 erbringt er den Nachweis, dass man aus durchschnittlich 68 Facebook-Likes eines Users
vorhersagen kann,
• welche Hautfarbe er hat (95-prozentige Treffsicherheit),
• ob er homosexuell ist (88-prozentige Wahrscheinlichkeit),
• ob Demokrat oder Republikaner (85 Prozent),
• ebenso wie Intelligenz, Religionszugehörigkeit, Alkohol-, Zigaretten- und Drogenkonsum
oder ob die Eltern einer Person bis zu deren 21. Lebensjahr zusammengeblieben sind.
Sein Modell kann anhand der folgenden Zahlen von Facebooks-Likes eine Person
einschätzen:
• mit 70 Likes besser als Freunde
• mit 150 Likes besser als die Eltern,
• Mit 300 Likes besser als der Partner
Das Modell gelangte auf dunklen Wegen zur Firma Cambridge Analytica, die es auf illegal
erworbene Facebook Daten anwendete, um u.a. Wahlwerbung zu individualiseren.
(C) Peter Hubwieser | Mitgliederversammlung des JFF, München am 27.4.2018
[Kosinski 2013, 2014, 2015]
3Digitale Herausforderung für die Schulen
„Da erscheint es doch viel sinnvoller, digitale Medien und eben auch das Handy gezielt in den
Unterricht zu integrieren. Viele Lehrerinnen und Lehrer tun das bereits, zum Beispiel bei
Rechercheaufgaben. Das Handy wird so zum selbstverständlichen Teil des Unterrichts.
Die Pädagoginnen und Pädagogen verfolgen damit ein wichtiges Ziel. Sie wollen Kindern und
Jugendlichen helfen, einen sicheren und kritischen Umgang mit den neuen Medien zu lernen:
• Was ist vernünftig, was nicht?
• Wo gibt es Grenzen?
• Was ist erlaubt, was nicht?
• Wo lauern Gefahren? „
Simone Fleischmann, BLLV: Warum wir Lehrer kein generelles Handyverbot wollen. XING News, 11. Januar 2018
https://www.xing.com/news/klartext/warum-wir-lehrer-kein-generelles-handyverbot-wollen-2309 am 18.4.18
(C) Peter Hubwieser | Mitgliederversammlung des JFF, München am 27.4.2018 4Dynamik 1. Das menschliche Denken und die automatisierte Informationsverarbeitung durchdringen und verstärken sich gegenseitig. Diese Wechselwirkung sorgt dafür, dass durch Digitalisierung alles verändert wird, was durch menschliches Denken beeinflusst werden kann. 2. Die Komplexität integrierter Schaltkreise verdoppelt sich ca. alle 18 Monate (Moores Law, empirische Feststellung seit 1900)“. Dadurch entsteht eine enorm dynamische Steigerung der Rechnerleistung. 3. Immer effizientere und anpassungsfähigere Algorithmen steigern die Fähigkeiten der Digitalrechner noch zusätzlich. 4. Globalisierung und Digitalisierung verstärken sich gegenseitig. ABER: Die grundlegenden Mechanismen der Informatik ändern sich wegen ihres hohen Abstraktionsgrades kaum, z.B. Rechnerstrukturen, Programmiersprachen oder die Techniken der KI. (C) Peter Hubwieser | Mitgliederversammlung des JFF, München am 27.4.2018 5
Konsequenzen der Digitalisierung Folgen (beinhalten in der Regel sowohl Chancen als auch Risiken) 1. Ordnung: Digitale (technische) Prozesse 2. Ordnung: Verfahren, die solche digitalen Prozesse nutzen 3. Ordnung: Gesellschaftliche und soziale Veränderung durch Verfahren 2. Ordnung Beispiele Bilderkennung – Autonomes Fahren – Veränderung der Einstellung zum Automobil, der Geschäftsmodelle von Herstellern und der rechtlichen Grundlagen des Verkehrs Soziale Medien und Messenger-Systeme – Push-Nachrichtenzustellung – Informationsblasen verändern die Politische Landschaft Blockchain-Technik – Ersatzwährungen (Bitcoin) – Verlust der Währungskontrolle durch staatliche Organisationen (C) Peter Hubwieser | Mitgliederversammlung des JFF, München am 27.4.2018 6
Medienbildung - Medienerziehung Schulische Medienbildung versteht sich als dauerhafter, pädagogisch strukturierter und begleiteter Prozess der konstruktiven und kritischen Auseinandersetzung mit der Medienwelt. Sie zielt auf den Erwerb und die fortlaufende Erweiterung von Medienkompetenz; also jener Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten, die ein sachgerechtes, selbstbestimmtes, kreatives und sozial verantwortliches Handeln in der medial geprägten Lebenswelt ermöglichen. Sie umfasst auch die Fähigkeit, • sich verantwortungsvoll in der virtuellen Welt zu bewegen, • die Wechselwirkung zwischen virtueller und materieller Welt zu begreifen und • neben den Chancen auch die Risiken und Gefahren von digitalen Prozessen zu erkennen. Sekretariat der Kultusministerkonferenz: Medienbildung in der Schule (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 8. März 2012). Berlin, 2012. (C) Peter Hubwieser | Mitgliederversammlung des JFF, München am 27.4.2018 7
Medienerziehung – Medienbildung Wolf, K. W., Rummler, K., & Duwe, W. (2011). Medienbildung als Prozess der Unsgestaltung zwischen formaler Medienerziehung und informeller Medienaneignung. MedienPädagogik: Zeitschrift für Theorie und Praxis der Medienbildung, 20, 137–151. (C) Peter Hubwieser | Mitgliederversammlung des JFF, München am 27.4.2018 8
Blömeke, S. (2003). Theorie und Geschichte der Medienpädagogik: Vorlesung an der Humboldt Universität im SoSe 2003, Berlin. (C) Peter Hubwieser | Mitgliederversammlung des JFF, München am 27.4.2018 9
Medien aus der Sicht der Informatischen Bildung (IB) Hubwieser, P. (2000). Didaktik der Informatik: Grundlagen, Konzepte, Beispiele (1. Auflage). Springer, Berlin, Heidelberg, NY. (C) Peter Hubwieser | Mitgliederversammlung des JFF, München am 27.4.2018 10
Gleiches Thema, unterschiedliche Perspektiven (C) Peter Hubwieser | Mitgliederversammlung des JFF, München am 27.4.2018 11
Perspektiven der Digitalen Bildung (Dagstuhl Erklärung) Gesellschaft für Informatik (Ed.). (2016). Dagstuhl-Erklärung: Bildung in der digitalen vernetzten Welt: Eine gemeinsame Erklärung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Seminars auf Schloss Dagstuhl – Leibniz-Zentrum für Informatik GmbH. Berlin. (C) Peter Hubwieser | Mitgliederversammlung des JFF, München am 27.4.2018 12
KMK: Kompetenzen in der digitalen Welt
..
5.5. Algorithmen erkennen und formulieren
5.5.1 Funktionsweisen und grundlegende Prinzipien der digitalen Welt kennen und verstehen.
5.5.2 Algorithmische Strukturen in genutzten digitalen Tools erkennen und formulieren
5.5.3 Eine strukturierte, algorithmische Sequenz zur Lösung eines Problems planen und
verwenden
..
Sekretariat der Kultusministerkonferenz: Bildung in der digitalen Welt. Strategie der
Kultusministerkonferenz. Berlin, 2016.
(C) Peter Hubwieser | Mitgliederversammlung des JFF, München am 27.4.2018 13Informatische Bildung (IB) Informatische Bildung ist jener Teil der Allgemeinbildung, der die Welt unter informationellem Aspekt betrachtet, während die naturwissenschaftlichen Fächer den stofflichen oder energetischen Aspekt in den Mittelpunkt ihres Unterrichts stellen. Breier, N. (1994). Informatische Bildung als Teil der Allgemeinbildung – Stand und Perspektive. LOG IN 14 (5/6), S. 90-93. Ziele der IB: Befähigung zur/zum • Nutzung der Chancen, die Informatiksysteme eröffnen • Abwehr von Gefahren, die Informatiksysteme verursachen • effizientes Arbeiten mit Informatiksystemen • verantwortungsvoller Umgang mit Informatiksystemen (gegenüber sich selbst und anderen) (C) Peter Hubwieser | Mitgliederversammlung des JFF, München am 27.4.2018 14
Einige Fragen zum effizienten Arbeiten Welches Format verwende ich für eine Kombination aus Text und Bildern? • Text mit eingelagerten Bildern? • Grafikdokument mit eingelagerten Texten? • Rahmenorientiertes Dokument (Desktop Publishing)? Wieviel Speicherplatz braucht eine Grafik? • DIN-A 4, 16,7 Mio Farben, 600 dpi: 95 MB • Wieso brauchen bestimmte Formate weniger (GIF, JPG-Formate)? • Wo liegt der Unterschied zwischen diesen Formaten? Wie schütze ich meine Daten? • Angriffsmöglichkeiten • Sicherungsmechanismen Wie sichere ich meine Daten • Backup-Strategien • Sicherungsmedien (Lebensdauer) (C) Peter Hubwieser | Mitgliederversammlung des JFF, München am 27.4.2018 15
Beispiel: Abschätzung der Passwortsicherheit
Wie lange dauert es, ein Passwort durch Ausprobieren zu erraten?
Ratewort = Anfangswert
Erraten = FALSCH
Wiederhole bis (Ratewort = Endwert) oder (Erraten = WAHR)
Wenn Ratewort = Passwort dann Erraten = WAHR
Ratewort = nächster Wert
Dieser Algorithmus findet ein Passwort der Länge n mit z möglichen Zeichen sicher nach
spätestens m = zn Durchläufen der Wiederholung.
Ein Ratevorgang benötigt ca. 10 Rechenoperationen.
Wenn die Taktfrequenz unseres Rechners 3 GHz beträgt, dauert ein Ratevorgang ca. 3*10-9
Sekunden.
Das Durchprobieren aller Möglichkeiten dauert daher bei einem Passwort aus
• 5 Großbuchstaben*: 0,1 s
• 10 Zeichen aus Groß- und Kleinbuchstaben* sowie Ziffern: 189 Jahre
• 30 Zeichen aus dem ganzen ASCII-Code (128 Zeichen) 5,14E+47 Jahre
(das Alter des Universums beträgt 13,81 Milliarden = 1,38E+10 Jahre)
(C) Peter Hubwieser | Mitgliederversammlung des JFF, München am 27.4.2018 16Datenwege im Schichtenmodell (z.B. E-Mail) Hubwieser et al: Informatik 5. Ernst-Klett Verlag, Stuttgart 2010 (C) Peter Hubwieser | Mitgliederversammlung des JFF, München am 27.4.2018 17
Kürzeste Wege in Graphen für Navigationssysteme Hubwieser et al: Informatik 4. Ernst-Klett Verlag, Stuttgart 2009 (C) Peter Hubwieser | Mitgliederversammlung des JFF, München am 27.4.2018 18
Normatives Konzept: Computational Thinking [Janet Wing 2006] Computational thinking (CT) is a fundamental skill for everyone, not just for computer scientists. Computational thinking involves solving problems, designing systems, and understanding human behavior, by drawing on the concepts fundamental to computer science. Computational thinking includes a range of mental tools that reflect the breadth of the field of computer science. Computational thinking is: • Conceptualizing, not programming. • Fundamental, not rote skill. • A way that humans, not computers, think. • Complements and combines mathematical and engineering thinking. • Ideas, not artifacts. • For everyone, everywhere. (C) Peter Hubwieser | Mitgliederversammlung des JFF, München am 27.4.2018 19
Operational Definiton of CT [CSTA & ISTE. 2011] (C) Peter Hubwieser | Mitgliederversammlung des JFF, München am 27.4.2018 20
[Barr, Stephenson 2011] CT in den Fächern (C) Peter Hubwieser | Mitgliederversammlung des JFF, München am 27.4.2018 21
Association for Computing Machinery, Code.org, Computer
CSTA Framework 2016: Science Teachers Association, Cyber Innovation Center, &
National Math and Science Initiative (Eds.). (2016). K-12
Standard Construction Computer Science Framework. New York. Retrieved from
http://www.k12cs.org
Core Concepts
(C) Peter Hubwieser | Mitgliederversammlung des JFF, München am 27.4.2018 22CSTA Framework 2016: Core Practices Association for Computing Machinery, Code.org, Computer Science Teachers Association, Cyber Innovation Center, & National Math and Science Initiative (Eds.). (2016). K-12 Computer Science Framework. New York. Retrieved from http://www.k12cs.org (C) Peter Hubwieser | Mitgliederversammlung des JFF, München am 27.4.2018 23
Computer Science Teachers Association (Ed.). (2017). K-12 CSTA Standards 2017 Computer Science Standards: Revised. New York. (C) Peter Hubwieser | Mitgliederversammlung des JFF, München am 27.4.2018 24
Forderungen der Dagstuhl-Erklärung für den Unterricht 1. Bildung in der digitalen vernetzten Welt (kurz: Digitale Bildung) muss aus technologischer, gesellschaftlich-kultureller und anwendungsbezogener Perspektive in den Blick genommen werden. 2. Es muss ein eigenständiger Lernbereich eingerichtet werden, in dem die Aneignung der grundlegenden Konzepte und Kompetenzen für die Orientierung in der digitalen vernetzten Welt ermöglicht wird. 3. Daneben ist es Aufgabe aller Fächer, fachliche Bezüge zur Digitalen Bildung zu integrieren. 4. Digitale Bildung im eigenständigen Lernbereich sowie innerhalb der anderen Fächer muss kontinuierlich über alle Schulstufen für alle Schülerinnen im Sinne eines Spiralcurriulums erfolgen. Gesellschaft für Informatik (Ed.). (2016). Dagstuhl-Erklärung: Bildung in der digitalen vernetzten Welt: Eine gemeinsame Erklärung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Seminars auf Schloss Dagstuhl – Leibniz-Zentrum für Informatik GmbH. Berlin. (C) Peter Hubwieser | Mitgliederversammlung des JFF, München am 27.4.2018 25
Forderungen der Dagstuhl-Erklärung
für die Lehrer(innen)bildung
5. Eine entsprechend fundierte Lehrerbildung in den Bezugswissenschaften Informatik und
Medienbildung ist hierfür unerlässlich. Dies bedeutet:
a. Ein eigenständiges Studienangebot im Lehramtsstudium, das Inhalte aus der
Informatik und aus der Medienbildung gleichermaßen umfasst, muss eingerichtet
werden.
b. Die Fachdidaktiken aller Fächer und die Bildungswissenschaften müssen sich der
Herausforderung stellen und Forschung und Konzepte für Digitale Bildung
weiterentwickeln.
c. Umfassende Fort- und Weiterbildungsangebote für Lehrkräfte aus technologischer,
gesellschaftlich-kultureller und anwendungsbezogener Perspektive müssen kurzfristig
eingerichtet werden
Gesellschaft für Informatik (Ed.). (2016). Dagstuhl-Erklärung: Bildung in der digitalen vernetzten Welt: Eine gemeinsame
Erklärung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Seminars auf Schloss Dagstuhl – Leibniz-Zentrum für Informatik GmbH.
Berlin.
(C) Peter Hubwieser | Mitgliederversammlung des JFF, München am 27.4.2018 26Masterplan der Bayerischen Staatsregierung
Wir bauen die digitalen Fähigkeiten bei Schülern und Lehrern aus.
• Informatik/Informationstechnologie wird Pflichtfach an Mittelschule, Realschule und
Gymnasium (Grundlagen algorithmischen Denkens)
• Einrichtung von bis zu 32 „Profilschulen Informatik“ an Mittelschule, Realschule,
Gymnasium, Wirtschaftsschule FOS/BOS
• Nachqualifizierung von Lehrkräften für Informatik
• Ausbau der Didaktik der Informatik zur Lehrerausbildung im Grund- und Mittelschulbereich
• Flächenwirksame Fortbildungsoffensive für alle Lehrkräfte
Bayerische Staatskanzlei: Bayern Digital II (3. Neue Maßstäbe in der digitalen Bildung, Folie
9), München, 29.05.2017
(C) Peter Hubwieser | Mitgliederversammlung des JFF, München am 27.4.2018 27Das Schulfach Informatik am bayerischen G9-neu
Jgst. Naturwiss. Andere Zweige Start
technologischer Zweig
6 1 WS 1 WS 2018
7 1 WS 1 WS 2019
8 Natur und Technik 2020
9 2 WS 2021 Pflichtfach
10 2 WS 2022
11 NEU: 2 WS NEU: 2 WS 2023
Kursfach
12 ?? WS ?? WS 2024
13 ?? WS ?? WS 2025
Realschulen:
Pflichtfach Informationstechnik, 6 Jahre je 2 WS
Mittelschulen
Pflichtfach NN, 5/6 Jahre je 1 WS
(C) Peter Hubwieser | Mitgliederversammlung des JFF, München am 27.4.2018 28Das Prinzip: Übertragbarkeit erfordert Abstraktion
Modelle „Rahmen“ ist ein Attribut von Objekten
der Klasse „Absatz“
Konzepte
Abstraktion
der
Informatik
Beispiele
Phänomene Word 2013 OpenOffice Writer 3.3
(C) Peter Hubwieser | Mitgliederversammlung des JFF, München am 27.4.2018 29Dokumentenstrukturen
Typ Objektklassen Struktur Formate
Texte ABSATZ, ZEICHEN, DOKUMENT enthält DOC, RTF,
dynamisch: SEITE ABSATZ enthält WP, WPS
{ZEICHEN, GRAFIK, ..}
Publikation SEITE, DOKUMENT enthält PUB
RAHMEN RAHMEN enthält
{ABSATZ, GRAFIK, ..}
Rastergrafik PIXEL DOKUMENT enthält PCX, BMP,
PIXEL komp.: GIF, JPG
Vektorgrafik LINIE, RECHTECK, DOKUMENT enthält CDR, WMF
ELLLIPSE, {LINIE, RECHTECK, ..}
TEXTBEREICH,
RASTERGRAFIK
(C) Peter Hubwieser | Mitgliederversammlung des JFF, München am 27.4.2018 30Informationstechnik an der Realschule
Wahlpflichtfächer- I II Modulblock
IIIaB: Alphanumerische
IIIb Daten (2
gruppe MNT WI Module) Sprachlich Mus, HW, Soz.
Modulblock C: Numerische Daten (2 Module)
Jahreswochenstunden 6 3 2 4
Soll jeweils um eine JWS ausgebaut werden
Pflichtmodule Wahlmodulblöcke
A1: Texterfassung und -bearbeitung D: Datenmodellierung (2 Module)
A2: Grundbegriffe der Objektorientierung E: Computergestützte Konstruktion (6
A3: Umgang mit einem Module)
Textverarbeitungssystem F: Computersysteme und Datennetze (2
A4: Informationsbeschaffung, -bewertung und Module)
-austausch G: Objekte und Abläufe (2 Module)
A5: Bildbearbeitung H: Simulation – Messen, Steuern und Regeln
A6: Einführung in die Tabellenkalkulation (2 Module)
A7: Informationsbearbeitung und - I: Multimedia (5 Module)
präsentation
A8: Prinzipien der Datenverarbeitung
(C) Peter Hubwieser | Mitgliederversammlung des JFF, München am 27.4.2018 31Unsere Unterrichtswerke zur Schulinformatik
• Hubwieser P., Ruf A., Spohrer M., Steinert M., Voß S., Winhard F.: Informatik
1A. Objekte, Klassen, Strukturen. Schülerbuch - Jahrgangsstufe 6. Ernst Klett
Verlag, Stuttgart, 2. Auflage, to appear 2018.
• Hubwieser P., Ruf A., Spohrer M., Steinert M., Voß S., Winhard F.: Informatik
1B. Internet Datenschutz Algorithmen. Schülerbuch - Jahrgangsstufe 7. Ernst
Klett Verlag, Stuttgart, 2. Auflage, to appear 2019.
• Hubwieser P., Schneider M., Spohrer M., Voß S.: Informatik 2.
Tabellenkalkulationssysteme, Datenbanken. Schülerbuch - Jahrgangsstufe 9.
Ernst Klett Verlag, Stuttgart, 2007.
• Hubwieser P., Schneider M., Spohrer M., Voß S.: Informatik 3. Objektorientierte
Modellierung und Programmierung. Schülerbuch - Jahrgangsstufe 10. Ernst
Klett Verlag, Stuttgart, 2008.
• Hubwieser, P., Löffler, P., Schwaiger, P., Spohrer, M., Steinert, M., Voß, S.,
Winhard, F.: Rekursive Datenstrukturen, Softwaretechnik: Schülerbuch -
Jahrgangsstufe 11. Ernst Klett Verlag, Stuttgart, 2009
• Hubwieser, P., Löffler, P., Schwaiger, P., Spohrer, M., Steinert, M., Voß, S.,
Winhard, F.: Formale Sprachen, Kommunikation und Synchronisation von
Prozessen, Funktionsweise eines Rechners, Grenzen der Berechenbarkeit:
Schülerbuch - Jahrgangsstufe 12. Ernst Klett Verlag, Stuttgart, 2010
Didaktik der Informatik 32Mittelschule (bisher Hauptschule) Derzeit nur Wahlfach „Informationstechnik“ Lehrplan für ein Pflichtfach Informatik ist in Vorbereitung Drei Varianten: • Pflichtfach regulär • Verstärkung im M-Zweig • Wahlfach Flächendeckende Fortbildungsinitiative für MS-Lehrkräfte (C) Peter Hubwieser | Mitgliederversammlung des JFF, München am 27.4.2018 33
„Programmierzirkus“ für Grundschulkinder Das Konzept wurde bisher mit 9 Schulklassen erprobt. 132 Kinder haben mitgemacht, 62 wurden über den gesamten Verlauf aufgezeichnet (Video, Ton, Bildschirmverlauf, Produkte, Befragungen) (C) Peter Hubwieser | Mitgliederversammlung des JFF, München am 27.4.2018 34
Aufträge für kleine Programmierer (C) Peter Hubwieser | Mitgliederversammlung des JFF, München am 27.4.2018 35
F & E Projekt „Algorithmen für Kinder“ Gefördert durch das Bayerische Staatsministerium Unterricht und Kultus Start: März 2018 Erprobung des Programmierzirkus an 20 Grundschulen • Zentrale Fortbildung in Dillingen • Dezentrale Fortbildungstage • Intensive Begleitung der Schulen • Experimentalphase Sommer 2018 • Erprobung im Unterricht im Schuljahr 2018/19 Evaluierung • Formativ laufend • Summativ im Herbst 2019 Ergebnis: Konzept für flächendeckende LFB in Bayern (2400 Grundschulen) (C) Peter Hubwieser | Mitgliederversammlung des JFF, München am 27.4.2018 36
ToDo 1. Aufnahme eines Pflichtfaches Informatik in der Sekundarstufe 1 für alle Schularten in die Stundentafeln, Erstellung von Curricula und Unterrichtsmaterial. 2. Änderung der Lehramtsprüfungsordnungen • Einrichtung eines Unterrichtfachs Informatik für alle Schularten, evtl. auch als Didaktikfach • Aufnahme einer allgemeinen grundlegenden informatischen Bildung in die Lehramtsprüfungsordnungen für alle Schularten und alle Fächer • Anpassung der Curricula aller Fachdidaktiken 2. Einrichtung entsprechender Lehrveranstaltungen der Universitäten 3. Organisation eines entsprechenden Angebots für Fort- und Weiterbildung 4. Beforschung der Wechselwirkung zwischen Informatikkompetenzen und Medienkompetenz. (C) Peter Hubwieser | Mitgliederversammlung des JFF, München am 27.4.2018 37
Packen wir‘s an!
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit …
.. ich freue mich auf eine rege Diskussion!
38Alle unsere Publikationen finden Sie auf
Literatur http://www.ddi.edu.tum.de/publikationen/
• Barr, V., & Stephenson, C. (2011). Bringing Computational Thinking to K-12: What is Involved and What is the Role of the Computer Science
Education Community? ACM Inroads, 2(1), 48–54.
• CSTA & ISTE. (2011). Operational Definition of Computational Thinking for K–12 Education. CSTA, New York.
• Hubwieser, P., Armoni, M., Brinda, T., Dagiene, V., Diethelm, I., Giannakos, M. N., . . . Schubert, S. E. (2011). Computer science/informatics in
secondary education. In L. Adams & J. J. Jurgens (Eds.): ITiCSE-WGR ’11, Proceedings of the 16th annual conference reports on Innovation and
technology in computer science education - working group reports (pp. 19–38). New York, NY, USA: ACM.
• Hubwieser, P. (2000). Didaktik der Informatik: Grundlagen, Konzepte, Beispiele (1.th ed.). Springer-Lehrbuch. Berlin: Springer.
• Hubwieser, P. (2012). Computer Science Education in Secondary Schools ‐ The Introduction of a New Compulsory Subject. Trans. Comput. Educ.,
12(4), 16:1‐16:41
• Hubwieser, P., Giannakos, M. N., Berges, M., Brinda, T., Diethelm, I., Magenheim, J., . . . Jasute, E. (2015). A Global Snapshot of Computer Science
Education in K-12 Schools. In: ITICSE-WGR ’15, Proceedings of the 2015 ITiCSE on Working Group Reports (pp. 65–83). New York, NY, USA:
ACM.
• Kosinski, M., Stillwell, D., & Graepel, . (2013). Private traits and attributes are predictable from digital records of human behavior. Proceedings of the
National Academy of Sciences, 110(15), 5802–5805.
• Kosinski, M., Bachrach, Y., Kohli, P., Stillwell, D., & Graepel, T. (2014). Manifestations of user personality in website choice and behaviour on online
social networks. Machine Learning, 95(3), 357–380.
• Kosinski, M., Matz, S. C., Gosling, S. D., Popov, V., & Stillwell, D. (2015). Facebook as a research tool for the social sciences: Opportunities,
challenges, ethical considerations, and practical guidelines. The American psychologist, 70(6), 543–556.
• The Royal Society. (2012). Shutdown or Restart: The way forward for computing in UK schools. Retrieved from
http://royalsociety.org/uploadedFiles/Royal_Society_Content/education/policy/computing-in-schools/2012-01-12-Computing-in-Schools.pdf
• Wing, J. M. (2006). Computational thinking. Commun. ACM, 49(3), 33–35.
Zum Programmierzirkus:
• Geldreich, K., Funke, A., & Hubwieser, P. (2016). A Programming Circus for Primary Schools. In A. Brodnick & F. Tort (Eds.), International
Conference on Informatics in Schools - Proceedings of ISSEP 2016. Münster, October 13 – 15, 2016 (pp. 49–50).
• Geldreich, K., Funke, A., & Hubwieser, P. (2017). Willkommen im Programmierzirkus – Ein Programmierkurs für Grundschulen. In: Informatische
Bildung zum Verstehen und Gestalten der digitalen Welt (INFOS 2017). Bonn: Köllen, pp. 327-334.
• Funke, A., Geldreich, K., & Hubwieser, P. (2016). Primary School Teachers’ Opinions About Early Computer Science Education. In : Koli Calling ’16,
Proceedings of the 16th Koli Calling International Conference on Computing Education Research (pp. 135–139). New York, NY, USA: ACM.
• Funke, A., Geldreich, K., & Hubwieser, P. (2017). Analysis of scratch projects of an introductory programming course for primary school students. In
2017 IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON) (pp. 1229–1236).
• Funke, A., & Geldreich, K. (2017). Gender Differences in Scratch Programs of Primary School Children. In E. Barendsen & P. Hubwieser (Eds.), The
12th Workshop in Primary and Secondary Computing Education. Proceedings of WiPCSE 2017. 8-10 November, 2017, Nijmegen, NL. New York:
ACM Digital Library.
(C) Peter Hubwieser | Mitgliederversammlung des JFF, München am 27.4.2018 39Sie können auch lesen