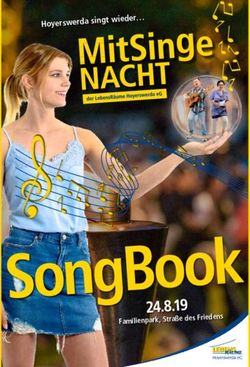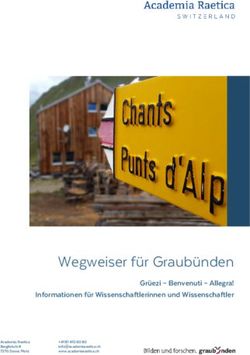Kognitive Therapie und Hirnleistungstraining - Berufliche Rehabilitation Übungen Aufmerksamkeit - HASOMED GmbH
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Kognitive Therapie und Hirnleistungstraining
Berufliche Rehabilitation
Übungen Aufm erksam keit
www.rehacom.deComputergestützte kognitive Rehabilitation
by Hasomed GmbH
Wir freuen uns, das Sie sich für RehaCom entschieden haben.
Unser Therapiesystem RehaCom vereint erprobte und innovative
Methodiken und Verfahren zur kognitiven Therapie und zum
Training von Hirnleistung.
RehaCom hilft Bertoffenen mit kognitiven Störungen
unterschiedlichster Genese bei der Verbesserung solch
wichtiger Fähigkeiten wie Aufmerksamkeit, Gedächtnis oder
Exekutivfunktionen.
Seit 1986 arbeiten wir am vorliegenden Therapiesystem.
Unser Ziel ist es, Ihnen ein Werkzeug an die Hand zu geben,
das durch fachliche Kompetenz und einfache Handhabung
Ihre Arbeit in Klinik und Praxis unterstützt.
Das Verfahren wurde gemeinsam mit der Otto-von-Guericke
Universität Magdeburg, Lehrstuhl für Neuropsychologie,
Dr. Sandra Müller und Frau Dipl.-Psych. Ulrike Klaue, und
Johannes Werres vom Berufsförderungswerk Staßfurt entwickelt.
Diese Entwicklung wurde im Rahmen des Förderprojektes
"Neuropsychologie in der beruflichen Rehabilitation",
Förderkennzeichen 03 I 0424 B, vom Bunddesministerium für
Bildung und Forschung, Deutschland gefördert.
HASOMED GmbH
Paul-Ecke-Str. 1
D-39114 Magdeburg
Tel: +49-391-6107650
Fax: +49-391-6107640Inhalt I
Inhaltsverzeichnis
Teil 1 Trainingsbeschreibung 1
1 Trainingsaufgabe
................................................................................................................................... 1
2 Leistungsfeedback
................................................................................................................................... 13
3 Schw
...................................................................................................................................
ierigkeitsstruktur 14
4 Trainingsparameter
................................................................................................................................... 16
5 Ausw
...................................................................................................................................
ertung 20
Teil 2 Theoretisches Konzept 22
1 Grundlagen
................................................................................................................................... 22
2 Trainingsziel
................................................................................................................................... 25
3 Zielgruppen
................................................................................................................................... 27
4 Literaturverw
...................................................................................................................................
eise 27
5 Systemvoraussetzungen
................................................................................................................................... 30
Index 32
© 2019 HASOMED GmbH1 Übungen Aufmerksamkeit
1 Trainingsbeschreibung
1.1 Trainingsaufgabe
Szenario Poststelle
Der Nutzer soll sich bei diesem Szenario in die Rolle eines Angestellten in einem
Unternehmen versetzen. Aufgabe ist es, die ein- bzw. ausgehende Post nach
bestimmten Merkmalen alphabetisch zu sortieren. Diese Merkmale können
Nachname oder Bestimmungsort sein. Zusätzlich sind einige Briefe mit einem roten
Express-Aufkleber versehen. Diese sind in einem extra Fach („EILT") abzulegen.
Der Trainingsbildschirm (Abbildung 1) ist zweigeteilt: Auf der linken Bildschirmseite
ist ein Stapel mit Briefen dargestellt. Auf der rechten Bildschirmseite befinden sich
schwierigkeitsabhängig:
3 Ablagefächer,
5 Ablagefächer,
6 Ablagefächer bzw.,
8 Ablagefächer.
Abbildung 1 Screenshot vom Arbeitsbildschirm Level 2
© 2019 HASOMED GmbHTrainingsbeschreibung 2
Das Einsortieren eines Briefes erfolgt, indem dieser mit der linken Maustaste
angeklickt und mit gedrückter Maustaste in das passende Fach auf der rechten
Bildschirmseite gezogen wird. Ein grüner bzw. roter Rahmen um das soeben
ausgewählte Fach signalisiert gleich nach dem Einsortieren, ob eine korrekte oder
falsche Entscheidung getroffen wurde.
Bestehen bei der Bearbeitung der Aufgabe Schwierigkeiten, kann über die
Schaltfläche „Instruktionen" nochmals die Aufgabenstellung angezeigt werden bzw.
können über die Schaltfläche „Hilfe" Hinweise bekommen werden.
Der Schriftzug auf der Schaltfläche Hilfe ist zunächst grün. Sowie alle verfügbaren
Hilfedateien 1x aufgerufen wurden, wechselt die Farbe des Schriftzugs von grün auf
rot. Damit soll dem Nutzer signalisiert werden, dass nun keine weiteren, neuen
Informationen mehr über diese Funktion aufgerufen werden können. Ein erneuter
Aufruf der letzten Hilfedatei ist jedoch möglich.
Jede Hilfedatei umfasst zusätzlich zu einem neuen Hilfetext den Hilfetext der bereits
aufgerufenen Dateien. Dieser ist abgeschwächt in grauer Schriftfarbe dargestellt.
Eine Aufgabe besteht aus 10 Briefen (= 1 Briefstapel). Wurde ein Stapel mit Briefen
abgearbeitet, erfolgt ein Leistungsfeedback. Über die Leertaste kann die nächste
Aufgabe aufgerufen werden.
Szenario Rechnungen
Der Nutzer soll sich bei diesem Szenario in die Rolle eines Mitarbeiters der
Versandabteilung versetzen. Aufgabe ist es, eine Bestellung und dazugehörige
Rechnung zu vergleichen. Die Eintragungen in der Rechnung müssen genau denen
der Bestellung entsprechen. In den Rechnungen sind jedoch Fehler enthalten. Diese
sollen gefunden und markiert werden.
Auf dem Trainingsbildschirm (Abbildung 2) sind je nach Darstellung Bestellung und
Rechnung untereinander (Einzelseite) bzw. nebeneinander (Doppelseite) dargestellt.
Bei Bedarf kann das Dokument über den Zoomregler vergrößert werden.
© 2019 HASOMED GmbH3 Übungen Aufmerksamkeit
Abbildung 2 Screenshot vom Arbeitsbildschirm – Darstellung Doppelseite – egal w elches Level
Das Markieren eines Fehlers erfolgt durch Anklicken des entsprechenden Wortes
mit der linken Maustaste. Durch erneutes Anklicken des Wortes kann die
Markierung wieder aufgehoben werden.
Bestehen bei der Bearbeitung der Aufgabe Schwierigkeiten, kann über die
Schaltfläche „Instruktionen" nochmals die Aufgabenstellung angezeigt werden bzw.
können über die Schaltfläche „Hilfe" Hinweise bekommen werden.
Der Schriftzug auf der Schaltfläche Hilfe ist zunächst grün. Sowie alle verfügbaren
Hilfedateien 1x aufgerufen wurden, wechselt die Farbe des Schriftzugs von grün auf
rot. Damit soll dem Nutzer signalisiert werden, dass nun keine weiteren, neuen
Informationen mehr über diese Funktion aufgerufen werden können. Ein erneuter
Aufruf der letzten Hilfedatei ist jedoch möglich.
Jede Hilfedatei umfasst zusätzlich zu einem neuen Hilfetext zudem den Hilfetext der
bereits aufgerufenen Dateien. Dieser ist abgeschwächt in grauer Schriftfarbe
dargestellt.
Wurden alle Fehler markiert, kann über die Schaltfläche „Fertig" die Aufgabe
beendet werden.
© 2019 HASOMED GmbHTrainingsbeschreibung 4
Eine Aufgabe besteht aus einer Bestellung und dazugehörigen Rechnung. Wurde
eine Aufgabe bearbeitet, erfolgt ein Leistungsfeedback. Bei falscher Lösung wird
das soeben bearbeitete Dokument nochmals mit allen richtig (grün) und falsch bzw.
nicht markierten Wörtern/Wortgruppen (rot) angezeigt. Über die Schaltfläche
„Weiter" kann die nächste Aufgabe aufgerufen werden.
Szenario Geschäftsbriefe/Bewerbungen
a) Geschäftsbriefe
Der Nutzer soll sich bei diesem Szenario in die Rolle eines Bürokaufmanns in einem
Unternehmen versetzen, in dessen Zuständigkeitsbereich das Schreiben der
Geschäftskorrespondenz fällt. Dabei sind ihm jedoch Fehler unterlaufen, und zwar:
Rechtschreib- und Grammatikfehler,
inhaltliche Fehler (Namen o. ä. sind mehrfach innerhalb eines Briefes erwähnt,
stimmen aber nicht überein) &
Fehler bezüglich der Einhaltung der äußeren Form (z. B. Textbausteine falsch
gesetzt).
Diese sollen gefunden werden.
Auf dem Trainingsbildschirm (Abbildung 3) ist ein Geschäftsbrief dargestellt. Bei
Bedarf kann dieser über den Zoomregler vergrößert werden.
© 2019 HASOMED GmbH5 Übungen Aufmerksamkeit
Abbildung 3 Screenshot vom Arbeitsbildschirm egal w elches Level
Das Markieren eines Fehlers erfolgt durch Anklicken des entsprechenden Wortes
mit der linken Maustaste. Durch erneutes Anklicken des Wortes kann die
Markierung wieder aufgehoben werden.
Bestehen bei der Bearbeitung der Aufgabe Schwierigkeiten, kann über die
Schaltfläche „Instruktionen" nochmals die Aufgabenstellung angezeigt werden bzw.
können über die Schaltfläche „Hilfe" Hinweise bekommen werden.
Der Schriftzug auf der Schaltfläche Hilfe ist zunächst grün. Sowie alle verfügbaren
Hilfedateien 1x aufgerufen wurden, wechselt die Farbe des Schriftzugs von grün auf
rot. Damit soll dem Nutzer signalisiert werden, dass nun keine weiteren, neuen
Informationen mehr über diese Funktion aufgerufen werden können. Ein erneuter
Aufruf der letzten Hilfedatei ist jedoch möglich.
Jede Hilfedatei umfasst zusätzlich zu einem neuen Hilfetext zudem den Hilfetext der
bereits aufgerufenen Dateien. Dieser ist abgeschwächt in grauer Schriftfarbe
dargestellt.
Wurden alle Fehler markiert, kann über die Schaltfläche „Fertig" die Aufgabe
beendet werden.
© 2019 HASOMED GmbHTrainingsbeschreibung 6
Eine Aufgabe besteht aus einem Geschäftsbrief. Wurde eine Aufgabe bearbeitet,
erfolgt ein Leistungsfeedback. Bei falscher Lösung wird das soeben bearbeitete
Dokument nochmals mit allen richtig (grün) und falsch bzw. nicht markierten Wörtern/
Wortgruppen (rot) angezeigt. Über die Schaltfläche „Weiter" kann die nächste
Aufgabe aufgerufen werden.
b) Bewerbungen
Level 4
Der Nutzer soll bei diesem Szenario auf eine Stellenanzeige reagieren. Dazu
wurden bereits drei Anschreiben verfasst, wobei in zwei der drei Schreiben Fehler
enthalten sind bzw. diese nicht so gut gelungen sind. Aus den vorhandenen
Schreiben soll nun das Schreiben ausgewählt werden, welches abgeschickt werden
soll. Die anderen beiden Anschreiben müssen verworfen werden.
Dazu müssen die Anschreiben aufmerksam gelesen und auf Rechtschreibung,
Grammatik, Ausdruck, inhaltliche Richtigkeit sowie Einhaltung der äußeren Form
kontrolliert werden. Zudem muss bei der Auswahl der entsprechende Bezug zur
Stellenanzeige hergestellt und die geforderten Einstellungskriterien beachtet
werden.
Der Trainingsbildschirm (Abbildung 4) ist zweigeteilt. Auf der linken Bildschirmseite
sind 2 Registerkarten mit den Anschreiben und der Stellenanzeige dargestellt. Auf
der rechten Bildschirmseite befinden sich die Ablagefächer „Absenden" und
„Verwerfen".
© 2019 HASOMED GmbH7 Übungen Aufmerksamkeit
Abbildung 4 Screenshot vom Arbeitsbildschirm
Die Anschreiben sollen nun in das passende Fach auf der rechten Bildschirmseite
sortiert werden (Jedes Anschreiben ist nummeriert, damit der Nutzer beim Lesen
den Überblick über die Dokumente behält.). Wenn ein Anschreiben abgeschickt
werden soll, gelangt dieses in das Fach „Absenden". Anschreiben, die fehlerhaft
bzw. weniger gut gelungen sind, müssen in das Fach „Verwerfen" verschoben
werden.
Das Einsortieren erfolgt, indem ein Dokument mit der linken Maustaste angeklickt
und mit gedrückter Maustaste in das passende Fach auf der rechten Bildschirmseite
gezogen wird. Eine einmal getätigte Zuordnung kann rückgängig gemacht werden,
indem das Dokument gleichermaßen zurück auf den Ausgangsstapel bzw. in das
andere Fach gezogen wird.
Mit Hilfe der Schaltflächen „Vor" und „Zurück" kann der Anschreibenstapel
durchgeblättert werden. Über die Schaltfläche „Dokument anzeigen" kann ein
Dokument vergrößert werden. Durch Anklicken der Registerkarten „Stellenanzeige"
bzw. „Anschreiben" können die entsprechenden Dokumente aufgerufen werden.
Bestehen bei der Bearbeitung der Aufgabe Schwierigkeiten, kann über die
Schaltfläche „Instruktionen" nochmals die Aufgabenstellung angezeigt werden bzw.
© 2019 HASOMED GmbHTrainingsbeschreibung 8
können über die Schaltfläche „Hilfe" Hinweise bekommen werden.
Der Schriftzug auf der Schaltfläche Hilfe ist zunächst grün. Sowie alle verfügbaren
Hilfedateien 1x aufgerufen wurden, wechselt die Farbe des Schriftzugs von grün auf
rot. Damit soll dem Nutzer signalisiert werden, dass nun keine weiteren, neuen
Informationen mehr über diese Funktion aufgerufen werden können. Ein erneuter
Aufruf der letzten Hilfedatei ist jedoch möglich.
Jede Hilfedatei umfasst zusätzlich zu einem neuen Hilfetext zudem den Hilfetext der
bereits aufgerufenen Dateien. Dieser ist abgeschwächt in grauer Schriftfarbe
dargestellt.
Sind alle Anschreiben einsortiert, wird über die Schaltfläche „Fertig" die Aufgabe
beendet.
Eine Aufgabe besteht aus einer Stellenanzeige und drei Anschreiben. Wurde eine
Aufgabe bearbeitet, erfolgt ein Leistungsfeedback. Bei falscher Lösung wird das
soeben bearbeitete Dokument nochmals mit Hinweisen zur Qualität der
Anschreiben dargeboten. Wird das Dokument geschlossen, erscheint die nächste
Aufgabe.
Level 5
Der Nutzer soll sich bei diesem Szenario in die Rolle eines Mitarbeiters der
Personalabteilung versetzen, in dessen Unternehmen eine Stelle neu zu besetzen
ist. Nach einer Vorauswahl liegen noch drei Bewerbungen vor. Der Bewerber, der
am besten geeignet erscheint soll eingeladen werden. Die anderen beiden
Bewerbungen müssen zunächst beiseite gelegt werden.
Bei der Auswahl muss der entsprechende Bezug zur Stellenanzeige hergestellt und
die geforderten Einstellungskriterien beachtet werden.
Der Trainingsbildschirm (Abbildung 5) ist zweigeteilt. Auf der linken Bildschirmseite
sind 2 Registerkarten mit den Bewerbungen und der Stellenanzeige dargestellt. Auf
der rechten Bildschirmseite befinden sich die Ablagefächer „Einladung" und
„Ersatzkandidaten".
© 2019 HASOMED GmbH9 Übungen Aufmerksamkeit
Abbildung 5 Screenshot vom Arbeitsbildschirm
Die Bewerbungen sollen nun in das passende Fach auf der rechten Bildschirmseite
sortiert werden (Jede Bewerbung ist nummeriert, damit der Nutzer beim Lesen den
Überblick über die Dokumente behält.). Wenn ein Bewerber eingeladen werden soll,
gelangt dessen Bewerbung in das Fach „Einladung". Die restlichen Bewerbungen
müssen in das Fach „Ersatzkandidaten" verschoben werden.
Das Einsortieren erfolgt, indem ein Dokument mit der linken Maustaste angeklickt
und mit gedrückter Maustaste in das passende Fach auf der rechten Bildschirmseite
gezogen wird. Eine einmal getätigte Zuordnung kann rückgängig gemacht werden,
indem das Dokument gleichermaßen zurück auf den Ausgangsstapel bzw. in das
andere Fach gezogen wird.
Mit Hilfe der Schaltflächen „Vor" und „Zurück" kann der Bewerbungsstapel
durchgeblättert werden. Über die Schaltfläche „Dokument anzeigen" kann ein
Dokument vergrößert werden. Durch Anklicken der Registerkarten „Stellenanzeige"
bzw. „Bewerbungen" können die entsprechenden Dokumente aufgerufen werden.
Bestehen bei der Bearbeitung der Aufgabe Schwierigkeiten, kann über die
Schaltfläche „Instruktionen" nochmals die Aufgabenstellung angezeigt werden bzw.
können über die Schaltfläche „Hilfe" Hinweise bekommen werden.
© 2019 HASOMED GmbHTrainingsbeschreibung 10
Der Schriftzug auf der Schaltfläche Hilfe ist zunächst grün. Sowie alle verfügbaren
Hilfedateien 1x aufgerufen wurden, wechselt die Farbe des Schriftzugs von grün auf
rot. Damit soll dem Nutzer signalisiert werden, dass nun keine weiteren, neuen
Informationen mehr über diese Funktion aufgerufen werden können. Ein erneuter
Aufruf der letzten Hilfedatei ist jedoch möglich.
Jede Hilfedatei umfasst zusätzlich zu einem neuen Hilfetext zudem den Hilfetext der
bereits aufgerufenen Dateien. Dieser ist abgeschwächt in grauer Schriftfarbe
dargestellt.
Sind alle Bewerbungen einsortiert, wird über die Schaltfläche „Fertig" die Aufgabe
beendet.
Eine Aufgabe besteht aus einer Stellenanzeige und drei Bewerbungen. Wurde eine
Aufgabe bearbeitet, erfolgt ein Leistungsfeedback. Bei falscher Lösung wird das
soeben bearbeitete Dokument nochmals angezeigt: Grün unterlegt sind nun
Textpassagen, die für die Einladung des Bewerbers sprechen, rot unterlegt sind
Textabschnitte, die gegen den Bewerber sprechen. Wird das Dokument
geschlossen, erscheint die nächste Aufgabe.
Szenario Textverständnis
Dem Nutzer wird ein kaufmännischer Text dargeboten. Aufgabe ist es, diesen
sorgfältig und aufmerksam durchzulesen. Im Anschluss daran werden Fragen zum
Inhalt des Textes gestellt.
Auf dem Trainingsbildschirm (Abbildung 6) ist zunächst das Textdokument sichtbar,
welches über den Zoomregler vergrößert oder verkleinert werden kann.
© 2019 HASOMED GmbH11 Übungen Aufmerksamkeit
Abbildung 6 Screenshot vom Bildschirm mit Text
Hat sich der Nutzer ausreichend mit dem Textinhalt auseinandergesetzt, kann über
die Schaltfläche „Weiter" in den Fragemodus gewechselt werden. Der
Trainingsbildschirm zeigt nun eine Frage und drei mögliche Antwortalternativen
(Abbildung 7).
© 2019 HASOMED GmbHTrainingsbeschreibung 12
Abbildung 7 Screenshot vom Bildschirm mit Fragen
Nur eine Antwort ist richtig. Diese kann mit der linken Maustaste markiert werden.
Die ausgewählte Antwort ist nun gelb umrandet sichtbar. Wird die Schaltfläche
„Weiter" betätigt, erscheint im oberen Bildschirmbereich zunächst ein Feedback
(„Richtig!" bzw. „Falsch!"). Wurde die Frage richtig beantwortet, wird zudem die
gewählte Antwort grün umrandet. Wurde die Frage falsch beantwortet, wird die
gewählte Antwort rot und die richtige Antwort grün umrandet. Über die Schaltfläche
„Weiter" gelangt der Nutzer zur nächsten Frage.
Über die Schaltfläche „Zurück" kann jederzeit wieder der Text aufgerufen werden.
Bestehen bei der Bearbeitung der Aufgabe Schwierigkeiten, kann über die
Schaltfläche „Instruktionen" nochmals die Aufgabenstellung angezeigt werden bzw.
können über die Schaltfläche „Hilfe" Hinweise bekommen werden.
Der Schriftzug auf der Schaltfläche Hilfe ist zunächst grün. Sowie alle verfügbaren
Hilfedateien 1x aufgerufen wurden, wechselt die Farbe des Schriftzugs von grün auf
rot. Damit soll dem Nutzer signalisiert werden, dass nun keine weiteren, neuen
Informationen mehr über diese Funktion aufgerufen werden können. Ein erneuter
Aufruf der letzten Hilfedatei ist jedoch möglich.
Eine Aufgabe besteht aus einem Text und drei Fragen. Wurde eine Aufgabe
© 2019 HASOMED GmbH13 Übungen Aufmerksamkeit
bearbeitet, erfolgt hinsichtlich der gestellten Fragen eine Gesamtbewertung. Über
die Leertaste kann die nächste Aufgabe aufgerufen werden.
1.2 Leistungsfeedback
Szenario Poststelle
Nach dem Einsortieren eines Briefes in einen Ordner wird die Lösungsqualität durch
einen farbigen Rahmen (grün = richtig, rot = falsch) rückgemeldet. Nach Abarbeitung
eines Stapels von Briefen bzw. nach Bearbeitung der eingestellten Anzahl von
Aufgaben wird dem Teilnehmer die Anzahl der richtigen, falschen und nicht
einsortierten Briefe dargeboten.
Szenario Rechnungen
Wenn vom Teilnehmer eine Aufgabe falsch gelöst wurde, wird das zu prüfende
Dokument mit allen richtigen (grün) und falschen Markierungen (rot) angezeigt.
Nichtmarkierte Fehler werden ebenfalls innerhalb des Dokuments mit roter Farbe
hinterlegt. Nach Bearbeitung aller Rechnungen/Geschäftsbriefe wird die Anzahl der
richtig und falsch gelösten Aufgaben dargestellt.
Szenario Geschäftsbriefe/Bewerbungen
a) Geschäftsbriefe
Wenn vom Teilnehmer eine Aufgabe falsch gelöst wurde, wird das zu prüfende
Dokument mit allen richtigen (grün) und falschen Markierungen (rot) angezeigt.
Nichtmarkierte Fehler werden ebenfalls innerhalb des Dokuments mit roter Farbe
hinterlegt. Nach Bearbeitung aller Rechnungen/Geschäftsbriefe wird die Anzahl der
richtig und falsch gelösten Aufgaben dargestellt.
b) Bewerbungen
Bei fehlerhafter Zuweisung der Bewerbungen wird ein Dokument mit allen
überprüften Bewerbungen angezeigt. Innerhalb der einzelnen Bewerbungen werden
Kommentare angezeigt, welche Punkte negativ zu bewerten waren bzw. welche
Bewerbung als richtig einzuordnen war. Nach Abarbeitung aller Stellenanzeigen
wird die Anzahl der richtig und falsch gelösten Aufgaben abgebildet.
Szenario Textverständnis
Alle richtig markierten Antworten werden als Feedback mit einem grünen Rahmen,
alle falsch ausgewählten Antworten mit einem roten Rahmen markiert. Weiterhin
wird bei einer fehlerhaften Auswahl der Antworten die richtige Lösung mit einem
grünen Rahmen hinterlegt. Nach Beantwortung der Fragen einer Aufgabe bzw.
Abarbeitung aller Aufgaben wird dem Teilnehmer die Anzahl der richtigen und
falschen Lösungen angezeigt.
© 2019 HASOMED GmbHTrainingsbeschreibung 14
Rechts neben dem Szenarionamen befindet sich eine Zahl, die den aktuellen
Schwierigkeitsgrad anzeigt.
1.3 Schwierigkeitsstruktur
Das Modul arbeitet adaptiv. Insgesamt wurden 5 Level je Szenario validiert. Eine
Ausnahme ist das Szenario Textverständnis, welches die Level 1,3 und 5 beinhaltet.
Szenario Poststelle
Bei diesem Szenario erhöht sich die Anzahl der Fächer, in die die Briefe einsortiert
werden müssen, mit steigendem Schwierigkeitsgrad. Die Bearbeitungszeit, die zur
Ablage eines Briefes zur Verfügung steht, verringert sich. Des Weiteren variiert die
Ordnerdarstellung sowie die Anzahl der Sortierkriterien.
LevBriefe müssen 3 Fächern zugeordnet werden: A-M, N-Z, EILT
el Sortieren erfolgt nur nach dem Kriterium Nachname.
1: Die Ordner werden im Training nicht gemischt.
Maximaleinblendezeit pro Brief: 60 Sekunden
Briefe müssen 5 Fächern zugeordnet werden: A-F, G-L, M-R, S-Z, EILT
LevSortieren erfolgt nur nach dem Kriterium Nachname.
el Die Ordner werden von Aufgabe zu Aufgabe anders auf dem Bildschirm
2: angeordnet (gemischt).
Maximaleinblendezeit pro Brief: 60 Sekunden
LevBriefe müssen 5 Fächern zugeordnet werden: A-F, G-L, M-R, S-Z, EILT
el Sortieren erfolgt nach den Kriterien Nachname & Ort.
3: Die Ordner werden von Aufgabe zu Aufgabe anders auf dem Bildschirm
angeordnet (gemischt).
Maximaleinblendezeit pro Brief: 14 Sekunden
LevBriefe müssen 6 Fächern zugeordnet werden: Aa-Em, En-Iz, Ja-No, Nu-St,
el Su-Z, EILT
4: Sortieren erfolgt nach den Kriterien Nachname & Ort.
Die Ordner werden von Aufgabe zu Aufgabe anders auf dem Bildschirm
angeordnet (gemischt).
Maximaleinblendezeit pro Brief: 12 Sekunden
LevBriefe müssen 8 Fächern zugeordnet werden: Aa-Den, Der-Hem, Hen-Kin,
el Kir-Net, Neu–Ron, Ros-Vel, Ver-Zy, EILT
5: Sortieren erfolgt nach den Kriterien Nachname & Ort.
Die Ordner werden von Aufgabe zu Aufgabe anders auf dem Bildschirm
angeordnet (gemischt).
© 2019 HASOMED GmbH15 Übungen Aufmerksamkeit
Maximaleinblendezeit pro Brief: 10 Sekunden
Szenario Rechnungen
Bei diesem Szenario wird der Schwierigkeitsgrad über die Anzahl und
Offensichtlichkeit der Fehler, die Anzahl der Artikel und die Länge der
Artikelnummer variiert.
Level 2 Fehler innerhalb einer Rechnung, 7 Artikel & 4-stellige Artikelnummer
1:
Level 3 Fehler innerhalb einer Rechnung, 8 Artikel & 5-stellige Artikelnummer
2:
Level 4 Fehler innerhalb einer Rechnung, 9 Artikel & 6-stellige Artikelnummer
3:
Level 5 Fehler innerhalb einer Rechnung, 10 Artikel & 7-stellige Artikelnummer
4:
Level 6 Fehler innerhalb einer Rechnung, 11 Artikel & 8-stellige Artikelnummer
5:
Die Offensichtlichkeit der Fehler sinkt mit steigendem Level.
Szenario Geschäftsbriefe/Bewerbungen
a) Geschäftsbriefe
Bei diesem Szenario wird der Schwierigkeitsgrad über die Anzahl und
Offensichtlichkeit der Fehler sowie die Angabe der Fehlerart variiert.
Lev 2 Fehler innerhalb eines Briefes, Fehlerart variiert innerhalb eines
el Dokuments nicht, Angabe der Fehlerart
1:
Lev 3 Fehler innerhalb eines Briefes, Fehlerart variiert innerhalb eines
el Dokuments, keine Angabe der Fehlerart
2:
Lev 4 Fehler innerhalb eines Briefes, Fehlerart variiert innerhalb eines
el Dokuments, keine Angabe der Fehlerart
3:
Die Offensichtlichkeit der Fehler sinkt mit steigendem Level.
b) Bewerbungen
Lev 3 Bewerbungsschreiben eines Bewerbers auf ein Stellenangebot;
el am besten gelungene/fehlerfreie Bewerbung ist auszuwählen
4:
Lev 3 Bewerbungsschreiben von 3 Bewerbern auf ein Stellenangebot
el bester Bewerber ist auszuwählen
5:
In Level 4 ist der Abgleich der einzelnen Dokumente erleichtert, da alle zu einer
© 2019 HASOMED GmbHTrainingsbeschreibung 16
Stellenanzeige gehörenden Anschreiben bis auf wenige Details identisch sind. In
Level 5 liegen komplett unterschiedliche Anschreiben vor.
Szenario Textverständnis
Bei diesem Szenario wird der Schwierigkeitsgrad über die Länge des Textes und
die Komplexität der Sätze variiert.
Lev ½ Seite Text in 4 Absätze gegliedert, einfache Sätze und einfach
el zusammengesetzte Sätze, 3 Fragen mit je 3 Antwortalternativen (1 richtig), die
1: nicht wörtlich im Text enthalten sind
Lev ½ – ¾ Seite Text in 4 Absätze gegliedert, kurze, einfache Sätze sowie einfache
el und komplexere zusammengesetzte Sätze (mehr als 2 Teilsätze, Appositionen
3: etc.), 3 Fragen mit je 3 Antwortalternativen (1 richtig), die nicht wörtlich im Text
enthalten sind
Lev ¾ – 1 Seite Text in 4 Absätze gegliedert (Ausnahme Gesetzestexte, da bereits
el vorstrukturiert), vorwiegend komplexe zusammengesetzte Sätze (mehr als 2
5: Teilsätze, Appositionen etc.), 3 Fragen mit je 3 Antwort-alternativen (1 richtig),
die nicht wörtlich im Text enthalten sind
1.4 Trainingsparameter
In den Grundlagen RehaCom werden allgemeine Hinweise zu Trainingsparametern
und ihrer Wirkung gegeben. Diese Hinweise sollten im Weiteren berücksichtigt
werden.
© 2019 HASOMED GmbH17 Übungen Aufmerksamkeit
Abbildung 8 Parameter-Menü
Trainingsmodus
Die Szenarien werden in der Reihenfolge abgearbeitet, wie sie in der Gruppe
„Szenario" vorgegeben sind. Wenn ein Teilnehmer das Training nach der
vorgegebenen Konsultationsdauer in einem bestimmten Szenario beendet, so wird
das Training in der folgenden Sitzung an gleicher Stelle fortgeführt. Soll der
Teilnehmer gezwungen werden immer mit dem ersten Szenario (hier Szenario
Poststelle) zu beginnen, ist der Schalter „Trainingsstart immer mit erstem
Szenario" zu markieren. Ist die Option "Trainingsende nach Ende Szenario"
markiert, wird das Training nicht sofort nach Ablauf der eingestellten
Konsultationsdauer beendet, sondern erst wenn der Teilnehmer nach Ablauf der
Konsultationsdauer alle Aufgaben des jeweiligen Szenarios trainiert hat.
Levelwechsel
Ist im Parametermenü der Modus „alle Level trainieren" aktiviert und der
Teilnehmer hat ein Szenario erfolgreich bearbeitet bzw. die Einstellungen für "Level
aufwärts" erreicht, gelangt er in das nächste Szenario im selben
Schwierigkeitsgrad.
Liegt der prozentuale Anteil der richtig gelösten Aufgaben eines Szenarios unterhalb
der Einstellung „Level aufwärts", muss das Szenario so lange trainiert werden, bis
© 2019 HASOMED GmbHTrainingsbeschreibung 18
das Szenario korrekt bearbeitet wurde.
Wenn alle markierten Szenarien eines bestimmten Levels (z.B. Level 2) erfolgreich
bearbeitet wurden (Einstellungen für "Level aufwärts" erreicht wurden), beginnt das
Programm wieder mit dem ersten eingestellten Szenario im nächst höheren Level (z.
B. Level 3).
Im Modus „nur gewähltes Level trainieren" werden alle im Gruppenfeld
„Szenario" ausgewählten Szenarien im gewählten Schwierigkeitsgrad trainiert. Der
Wechsel von einem Szenario zum nächsten erfolgt dann unabhängig davon, ob das
Szenario richtig bearbeitet wurde oder nicht. Die Leveleinstellung erfolgt im
Therapeutenmenü. Der Teilnehmer kann demnach eine höhere Stufe nicht einfach
frei schalten.
Ein Übungsleiter kann nach eigenem Ermessen entscheiden und einstellen, ob der
Teilnehmer durchgehend dieselbe Stufe bearbeiten soll („nur gewähltes Level
trainieren") oder ob ein Übergang zur nächst höheren Stufe bei Erreichen einer
bestimmten Prozentzahl erfolgen soll („alle Level trainieren"). Der mögliche adaptive
Wechsel der Aufgabenschwierigkeit verhindert, dass der Teilnehmer weder mit zu
schwierigen noch mit demotivierend einfachen Aufgaben konfrontiert wird.
Szenario
Alle Szenarien, welche in der Gruppe „Szenario" markiert sind, werden in der dort
aufgeführten Reihenfolge nacheinander trainiert. Wenn für ein Szenario ein Level
nicht belegt sein (z.B. Textverständnis Level 2 und 4), so wird das nächste Szenario
trainiert, welches das geforderte Level unterstützt.
Einstellungen Szenarien
Für alle Szenarien kann die Anzahl der zu bearbeitenden Aufgaben je Szenario
eingestellt werden, sowie optional eine Übungsaufgabe vor dem Trainingsstart
gelöst werden. Einige Szenarien verfügen über eine begrenzte Bearbeitungszeit je
Aufgabe.
Bei Neudefinition eines Teilnehmers setzt das System automatisch folgende
Default-Werte:
Konsultationssdauer 30 min
Training immer mit erstem Szenario aus
Trainingsende nach Ende Szenario aus
Levelwechsel alle Level trainieren
Level aufwärts 80 %
Szenario Poststelle ein
Szenario Rechnungen ein
Szenario Geschäftsbriefe/Bewerbungen ein
Szenario Textverständnis ein
© 2019 HASOMED GmbH19 Übungen Aufmerksamkeit
Szenario Poststelle
Anzahl Poststapel pro Level 5
mit Übungsaufgabe ein
max. Anzeigedauer Level 1 60
max. Anzeigedauer Level 2 60
max. Anzeigedauer Level 3 14
max. Anzeigedauer Level 4 12
max. Anzeigedauer Level 5 10
Szenario Rechnungen
Anzahl Rechungen je Level 5
mit Übungsaufgabe ein
max. Anzeigedauer Level 1 600
max. Anzeigedauer Level 2 600
max. Anzeigedauer Level 3 600
max. Anzeigedauer Level 4 600
max. Anzeigedauer Level 5 600
Szenario Geschäftsbriefe/Bewerbungen
Anzahl Geschäftsbriefe je Level 5
Anzahl Stellenanzeigen je Level 5
mit Übungsaufgabe ein
max. Anzeigedauer Level 1 600
max. Anzeigedauer Level 2 600
max. Anzeigedauer Level 3 600
max. Anzeigedauer Level 4 600
max. Anzeigedauer Level 5 600
Szenario Textverständnis
Anzahl Texte je Level 5
mit Übungsaufgabe ein
© 2019 HASOMED GmbHTrainingsbeschreibung 20
1.5 Auswertung
Die vielfältigen Möglichkeiten der Datenanalyse zur Festlegung der weiteren
Trainingsstrategie werden in den Grundlagen RehaCom beschrieben.
In der Grafik sowie in den Tabellen stehen neben den Trainingsparametern folgende
Informationen für jedes Szenario zur Verfügung:
Level aktueller Schwierigkeitsgrad
Train.-zeit Aufgabe effektive Trainingszeit [h:mm:ss]
Anz. Hilfe Anzahl der Hilfeaufrufe
Dauer Hilfe Gesamte Anzeigedauer der Hilfe [s]
Szenario Name des trainierten Szenarios
Abhängig vom trainierten Szenario variieren die Ergebnisparameter.
Szenario Poststelle
Bearbeitete Aufgaben Anzahl der einsortierten Briefe
Aufgaben richtig Anzahl der richtig einsortierten Briefe
Aufgaben falsch Anzahl der falsch einsortierten Briefe
Aufgaben zu langsam Anzahl der nicht einsortierten Briefe
Median Lösungszeit [s] Median der Bearbeitungszeit für alle richtig einsortierten
Briefe [s]
Szenario Rechungen
Bearbeitete Aufgaben Anzahl der überprüften Rechnungen
Aufgaben richtig Anzahl der richtig geprüften Rechungen
Aufgaben falsch Anzahl der fehlerhaft geprüften Rechnungen
Aufgaben zu langsam Anzahl der geprüften Rechungen mit Zeitüberschreitung
Szenario Geschäftsbriefe/Bewerbungen
a) Geschäftsbriefe
Bearbeitete Aufgaben Anzahl der überprüften Geschäftsbriefe
Aufgaben richtig Anzahl der richtig geprüften Geschäftsbriefe
Aufgaben falsch Anzahl der fehlerhaft geprüften Geschäftsbriefe
Aufgaben zu langsam Anzahl der geprüften Geschäftsbriefe mit
Zeitüberschreitung
b) Bewerbungen
Bearbeitete Aufgaben Anzahl der bearbeiteten Stellenanzeigen
Aufgaben richtig Anzahl der richtig bearbeiteten Stellenanzeigen
© 2019 HASOMED GmbH21 Übungen Aufmerksamkeit
Aufgaben falsch Anzahl der fehlerhaft bearbeiteten Stellenanzeigen
Aufgaben zu langsam Anzahl der bearbeiteten Stellenanzeigen mit
Zeitüberschreitung
Median Lösungszeit [s] Median der Bearbeitungszeit für alle richtig
bearbeiteten Stellenanzeigen [s]
Szenario Textverständnis
Bearbeitete Aufgaben Anzahl der zu erfassenden Texte
Fragen richtig Anzahl der richtig beantworteten Fragen
Fragen falsch Anzahl der falsch beantworteten Fragen
Anzeigedauer [s] Median der Anzeigedauer der zu erfassenden Texte [s]
Zurücktaste Anzahl der Betätigung der „Zurücktaste", um vom
Frageteil wieder zurück in den Textteil zu wechseln
Durch eine detaillierte Auswertung des Trainings wird es möglich, den Teilnehmer
auf bestimmte Defizite hinzuweisen und Schlussfolgerungen für das weitere Training
zu ziehen.
© 2019 HASOMED GmbHTheoretisches Konzept 22
2 Theoretisches Konzept
2.1 Grundlagen
Unter dem Begriff Aufmerksamkeit werden Funktionen zusammengefasst, durch
welche externe und interne Ereignisabfolgen eine geordnete inhaltliche und zeitliche
Struktur erhalten. Sie ermöglichen dem wachen, orientierten Organismus, sich durch
Selektion und Integration relevanter Informationen aus verschiedenen
Wahrnehmungsmodalitäten zu jedem Zeitpunkt ein Bild der vorliegenden
Lebenssituation zu schaffen.
Broadbent (1958) ging in seiner "Flaschenhals- oder Filtertheorie" von einer
begrenzten Verarbeitungskapazität für auf den Organismus eintreffende
sensorische Informationen aus, so dass bei der Reaktion auf selektierte Stimuli
eine Unterdrückung simultan auftretender Reize erfolgt. Aus heutiger Sicht
existieren modalitätsspezifisch mehrere Eingangskanäle, in denen Informationen
gefiltert werden müssen. Sternberg (1969) (vgl. Keller & Grömminger, 1993)
unterscheidet in seinem handlungsorientierten Aufmerksamkeitsmodell vier
Phasen:
1. Wahrnehmung,
2. Identifikation der relevanten Reize,
3. Wahl der Reaktion und
4. Starten eines motorischen Programms als Reaktion auf den Reiz.
Diese Prozesse laufen teilweise automatisiert ab; bei der Erfassung spezifischer
Situationsaspekte werden aktive Analyseprozesse in Gang gesetzt.
Automatisierte Prozesse laufen mit wenig Kapazität parallel ab, während alle
anderen eine serielle Verarbeitung erfordern, die mit größerer
Aufmerksamkeitskapazität und somit langsamer zu bewältigen sind.
Die Fähigkeit zur gerichteten Aufmerksamkeit stellt eine grundlegende
Voraussetzung für eine allgemeine Leistungsfähigkeit hinsichtlich verschiedener
kognitiver Anforderungen dar.
Durch Aufmerksamkeits- und Konzentrationsstörungen, welche sich in reduzierter
Aufnahme- und Verarbeitungskapazität, reduzierter
Informationsverarbeitungsgeschwindigkeit, rascher Ermüdbarkeit vor allem unter
Belastung, aber auch erhöhter Ablenkbarkeit äußern können, werden intellektuelle
und praktische Tätigkeiten in erheblichem Maße beeinträchtigt.
Auf der Basis empirischer Untersuchungen kann davon ausgegangen werden, dass
Aufmerksamkeit kein einheitliches Konstrukt ist. Vielmehr werden 4 weitgehend
voneinander unabhängige Aufmerksamkeitsaspekte unterschieden (vgl. Fimm,
1997; vgl. Sturm, 1990; Sturm et al., 1994):
1. phasische Aktivierung, Alertness
© 2019 HASOMED GmbH23 Übungen Aufmerksamkeit
2. selektive Aufmerksamkeit
3. geteilte Aufmerksamkeit
4. tonische Aktivierung, Vigilanz
Phasische Aktivierung ist definiert als die Fähigkeit, auf einen Warnreiz hin rasch
das Aktivierungsniveau für eine nachfolgende Reaktionssituation zu steigern
(Reaktionsbereitschaft, Alertness), während ein über längere Zeit relativ stabiles
Aufmerksamkeitsniveau als tonische Aktivierung bezeichnet wird.
Aufgaben, die eine geteilte Aufmerksamkeit erforderlich machen, beinhalten
mindestens zwei Reizquellen, welche parallel beachtet werden müssen, um auf
relevante simultan oder sequentiell auftretende Reize zu reagieren.
Vigilanz bezeichnet Aufmerksamkeit über längere Zeiträume mit geringer
Reizdichte; bei hoher zeitlicher Reizdichte relevanter Stimuli spricht man von
Daueraufmerksamkeit.
Die im Rahmen dieses RehaCom-Trainings besonders relevante selektive
Aufmerksamkeit bezeichnet die Fokussierung auf bestimmte Aspekte einer
Aufgabe, die es ermöglicht, schnell auf relevante Reize zu reagieren und gleichzeitig
irrelevante Reize zu ignorieren.
Diese Fähigkeit zur Auswahl und Integration definierter Reize oder
Vorstellungsinhalte und ist eng mit dem Begriff der Konzentrationsfähigkeit
assoziiert; letztere ist definiert als kurzzeitige, mehrere Minuten andauernde, aktive
Hinwendung und Einschränkung der Aufmerksamkeit mit selektiver Erfassung
relevanter Merkmale der Situation (vgl. Sturm, 1990).
Für den visuellen Bereich unterscheidet Posner (1987; vgl. Fimm, 1997)) in Bezug
auf die selektive Aufmerksamkeit drei Basismechanismen, die nach
umschriebenen Hirnläsionen ebenfalls selektiv beeinträchtigt sein können:
1. Aufmerksamkeit lösen (disengage)
2. Aufmerksamkeit verschieben (move)
3. Aufmerksamkeit fokussieren (engage).
Störungen dieser Basisfunktionen können sich in erhöhter Ablenkbarkeit ,
Perseverationstendenz oder Neglectphänomenen äußern.
Die Aufmerksamkeit gegenüber relevanten Umweltreizen ist von internen
Organismusvariablen (physiologischer Status, kognitive Prozesse, Emotionen) und
äußeren Faktoren (Reizintensität, Kontrast, Farbigkeit, Konturierung, räumliche
Beziehung usw.) abhängig. Durch besonders intensive oder neuartige Reize (mit
hohem Informationsgehalt) kann automatisch, d.h. unwillkürlich die Aufmerksamkeit
durch eine Orientierungsreaktion fokussiert werden; kognitive Prozesse modulieren
den aktuellen Aufmerksamkeitsstatus durch Gedanken, Motivationen und Interessen
(Fröhlich, 1987). Insbesondere die Selektivität der Aufmerksamkeit wird ständig
durch emotionale Bewertungen gesteuert und durch motivationale Prozesse
aufrechterhalten oder nicht.
Empirische Untersuchungen an Gesunden mit lateralisiert dargebotenem
Stimulusmaterial sowie an Split-Brain Patienten legen eine besondere Relevanz der
© 2019 HASOMED GmbHTheoretisches Konzept 24
rechten Hemisphäre bezüglich Kontrolle und Aufrechterhaltung elementarer
Aktivierungsprozesse nahe (vgl. Sturm et al., 1994), obgleich alle neurologischen
Patienten von Aufmerksamkeitsstörungen unterschiedlicher Art und Ausprägung
betroffen sein können. Wegen der Beteiligung zahlreicher Hirngebiete- und
Strukturen weist das Aufmerksamkeitssystem eine besondere Vulnerabilität nach
jeglichen cerebralen Insulten und Dysfunktionen auf.
In der psychologischen Leistungsdiagnostik, insbesondere in der klinisch-
neuropsychologischen Diagnostik, haben Tests zur Aufmerksamkeitsprüfung einen
festen Platz. Diagnostisch lassen sich die zu Anfang genannten
Aufmerksamkeitsbereiche durch unterschiedliche Aufgaben abgrenzen. Neben
Papier- und Bleistift-Tests bietet die Testbatterie zur Aufmerksamkeitsprüfung nach
Zimmermann & Fimm (1989) ein differenziertes Bild gestörter Funktionen.
Aufmerksamkeitsstörungen bei Kindern werden nach dem diagnostischen und
statistischen Manual psychischer Störungen (DSM III) als eine
entwicklungsinadäquate Unaufmerksamkeit, Impulsivität und Hyperaktivität definiert
(Lauth & Schlottke, 1988).
In der diagnostischen Praxis erfolgt die Einschätzung der Aufmerksamkeit meist
durch "Oberflächenparameter" wie
die benötigte Zeit,
die Anzahl und Art der Fehler,
die Fehlerentwicklung in Abhängigkeit von der Zeit oder
die bearbeitete Menge des vorgelegten Materials bei der Bewältigung
definierter Aufgaben.
Die Vorteile eines solchen diagnostischen Vorgehens liegen in der Gewinnung von
Messgrößen, die sowohl intra- (Krankheitsverlauf, Therapieevaluation) als auch
interindividuelle Vergleiche (Orientierung an den Werten einer Standardgruppe)
ermöglichen.
Besonders im letzten Jahrzehnt haben die Bemühungen deutlich zugenommen, auch
bei erwachsenen Patienten Störungen der Aufmerksamkeit durch kognitives
Training zu beeinflussen (Säring, 1988). Gerade nach cerebraler Schädigung
besteht ein großer Rehabilitationsbedarf, da 80% der Hirnschädigungen zu
Aufmerksamkeits- und Konzentrationsstörungen führen (Poeck, 1989, Van Zomeren
& Brouwer, 1994).
Lauth (1988) geht davon aus, dass wichtige Interventionsformen für die Therapie
von Aufmerksamkeitsstörungen in den Verfahren der kognitiven
Verhaltensmodifikation zu sehen sind, indem den Patienten handlungsregulierende
und -organisierende Kompetenzen vermittelt werden.
Die Abschnitte Trainingsziel sowie Zielgruppen liefern weitere Informationen.
© 2019 HASOMED GmbH25 Übungen Aufmerksamkeit
2.2 Trainingsziel
Szenario Poststelle
Studien zeigen, dass Leistungsverbesserungen nach einem computergestützten
Training einzelner oder mehrerer Aufmerksamkeitskomponenten zu erwarten sind
(Sturm, 2005).
Bei diesem Szenario werden vor allem selektive Aufmerksamkeitsleistungen
trainiert, d.h. die Fähigkeit zur Fokussierung der Aufmerksamkeit unter
Nichtbeachtung irrelevanter Informationen. Des Weiteren sind Trainingseffekte im
Sinne einer Verbesserung der Reaktionsgeschwindigkeit zu erwarten. Ferner stellt
das Training - wie alle kognitiven Aufgaben – nach einer bestimmten Zeit auch
Anforderungen an die Daueraufmerksamkeit.
Vor allem in den höheren Schwierigkeitsstufen wird das Arbeitsgedächtnis durch
das Einspeichern und kurzfristige Halten von verbalen und visuell-räumlichen
Informationen mit beansprucht (Thöne-Otto & Markowitsch, 2004). Das
nachfolgende Einsortieren in die mit Buchstaben beschrifteten Ordner erfordert ein
aktives Verarbeiten der vorangegangenen Informationen. Im weitesten Sinn ist somit
auch von einem Training exekutiver Funktionen auszugehen.
Darüber hinaus wird durch zeitnahe Ergebnisrückmeldung die Selbstwahrnehmung
des Patienten geschult.
Szenario Rechnungen
Studien zeigen, dass Leistungsverbesserungen nach einem computergestützten
Training einzelner oder mehrerer Aufmerksamkeitskomponenten zu erwarten sind
(Sturm, 2005).
Bei diesem Szenario werden vor allem selektive Aufmerksamkeitsleistungen
trainiert, d.h. die Fähigkeit zur Fokussierung der Aufmerksamkeit unter
Nichtbeachtung irrelevanter Informationen. Entsprechend der Aufgabenstellung sind
visuelle Reize abzugleichen und Abweichungen zu erfassen, dass heißt, es wird die
Fähigkeit trainiert, einen spezifischen Realitätsauschnitt zu isolieren, um ihn einer
differentiellen Analyse zu unterziehen.
Ferner stellt das Training - wie alle kognitiven Aufgaben - nach einer bestimmten
Zeit auch Anforderungen an die Daueraufmerksamkeit. Darüber hinaus wird durch
zeitnahe Ergebnisrückmeldung die Selbstwahrnehmung des Patienten geschult.
Szenario Geschäftsbriefe/Bewerbungen
© 2019 HASOMED GmbHTheoretisches Konzept 26
Studien zeigen, dass Leistungsverbesserungen nach einem computergestützten
Training einzelner oder mehrerer Aufmerksamkeitskomponenten zu erwarten sind
(Sturm, 2005).
In den Stufen 1 bis 3 dieses Szenarios werden vor allem selektive
Aufmerksamkeitsleistungen trainiert, d.h. die Fähigkeit zur Fokussierung der
Aufmerksamkeit unter Nichtbeachtung irrelevanter Informationen. Ferner stellt das
Training - wie alle kognitiven Aufgaben – nach einer bestimmten Zeit auch
Anforderungen an die Daueraufmerksamkeit. Darüber hinaus wird durch zeitnahe
Ergebnisrückmeldung die Selbstwahrnehmung des Patienten geschult.
Aufgrund der Komplexität der Aufgabe ist davon auszugehen, dass exekutive
Funktionen im Sinne eines Fehler-Monitoring mit beteiligt sind und ein
Trainingseffekt in diesem Bereich möglich ist.
In den Stufen 4 und 5 dieses Szenarios werden vor allem Exekutivleistungen
trainiert. Es sind zunächst Textinformationen zu erfassen und zu koordinieren.
Anschließend müssen diese gewichtet werden, um Entscheidungen treffen zu
können. Weiterhin erfordert die Aufgabe ein Fehler-Monitoring: Es muss ein
Abgleich zwischen verschiedenen Dokumenten bezüglich orthografischer, formaler
und inhaltlich-logischer Richtigkeit erfolgen.
Das Szenario Geschäftsbriefe/Bewerbungen ist ein alltagsorientiertes
Übungsverfahren, welches sowohl Anforderungen an komplexe als auch basale
kognitive Fähigkeiten stellt. Selektive Aufmerksamkeit und Gedächtnis werden in
diesem Sinne in dieser Aufgabe mit gefordert und trainiert.
Szenario Textverständnis
Das Verständnis von Texten ist ein zentraler Bestandteil unseres Alltagslebens und
erfordert den Ablauf komplexer kognitiver Prozesse. Dazu zählen insbesondere
Prozesse des Arbeitsgedächtnisses, des Strukturierens und Leistungen des
Gedächtnisses. Einzelne im Text enthaltene Informationen müssen aufrecht erhalten
und zueinander in Beziehung gesetzt werden, auftretende Informationslücken sind
wissensgestützt zu schließen. Des Weiteren müssen aus einzelnen
Textinformationen übergeordnete Einheiten gebildet werden, in denen der Textinhalt
zusammengefasst und abstrahiert wird (Riedel, 2001).
Aufgrund der Vielfalt der beteiligten kognitiven Prozesse werden mit diesem
Szenario folglich die verschiedensten kognitiven Fähigkeiten trainiert. Insbesondere
hinsichtlich der Leistungen des Arbeitsgedächtnisses, der Aufmerksamkeit, des
Gedächtnisses, der Handlungsplanung sowie bezüglich schlussfolgerndem sowie
problemlösendem Denken sind Therapieeffekte zu erwarten.
© 2019 HASOMED GmbH27 Übungen Aufmerksamkeit
2.3 Zielgruppen
Jährlich kann in Deutschland von ca. 500.000 neu auftretenden Hirnschädigungen
ausgegangen werden (Kasten et al., 1998). Davon ist ein nicht unerheblicher Teil im
erwerbsfähigen Alter. Sofern die Schwere der Schädigung überhaupt eine
Wiedereingliederung in den ersten Arbeitsmarkt zulässt, kommt der bisher
ausgeübte Beruf für viele nicht mehr in Frage und eine Umschulung wird notwendig.
Im Rahmen berufsrehabilitativer Maßnahmen ist vor allem die kognitive
Leistungsfähigkeit von entscheidender Bedeutung. Etablieren sich kognitive
Beeinträchtigungen nach zerebraler Schädigung, kann jedoch der reibungslose
Ablauf von Bildungsmaßnahmen gefährdet sein, da Störungen gerade in diesem
Bereich erheblichen Einfluss auf die schulischen Leistungen haben können.
Wehman et al. (1995) stützen diese Annahme und nennen in einer Studie zur
beruflichen Reintegration von Schädelhirntraumapatienten neuropsychologische
Defizite als wesentlichen Einflussfaktor auf den Wiedereingliederungserfolg.
Demnach ist der Wiedereintritt in das Berufsleben von Personen mit schweren
kognitiven Beeinträchtigungen weit weniger wahrscheinlich als bei Personen mit
leichteren kognitiven Dysfunktionen.
Da die Prävalenz neuropsychologischer Defizite in der beruflichen Rehabilitation
hoch ist (Müller et al., 2007), sind für dieses Klientel Therapieaufgaben notwendig,
die sich von herkömmlichen neuropsychologischen Rehabilitationsprogrammen
durch einen höheren kognitiven Anspruch und die Berücksichtigung beruflicher
Ausbildungsinhalte unterscheiden.
Das vorliegende Verfahren hält deshalb Aufgaben mit relevanten Inhalten für
kaufmännische Berufe zum gezielten Training von Aufmerksamkeitsfunktionen auf
relativ hohem Niveau bereit.
2.4 Literaturverweise
Ben-Yishay, Y., Piasetzky, E. & Rattock, J. (1987). A systematic method for
ameliorating disorders in basic attention. In Meier, M., Benton, A. & Diller, L. (Ed.).
Neuropsychological rehabilitation. Livingstone, Edinburgh: Churchill.
Brickenkamp, R. & Karl R. (1986). Geräte zur Messung von Aufmerksamkeit,
Konzentration und Vigilanz. In Brickenkamp, R. (Hrsg.). Handbuch apparativer
Verfahren in der Psychologie. Göttingen: Hogrefe.
Broadbent, D. (1958). Perception and communication. London.
Cramon, D. v. (1988). Lern-und Gedächtnisstörungen bei umschriebenen zerebralen
Gewebsläsionen. In Schönpflug, W. (Hrsg.). Bericht über den 36. Kongress der
Deutschen Gesellschaft für Psychologie. Berlin.
Diebel, A.; Feige, C.; Gedschold, J.; Goddemeier, A.; Schulze, F. & Weber, P.
(1998): Computergesteuertes Aufmerksamkeits- und Konzentrationstraining bei
gesunden Kindern. Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie. In press.
© 2019 HASOMED GmbHTheoretisches Konzept 28
Fimm, B. (1997): Microanalyse von Aufmerksamkeitsprozessen. In: Gauggel, S. &
Kerkhoff, G. (Hrsg.): Fallbuch der Klinischen Neuropsychologie. Praxis der
Neurorehabilitation. Göttingen: Hogrefe. S. 25-38.
Friedl-Francesconi, H. (1995): "Leistungsinseln" bei Demenzpatienten.
Diagnostische und therapeutische Möglichkeiten der Neuropsychologie. In:
Hinterhuber, H. (Hrsg.): Dementielle Syndrome. Innsbruck: Integrative Psychiatrie
VIP, S. 86-91.
Gray, J. & Robertson, I.H. (1989). Remediation of attentional difficulties following
brain injury: three experimental single case studies. Brain Injury, 3, 163-170.
Höschel,K. (1996): Effektivität eines ambulanten neuropsychologischen
Aufmerksamkeits- und Gedächtnistrainings in der Spätphase nach Schädel-Hirn-
Trauma. Zeitschrift für Neuropsychologie 7 (2), S. 69-82.
Kasten, E., Schmid, G. & Eder, R. (1998). Effektive neuropsychologische
Behandlungsverfahren. Bonn: Deutscher Psychologen Verlag.
Keller, I. (1997): Aufmerksamkeitsstörungen. In: Gauggel, S. & Kerkhoff, G. (Hrsg.):
Fallbuch der Klinischen Neuropsychologie. Praxis der Neurorehabilitation.
Göttingen: Hogrefe. S. 39-47.
Keller, I. & Grömminger, O. (1993): Aufmerksamkeit. In: Cramon, D.Y. von; Mai, N. &
Ziegler, W. (Hrsg.): Neuropsychologische Diagnostik. Weinheim: VCH.
Lauth, G. W. (1988). Die Vermittlung handlungsorganisierender und
handlungsregulierender Komponenten in der Therapie von
Aufmerksamkeitsstörungen. In Schönpflug, W. (Hrsg.). Bericht über den 36.
Kongress der Deutschen Gesellschaft für Psychologie. Berlin.
Liewald, A. (1996): Computerunterstütztes kognitives Training mit
Alkoholabhängigen in der Entgiftungsphase. Dissertation an der medizinischen
Fakultät der Eberhard-Karls-Universität Tübingen.
Lauth, G. W. & Schlottke, P.F. (1988). Aufmerksamkeitsstörungen. In Schönpflug, W.
(Hrsg.). Bericht über den 36. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Psychologie.
Berlin.
Müller, S. V., Klaue, U., Specht A. & Schulz, P. (2007). Neuropsychologie in der
beruflichen Rehabilitation: ein neues Interventionsfeld?. Die Rehabilitation, im Druck.
Niemann, T. & Gauggel, S. (1997): Computergestütztes Aufmerksamkeitstraining. In:
Gauggel, S. & Kerkhoff, G. (Hrsg.): Fallbuch der Klinischen Neuropsychologie.
Praxis der Neurorehabilitation. Göttingen: Hogrefe. S. 48-59.
© 2019 HASOMED GmbH29 Übungen Aufmerksamkeit
Pfleger, U. (1996): Computerunterstütztes kognitives Trainingsprogramm mit
schizophrenen Patienten. Münster: New York: Waxmann - Internationale
Hochschulschriften, Bd. 204.
Poser, U.; Kohler, J.; Sedlmeier, P. & Strätz, A. (1992): Evaluierung eines
neuropsychologischen Funktionstrainings bei Patienten mit kognitiver
Verlangsamung nach Schädelhirntrauma. Zeitschrift für Neuropsychologie, 1, 3-24.
Posner, M. & Rafal, R. (1987). Cognitive theories of attention and the rehabilitation
of attentional deficits. In: Meier, M., Benton, A. & Diller, L. (Ed.). Neuropsychological
rehabilitation. Edinburgh, London: Churchill Livingstone.
Poeck, K. (1989). (Hrsg.). Klinische Neuropsychologie. Stuttgart, New York: Thieme-
Verlag.
Polmin, K.; Schmidt, R.; Irmler, A. & Koch, M.(1994): Effektivität eines ambulanten
neuropsychologischen Aufmerksamkeits- und gedächtnistrainings in der Spätphase
nach Schädel-Hirn-Trauma. Referat der Jahrestagung der Österreichischen
Gesellschaft für Neurorehabilitation.
Preetz, N. (1992): Untersuchung zur Validierung eines computergestützten
neuropsychologischen Gedächtnis- und Konzentrations-Trainingsprogrammes für
zerebralgeschädigte Patienten an einer Klinik für neurologische und orthopädische
Rehabilitation. Dissertation an der Medizinischen Akademie Magdeburg.
Puhr, U. (1997): Effektivität der RehaCom-Programme in der neuropsychologischen
Rehabilitation bei Schlaganfall-Patienten. Diplomarbeit an der Universität Wien.
Regel, H. & Fritsch, A. (1997): Evaluationsstudie zum computergestützten Training
psychischer Basisfunktionen. Abschlussbericht zum geförderten Forschungsprojekt.
Bonn: Kuratorium ZNS.
Regel, H., Krause, A. & Krüger, H. (1981). Konfigurationsfrequenzanalytische
Einschätzung einiger psychometrischer Verfahren zur Hirnschadensdiagnostik.
Psychiatrie, Neurologie, medizinische Psychologie 33, S. 347.
Riedel, B. (2001). Texte für die neurologische Rehabilitation. Hofheim: NAT-Verlag.
Saring, W. (1988). Aufmerksamkeit. In Cramon, D. v. & Zihl, J. (Hrsg.).
Neuropsychologische Rehabilation. Berlin, Heidelberg, New York: Springerverlag.
Sohlberg, M.M. & Mateer, C.A. 81987): Effectiveness of an Attention Training
Program. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology, 9, 117-130.
Sturm, W. (1990): Neuropsychologische Therapie von hirnschädigungsbedingten
Aufmerksamkeitsstörungen. Zeitschrift für Neuropsychologie, 1 (1), 23-31.
© 2019 HASOMED GmbHSie können auch lesen