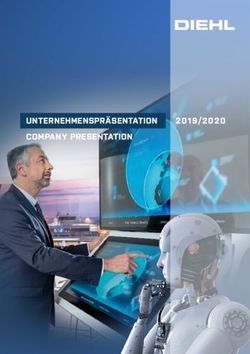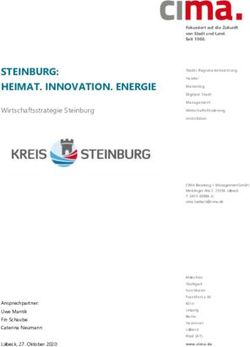Leseprobe - Carl Hanser ...
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Leseprobe
zu
„Blended Learning mit MOODLE“
von Robert Schoblick
Print-ISBN: 978-3-446-46382-0
E-Book-ISBN: 978-3-446-46554-1
E-Pub-ISBN: 978-3-446-46469-8
Weitere Informationen und Bestellungen unter
http://www.hanser-fachbuch.de/978-3-446-46382-0
sowie im Buchhandel
© Carl Hanser Verlag, MünchenInhalt
Vorwort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIII
Wozu Blended Learning? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XVII
Der Autor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XXI
Teil I: Allgemeine Ansätze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1 Potenzielle Zielgruppen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.1 Lehrerinnen und Lehrer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.1.1 Amtsbezeichnung „Lehrerin/Lehrer“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1.1.2 Berufsbezeichnung „Lehrerin/Lehrer“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.2 Trainerinnen und Trainer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.3 Ausbilderinnen/Ausbilder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.4 IT-Administratoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.5 Entscheidungsträger in Bildungsfragen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2 Potenzielle Einsatzbereiche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2.1 Allgemeinbildende Schulen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2.1.1 Primärstufe und Kita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2.1.2 Sekundarstufe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
2.1.2.1 Präsenzbegleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
2.1.2.2 Hausaufgaben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
2.1.2.3 Förderkurse/Vertiefungskurse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
2.2 Hochschulen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
2.2.1 Sonderfall Fernstudium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
2.2.2 Sonderfall MOOCs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
2.3 Aus- und Fortbildung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
2.3.1 Betriebsinterne Mitarbeiterschulung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
2.3.2 Betriebliche Ausbildung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
2.3.3 Überbetriebliche Aus- und Fortbildung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24VI Inhalt
2.4 Bildungsmaßnahmen zur Rehabilitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
2.5 COVID 19 und die Grenzen der Sinnhaftigkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Teil II: Technik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
3 Der Moodle-Server . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
3.1 Systemvoraussetzungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
3.2 Webserver-Hardware . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
3.3 Webserver-Software . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
3.3.1 Webserver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
3.3.2 PHP-Versionen und PHP-Erweiterungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
3.3.2.1 PHP-Sprung auf Version 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
3.3.2.2 PHP-Erweiterungen für Moodle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
3.3.2.3 php.ini im System finden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
3.3.2.4 php.ini bearbeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
3.3.3 Datenbanken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
3.3.4 Webserver auf Linux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
3.3.4.1 Prüfung der Systemvoraussetzungen . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
3.3.4.2 Software-Installation auf der Konsole . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
3.3.4.3 Einfacher mit grafischer Oberfläche . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
3.3.4.4 Datenbankserver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
3.3.4.5 Anpassung älterer Systeme für das Upgrade . . . . . . . . . . . 65
3.3.4.6 Das Moodle-Datenverzeichnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
3.3.4.7 Systemsicherheit und Benutzerrechte für den Webserver. 69
3.3.4.8 Der Cron-Job . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
3.3.5 Moodle auf einem öffentlichen Webspace? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
3.3.5.1 Übertragung der Moodle-Dateien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
3.3.5.2 Datenbank für den öffentlichen Webspace . . . . . . . . . . . . . 81
3.3.5.3 Webserver und Moodle-Datenverzeichnis . . . . . . . . . . . . . 83
3.3.5.4 PHP-Erweiterungen ohne Zugriff auf php.ini . . . . . . . . . . 84
3.4 Moodle einer Domain zuweisen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
3.5 Bei Upgrade/Update zu beachten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
3.5.1 Datenbank sichern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
3.5.2 Sicherheitskopie des Moodle-Datenverzeichnisses . . . . . . . . . . . . . . 91
3.5.3 Moodle-Verzeichnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
3.5.4 Backup-Funktionen in Moodle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
4 Moodle-Grundinstallation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
4.1 Moodle-Programmpakete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
4.2 Moodle in verschiedenen Umgebungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
4.2.1 XAMPP-Moodle-Installer-Package . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
4.2.2 Moodle in einer Linux-Umgebung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
4.2.2.1 Bezug der Moodle-Paket-Dateien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
4.2.2.2 Installation mit git-Versionsverwaltung . . . . . . . . . . . . . . . 105
4.2.2.3 Updates mit git . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108Inhalt VII
4.3 Installation von Moodle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
4.4 Plugins für Moodle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
4.4.1 Das richtige Moodle-Plugin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
4.4.1.1 Bedarfskonferenz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
4.4.1.2 Recherchegrundlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
4.4.2 Installation eines Plugins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
5 Benutzerverwaltung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
5.1 Neuer Benutzer/neue Benutzerin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
5.1.1 Selbstanmeldung per E-Mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
5.1.1.1 Schritt 1: Website-Administration: Plugins . . . . . . . . . . . . 129
5.1.1.2 Selbstregistrierung mit E-Mail-Adresse . . . . . . . . . . . . . . . 131
5.1.2 Anmeldung durch Administrator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
5.1.3 Weitere Authentifizierungs- und Registrierungsverfahren . . . . . . . 140
5.1.3.1 LTI® – Learning Tools Interoperability . . . . . . . . . . . . . . . . 141
5.1.3.2 LDAP – Lightweight Directory Access Protocol . . . . . . . . . 143
5.1.3.3 CAS – Central Authentication Server . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
5.2 Kennwortregeln bearbeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
5.3 Benutzerprofile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
5.3.1 Standard-Profilfelder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
5.3.2 Weitere Profilfelder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
5.3.3 Benutzerprofile per Bulk-Upload einrichten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
5.4 Benutzerlisten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
5.4.1 Nach Benutzerin oder Benutzer suchen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
5.4.2 Nach anderen Kriterien suchen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
5.4.3 Benutzerverwaltung (Bulk) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
5.5 Globale Gruppen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
5.5.1 Globale Gruppen anlegen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
5.5.2 Globale Gruppen als CSV-Datei importieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
6 Rollen im Moodle-System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
6.1 Rollen in verschiedenen Moodle-Kontexten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
6.2 Standardrollen in Moodle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
6.2.1 Administrator/Administratorin (admin) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
6.2.2 Manager/Managerin (manager) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
6.2.3 Kursersteller/Kurserstellerin (course creator) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
6.2.4 Trainer/Trainerin (teacher) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
6.2.5 Standardteilnehmerin/Standardteilnehmer (student) . . . . . . . . . . . . 179
6.2.6 Gäste (guest) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
6.2.7 Authentifizierte Nutzerinnen und Nutzer (user) . . . . . . . . . . . . . . . . 180
6.2.8 Authentifizierte Nutzer in der Startseite (frontpage) . . . . . . . . . . . . 181
6.3 Individuelle Rollen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
6.4 Rollen verwalten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
6.5 Rechte/Fähigkeiten bei Standardrollen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194VIII Inhalt
7 Bereichs- und Kursverwaltung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
7.1 Kursbereiche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
7.2 Grundeinstellungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
7.3 Kurse anlegen und Kursanträge bearbeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
7.3.1 Kurse zentral anlegen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
7.3.2 Kursanträge bearbeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
7.3.3 Recht, eigene Kurse zu erstellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224
7.4 Import und Export von Kursen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
7.4.1 Sicherung eines Kurses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
7.4.2 Wiederherstellung eines Kurses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
7.4.3 Import eines Kurses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239
7.4.4 Kurs aus CSV-Datei laden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240
7.5 Einschreibung in Kurse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252
7.5.1 Manuelle Einschreibung durch Lehrende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
7.5.2 Selbsteinschreibung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257
7.5.3 Meta-Einschreibung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261
7.5.4 Einschreibung mithilfe einer CSV-Liste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264
7.5.5 Einschreibung als Gast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274
7.6 Kurse löschen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277
8 E-Mail-Kommunikation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281
8.1 Konfiguration für ausgehende E-Mails . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282
8.2 SMTP-Konfiguration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282
8.3 No Reply . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284
8.4 Anzeigeeinstellungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284
8.5 Test der Einstellungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285
8.6 E-Mail-Posteingang für Moodle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287
8.7 E-Mail-Texte ändern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287
8.8 Mitteilungsverwaltung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289
9 Designs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291
9.1 Logos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291
9.2 Design (Theme) importieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294
Teil III: Moodle in der Praxis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301
10 Moodle im Überblick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303
10.1 Dashboard und Startseite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304
10.1.1 Startseite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304
10.1.2 Dashboard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309
10.2 Blöcke in Moodle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313
10.2.1 Aktuelle Termine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313
10.2.2 Block hinzufügen (sichtbar im Bearbeitungsmodus) . . . . . . . . . . . . . 313Inhalt IX
10.2.3 Eigenes Profil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314
10.2.4 Einstellungen (sichtbar im Bearbeitungsmodus) . . . . . . . . . . . . . . . . 314
10.2.5 Favorisierte Kurse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315
10.2.6 Globale Suche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316
10.2.7 Glossareintrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320
10.2.8 Kalender . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322
10.2.9 Kommentare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324
10.2.10 Kursübersicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325
10.2.11 Letzte Badges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326
10.2.12 Meine Kurse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327
10.2.13 Mentoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328
10.2.14 Navigation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332
10.2.15 Neue Ankündigungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332
10.2.16 Personen Online . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333
10.2.17 Zeitleiste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334
10.2.18 Zuletzt besuchte Kurse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335
10.2.19 Zuletzt genutzte Objekte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335
11 Aktivitäten – Werkzeuge zur Kursgestaltung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337
11.1 Kurse verwalten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337
11.2 Arbeitsmaterialen in Kursen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343
11.2.1 Textfelder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344
11.2.2 Dateien als Arbeitsmaterial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349
11.2.3 Dateien und Verzeichnisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352
11.2.4 Verlinkungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355
11.3 Arbeitsmaterialien interaktiv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357
11.3.1 Buch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358
11.3.2 Glossar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361
11.3.2.1 Einrichtung eines Glossars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362
11.3.2.2 Eintrag hinzufügen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365
11.3.2.3 Einträge zur Freigabe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367
11.3.3 Wiki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368
11.3.4 Datenbanken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375
11.3.4.1 Anlage einer Datenbank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376
11.3.4.2 Bearbeitung der Datenbank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382
11.4 Kommunikative Komponenten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385
11.4.1 Foren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 386
11.4.2 Chatfunktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390
11.4.3 Aufgabe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 394
11.4.4 Workshop/gegenseitige Beurteilung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403
11.4.4.1 Konfiguration (Vorbereitungsphase) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404
11.4.4.2 Bearbeitungsphase/Einreichungsphase . . . . . . . . . . . . . . . 410
11.4.4.3 Beurteilungsphase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413
11.4.4.4 Einstufung und Bewertung der Einstufung . . . . . . . . . . . . 417
11.4.4.5 Abschlussphase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419X Inhalt
11.4.5 Abstimmung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 421
11.4.6 Echtzeitbefragung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425
11.5 Abgestufte Lektionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 432
11.5.1 Inhaltsseiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 436
11.5.1.1 Gestaltung der Inhaltsseiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 436
11.5.1.2 Inhaltsseiten aus Student-Sicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440
11.5.2 Frageseiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 442
11.5.2.1 Freitextfragen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 443
11.5.2.2 Kurzantwort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 443
11.5.2.3 Multiple Choice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 446
11.5.2.4 Numerisch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 448
11.5.2.5 Wahr/Falsch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 448
11.5.2.6 Zuordnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 451
11.6 Berücksichtigung des Lernfortschritts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 453
11.7 Umfragen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454
11.7.1 ATTLS-Umfrage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455
11.7.2 COLLES-Umfrage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 457
11.7.3 Umfrage zu kritischen Ereignissen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 460
12 Ergänzende Lernhilfen für Moodle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 463
12.1 Installation eines Lernspiel-Plugins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 463
12.2 Flash Cards . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 467
12.2.1 Konfiguration der Aktivität . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 469
12.2.2 Erstellung von Fragen und Antworten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 472
12.2.3 Das Spiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 474
12.2.4 Auswertung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 477
12.3 Das Plugin „Game“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 478
12.3.1 Hangman – Galgenmännchen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 480
12.3.2 Kreuzworträtsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 483
12.3.3 Cryptex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 485
12.3.4 Sudoku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 488
12.3.5 „Wer wird Millionär“-ähnliches Spiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 489
12.4 Standards für externe Lernpakete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 491
12.4.1 Learning Tools Interoperability® (LTI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 492
12.4.2 Shareable Content Object Reference Model (SCORM) . . . . . . . . . . . . 492
12.5 Externe Tools (Auswahl) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 493
12.5.1 Hot Potatoes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 493
12.5.1.1 Hot Potatoes – externes Programm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 494
12.5.1.2 JCloze – der Lückentext . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 495
12.5.1.3 JQuiz – Multiple Choice-Fragen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 496
12.5.1.4 JCross – das Hot-Potatoes-Kreuzworträtsel . . . . . . . . . . . . 497
12.5.1.5 JMatch – Zuordnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 499
12.5.1.6 JMix – der „Schüttelsatz“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 499
12.5.1.7 Der Masher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
12.5.1.8 Hot Potatoes in Moodle verwenden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 501Inhalt XI
12.5.2 HTML 5 Package (H5P) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 504
12.5.2.1 H5P-Inhaltstypen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 506
12.5.2.2 H5P in Moodle-Aktivitäten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 509
12.5.2.3 H5P-Aktivität in Moodle-Kursen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 514
13 Fragenkataloge in Moodle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 521
13.1 Fragenkategorien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 522
13.1.1 Anlegen einer Fragenklasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 523
13.1.2 Klassifizierung von Schwierigkeitsgraden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 526
13.2 Anlage einer neuen Frage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 527
13.3 Fragetypen und Syntax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 529
13.3.1 Multiple Choice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 529
13.3.2 Wahr/Falsch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 534
13.3.3 Zuordnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 535
13.3.4 Kurzantwort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 536
13.3.5 Numerisch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 539
13.3.6 Freitext . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 542
13.3.7 Berechnet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 544
13.3.8 Berechnete Multiple Choice-Aufgabe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 555
13.3.9 Drag and Drop auf ein Bild . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 560
13.3.10 Drag and Drop auf einen Text . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 568
13.3.11 Drag and Drop auf Markierungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 571
13.3.12 Einfach berechnet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 576
13.3.13 Lückentext . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 579
13.3.14 Lückentextauswahl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 585
13.3.15 Zufällige Kurzantwort-Zuordnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 586
13.4 Import und Export von Fragen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 587
13.4.1 Export eines Fragenkatalogs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 588
13.4.2 Export einer einzelnen Frage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 590
13.4.3 Import eines Fragenkatalogs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 591
13.5 Dateiformate für den Fragen-Import und -Export . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 592
13.5.1 AIKEN-Format . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 592
13.5.2 GIFT-Format . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 593
13.5.3 Moodle-XML-Format . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 597
13.5.4 XHTML-Format . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600
14 Lernzielkontrollen und Prüfungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 603
14.1 Kontrollübungen in Lektionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 603
14.2 Gestaltung elektronischer Prüfungsumgebungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 604
14.3 Klassische Prüfungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 604
14.4 Die Aktivität „Test“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 605
14.4.1 Bewertung der Prüfung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 607
14.4.2 Begrenzung auf bestimmte Netzwerkbereiche . . . . . . . . . . . . . . . . . . 610
14.4.2.1 Parallelanmeldungen vermeiden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 611XII Inhalt
14.4.2.2 Vollbild-Modus erzwingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 612
14.4.2.3 Nachträgliches Betrugsindiz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 614
14.4.3 Test und Testfragen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 616
14.4.3.1 Fixierte Prüfung mit gleichen Fragen . . . . . . . . . . . . . . . . . 618
14.4.3.2 Prüfung mit zufälligen Fragstellungen . . . . . . . . . . . . . . . . 620
14.4.4 Prüfung durchführen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 622
14.4.5 Prüfungsverlauf und Ergebnisberichte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 627
14.4.5.1 Ergebnisübersicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 627
14.4.5.2 Eingriffe in Einzelfälle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 631
14.4.5.3 Ergebniskorrekturen und Zusatzversuche . . . . . . . . . . . . . 634
14.4.5.4 Grundsätzliche manuelle Bewertung . . . . . . . . . . . . . . . . . 637
14.5 Der Safe Exam Browser der ETH-Zürich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 640
14.6 Leistungen einzelner Students . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 645
Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 651Vorwort Die Entwicklung der Lehre wurde maßgeblich durch Veränderungen in den verfügbaren Medien beeinflusst. So eröffnete die Erfindung des Buchdrucks einst die Möglichkeit, Wis- sen auch durch Selbststudium zu erwerben. Das war ein Beitrag zur Befreiung für eine größere Bevölkerungsschicht von einer rein elitären Bildung hin zur Breitenbildung. Aus reinen Vorlesungen wurden allmählich Lehrveranstaltungen, die es Lernenden gestatteten, sich auch aus verschiedenen Quellen zu informieren. Mit den Möglichkeiten der modernen Computertechnologie, der Smartphones und des Internets eröffnen sich völlig neue Bildungsoptionen. Es ist nicht nur möglich, in kürzester Zeit in mehreren Quellen zu recherchieren, sondern auch örtlich unabhängig zu lernen. Setzt man nun diesen Gedanken fort, wird sich zwangsweise eine sehr kühne Idee in eine prominente Position stellen: schulübergreifendes Lernen. Dagegen sprechen heute noch durchaus Fragen der Budgetierung und der Planung personeller Ressourcen. Die Struktu- ren sind darauf noch nicht ausgelegt. Es sollte aber möglich sein, in der Regie einzelner Schulen oder Hochschulen Kooperationen mit Partnerschulen auf internationalem Niveau einzugehen. Dies fördert die Sprach- und die Kulturbildung. Moodle ermöglicht solche Kooperationen. Es lassen sich spezielle Bereiche einrichten und Lernende aus mehreren internationalen Schulen in die Kurse gemischt einschreiben. Hier braucht es lediglich das Wollen! Die Lernplattform Moodle wird heute bereits oft eingesetzt, aber keinesfalls deren Poten ziale auch nur annähernd ausgenutzt. Die am meisten eingesetzte Aktivität ist die Bereit- stellung von Dateien zum individuellen Download. Hier werden oft PDF-Dateien auf die Plattform gestellt. Das ist zu wenig, um einen tatsächlichen Mehrwert in der Lehre zu errei- chen. Es kommt noch schlimmer, denn die alleinige Ablage von PDF-Dateien und Präsen tationen im Moodle-System verführt förmlich dazu, den Bezug zum Arbeitsaufwand für die Lernenden zu verlieren. Die Folge sind Überlastungen. Ähnlich sieht es mit dem Einsatz von Moodle als Abgabemedium für Hausaufgaben aus: Moodle ermöglichst dies auf die Minute genau zu einem bestimmten Termin. Außerdem wird die Abgabe auf ein einziges Medium fokussiert und ist in den Protokollen grundsätz- lich bei Unstimmigkeiten nachvollziehbar. Leider ist jedoch zu beobachten, dass Moodle (und auch andere Lernplattformen) sehr häu- fig unterschätzt und das Prinzip einer E-Learning-Komponente missverstanden werden. In Gesprächen mit Lehrerinnen und Lehrern wird in den allermeisten Fällen zuerst die
XIV Vorwort
Befürchtung der menschlichen Entfremdung durch „E-Learning“ geäußert. Auch die Sorge,
E-Learning könne zur weiteren Rationalisierung beitragen und damit den Lehrermangel
noch verschärfen, wird postuliert. Tatsächlich gibt es auch die Meinung, dass der verstärkte
Einsatz elektronischer Lehrmittel dem Lehrermangel durch Rationalisierungseffekte ent-
gegenstehen könnte. Das ist bei detaillierter Betrachtung ein Trugschluss! Reines E-Lear-
ning hat durchaus einen Sinn für die Fortbildung. Es bietet die Möglichkeit, quasi vom
System und von Lehrenden unterstützt, autodidaktisch aktuelles Wissen anzueignen und
zu vertiefen.
In der schulischen Bildung stellen elektronische Lernplattformen ein ideales Hilfsmittel zur
Unterstützung des Präsenzunterrichts dar. Es können vertiefende Informationen angebo-
ten, aber auch in dieser Plattform gut kontrollierbare Gruppenarbeiten umgesetzt werden.
Das erleichtert eine gerechte Beurteilung erbrachter Leistungen, weil das System die Vor-
gänge der Lernenden protokolliert. Zudem bietet Moodle die Möglichkeit, über gegenseiti-
ges Feedback nicht nur Objektivität und Fairness zu trainieren und damit auch die sozialen
Kompetenzen zu schärfen, sondern auch über diesen Weg den Stand des Fachwissens der
Lernenden zu prüfen.
Moodle-Aktivitäten müssen nicht grundsätzlich in der Form opulenter Kursunterlagen oder
aufgeblähter Lektionen gestaltet werden. Es ist durchaus möglich – und oft auch sinnvoll –,
kurze elektronische Lernzielkontrollen direkt in den Präsenzunterricht einzubauen. Kurze
Feedbackfragen, wie zum Beispiel ein Zuordnungsspiel, können das gerade Gelernte über-
prüfen. Allein die Möglichkeit, dass derartige (protokollierte) Abfragen während des Unter-
richts oder während einer Vorlesung gestellt werden, wird die Aufmerksamkeit steigern.
Natürlich können Lernzielkontrollen noch weiter gestaltet und bis hin zur vollständigen
und rechtssicheren Prüfung rein elektronisch umgesetzt werden. Wer hier jedoch zuerst an
Rationalisierung denkt, muss enttäuscht werden, denn es wird nach wie vor Aufsicht füh-
rendes Personal benötigt und es sind entsprechende Infrastrukturen erforderlich. Einen
echten Zeitgewinn können Lehrende durchaus für sich verbuchen, wenn sie anstelle – oft in
einer abenteuerlichen Form verfasster – handschriftlicher Prüfungsabgaben einen auf dem
Computer geschriebenen und somit problemlos lesbaren Text korrigieren müssen. Leh-
rende gewinnen hier persönliche Freizeit, denn diese Korrekturtätigkeiten finden fast
immer daheim statt.
Um Moodle und die Potenziale dieses Systems zu entdecken, kann ein eigenes kleines Expe-
rimentalsystem nützlich sein. Es eignet sich auch dazu, eigene Kurse oder Prüfungsfragen
zu entwickeln. Dieses Werk stellt also in zwei großen Themenschwerpunkten sowohl die
technischen Rahmenbedingungen als auch den praktischen Einsatz des Systems in der
Lehre vor. Dies beginnt bei der Server-Technologie von Moodle einschließlich der erforder-
lichen Systemvoraussetzungen. Die Einrichtung und die Administration eines Moodle-Sys-
tems und nicht zuletzt die praktischen Einsatzmöglichkeiten in Kursen (sowohl rein digital
als auch präsenzunterstützend) bis hin zur Durchführung elektronischer Prüfungen bilden
die Schwerpunkte.Vorwort XV Danksagung Mein Dank richtet sich an Frau Dr. Gabriele Frankl von der Alpen-Adria-Universität in Kla- genfurt, die mir vor einigen Jahren die Möglichkeit bot, nebenberuflich das Moodle-System und vor allem dessen Einsatz in einer sicheren Prüfungsumgebung kennenzulernen. Ebenso danke ich dem Team der Kärntner Berufsförderungsinstitut GmbH (bfi Kärnten) und hier speziell dem ehemaligen Moodle-Administrator Thomas Weiher sowie Frau Mag. Verena Roßmann, Leiterin des eLearning Centers. Für interessante Gespräche und themati- sche Anregungen am Rande von Lehrveranstaltungen zu E-Learning und Blended Learning danke ich Herrn Asc. Prof. (FH) Mag. (FH) Hans-Peter Steinbacher, MA von der FH Kufstein und Herrn Prof. Dr. Peter Baumgartner von der Donau-Universität Krems. Bedanken möchte ich mich auch bei den fleißigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Verlages, ohne die ein solches Werk nicht machbar wäre. Namentlich möchte ich mich bei Frau Brigitte Bauer-Schiewek und Frau Kristin Rothe vom Carl Hanser Verlag sowie bei Frau Petra Kienle für ihren Einsatz bei der Fehlerkorrektur bedanken. Mein ganz besonderer Dank richtet sich an meine Familie und speziell an meine Frau Gabi für die große Geduld und für die aktive Unterstützung bei der Verfassung dieses Buchs. Techelsberg im Juni 2020 Robert Schoblick
Der Autor
Robert Schoblick, Jahrgang 1964, lernte im Elektro
handwerk, studierte Nachrichtentechnik an der FH der
Deutschen Bundespost (später FH der Deutschen Tele-
kom AG) und später Elektro- und Informationstechnik
mit dem Schwerpunkt regenerative Energietechnik an
der Fernuniversität in Hagen. Lange Zeit war Schoblick
hauptberuflich als Fachjournalist und Buchautor tätig.
2012 bekam er den ersten beruflichen Kontakt mit dem
Lernmanagementsystem Moodle, was an der Alpen-
Adria-Universität Klagenfurt für rechtlich s ichere Prü-
fungen mit großem Erfolg eingesetzt wird. Seit 2015
arbeitet er sehr intensiv in der Ausbildung Jugendli-
cher sowie in der Erwachsenenbildung als zertifizierter
Fachtrainer (SystemCERT, Österreich). Neben Firmen-
kunden betreute er auch Arbeitsuchende, Beeinträch-
tigte und Strafgefangene in der JVA Klagenfurt.
Der Autor dieses Werks hat in einem knapp 40-jährigen Berufsleben einen ständigen
Wandel der Technologien erleben können. Das betrifft auch den Wandel in der Bildung. Er
genoss seine Schulzeit im klassischen Frontalunterricht. „Multimediales Highlight“ war die
gelegentliche Präsentation eines Films, projiziert von einer Zelluloidrolle oder später ein
Video (VHS, Beta-Max, Video 2000). „PowerPoint“ hieß damals noch Overhead-Projektor! In
diesen Jahren gab es auch bereits Fernkurse. Es wurden monatlich Lehrbriefe verschickt
und Übungsaufgaben an das Institut eingesendet. Schoblick nahm in diesen Zeiten wäh-
rend eines längeren unfallbedingten Krankenhausaufenthalts – noch als Jugendlicher – an
solchen Fernkursen teil und erwarb die theoretischen Grundlagen, um damit innerhalb
der regulären Ausbildungszeit die Gesellenprüfung abzulegen. Auch den letzten Hochschul
abschluss erlangte er berufsbegleitend über ein Fernstudium.
Schoblick erlebte als junger Ingenieur in den letzten Jahren der Behörde „Deutsche Bun-
despost“ und in den ersten Jahren der Deutschen Telekom AG die Umstellung alter elek
tromechanischer Telefon-Vermittlungstechnik hin zur digitalen Technik einschließlich der
Einführung einer digitalen Anschlusstechnik (ISDN). Diese Jahre waren prägend, denn der
Technologiewandel vollzog sich in rasanter Geschwindigkeit. Die älteren Kolleginnen und
Kollegen, kurz zuvor noch die „Wissenden“, waren nun plötzlich zweite Wahl für anspruchs-XXII Der Autor
volle Aufgaben. Ihre Erfahrung verlor zu einem großen Teil an Bedeutung. Fortbildungen
stellten bereits damals einen signifikanten Kostenfaktor dar. Kurse für Technik, aber auch
für die Mess- und Servicegeräte bekamen nur wenige Mitarbeiter. Es entstanden Eliten, was
kurz vor dem Telekom-Börsengang und den damit verbundenen Rationalisierungen Ängste
verbreitete. In seinen Büchern und Lehrgängen ist es deswegen grundsätzlich Schoblicks
Ziel, auch wieder einen Beitrag zur Herstellung der Chancengleichheit zu leisten.11.3 Arbeitsmaterialien interaktiv 361
Bild 11.27 Aus Sicherheitsgründen ist es der Regelfall, dass Lernende zwar die Kapitel eines Buchs
lesen, jedoch nicht bearbeiten dürfen. Sie finden in ihrer Seite auch keinen Button, um in den
Bearbeitungsmodus umzuschalten.
11.3.2 Glossar
Ein Glossar, ein Wörterbuch, gehört zu den wichtigsten Elementen einer Wissensdaten-
bank, als die das Moodle-System durchaus angesehen werden kann. Die gängigsten Orte
zur Platzierung eines Glossars sind die Startseite oder ein Kurs. In Ausnahmefällen kann
ein Glossar auch als Kursübergreifend deklariert werden. Dieses Glossar ist dann auch
außerhalb des Kurses zugänglich und kann beispielsweise in einen Block eingebunden wer-
den. Allerdings steht ausschließlich der Administration das Recht zu, ein Glossar kursüber-
greifend zu deklarieren.
Kursübergreifendes Glossar ist Chefsache!
Die Deklaration eines kursübergreifenden Glossars ist ausschließlich der
Administration vorbehalten. Dies ist sinnvoll, um ein systemweites Definitions-
chaos zu vermeiden.
■
Interessant am Glossar ist die Möglichkeit, dass die Einträge von den Lernenden erarbeitet
werden können. Unter Umständen ist es in diesen Fällen sinnvoll, Mehrfacheinträge zu
zulassen. Das bedeutet, dass unter Umständen zu einem Begriff mehrere Definitionen im
Glossar vorhanden sein können. Das Qualitätsniveau eines – von Lernenden erarbeiteten –
Glossars lässt sich deutlich steigern, wenn die Einträge vor der Veröffentlichung im Mood-
le-System von einem Lehrenden geprüft und freigegeben werden. Dazu muss in der Konfi-
guration des Kurses der Eintrag Ohne Prüfung auf Nein gesetzt werden.
Prüfung vor Veröffentlichung
Die Entwicklung eines Glossars ist eine anspruchsvolle Aufgabe für Lernende.
Die Ergebnisse sollten jedoch nicht unreflektiert bleiben.
■362 11 Aktivitäten – Werkzeuge zur Kursgestaltung
11.3.2.1 Einrichtung eines Glossars
Ein Glossar wird im Kurs von der Teacher-Rolle verwaltet. Das betrifft die Einrichtung des
Glossars und auch einen möglichen Vorbehalt der Veröffentlichung. Dieses bedeutet, dass
die Teacher-Rolle entscheidet, ob die Inhalte des Glossars ausschließlich von einer Person
gestaltet werden, die ebenfalls eine Teacher-Rolle in diesem Kurs einnimmt oder ob die
inhaltliche Gestaltung auf die Lernenden delegiert werden soll. Im letzteren Fall kann den-
noch eine Einschränkung formuliert werden, nämlich, dass eine lehrende Person den Ein-
trag vor der Veröffentlichung prüfen und freigeben muss.
Die Einrichtung des Glossars sieht neben den üblichen Pflichtfeldern (Name des Glossars
und eine Beschreibung, welche optional sichtbar geschaltet werden kann) auch weitere
Parameter vor.
Wichtig ist zunächst einmal eine Entscheidung, ob das Glossar ein Primär- oder ein Sekun-
därglossar sein soll. Es mag zunächst verwundern, dass die Grundeinstellung Sekundär-
glossar lautet, denn würde man nicht zunächst mit der höchsten Priorität beginnen? In der
Praxis funktionieren beide Typen im Grunde genommen identisch. Es kann jedoch lediglich
ein einziges Primärglossar in einem Kurs eingerichtet werden. In dieses können Einträge aus
beliebigen Sekundärglossaren des Kurses importiert werden.
Begriffe des Glossartypus
Das Primärglossar wird auch als Hauptglossar und das Sekundärglossar als
Normalglossar bezeichnet. Dies verdeutlicht zweckmäßiger, welcher Glossar-
typus vorzugsweise zu wählen ist, wenn keine Importe aus anderen Glossaren
vorgesehen sind.
■
Im Weiteren wird der Umgang mit den Einträgen in das Glossar und die Darstellung des
Glossars als solches konfiguriert. Bei den Einträgen wird zunächst festgelegt, ob Autoren
der Einträge – und dies dürfen bekanntlich auch Lernende sein – ihre Beiträge direkt, also
ohne Freigabe der Lehrenden im Glossar veröffentlichen dürfen. Dies wird mit dem Feld
Ohne Prüfung festgelegt. Wird diese Einstellung auf „Nein“ gesetzt, so wird der Beitrag erst
nach Freigabe sichtbar.
Die Bearbeitung lässt sich einschränken, um eine gewisse Stabilität der Inhalte zu gewähr-
leisten. Wird die Option Immer bearbeitbar auf „Nein“ gesetzt, kann der Autor einen Beitrag
nur innerhalb eines von der Administration festgelegten Zeitraums bearbeiten. Die Stan-
dardeinstellung ist 30 Minuten. Wird die Einstellung auf „Ja“ gesetzt, kann der Eintrag
grundsätzlich jederzeit bearbeitet werden.
Die Möglichkeit, Mehrfacheinträge zu einem Begriff zuzulassen, wird in der Praxis meist
sehr strittig betrachtet. Auf der einen Seite lassen sich Arbeiten von mehreren Lernenden
zu einem Thema im Glossar zum Vergleich online stellen, auf der anderen Seite wird das
Glossar jedoch schnell unübersichtlich und bei verschiedener Auslegung der Begriffe auch
widersprüchlich. Damit verliert es den Charakter eines Nachschlagewerks.
Kommentare in einem moderierten System sind durchaus bereichernd. Besonders in einem
Glossar eignen sich Kommentare, um konstruktive Kritik zu den Beiträgen zu formulieren
oder – wertschätzend – auf Fehler hinzuweisen. Eine Moderation ist aber durchaus wün-11.3 Arbeitsmaterialien interaktiv 363 schenswert, da wertschätzendes und respektvolles Miteinander in einer zunehmend digita- lisierten Kultur nicht mehr selbstverständlich sind. Das setzt einen gewissen personellen Aufwand voraus. Kann dieser nicht geleistet werden, ist es möglich, die Kommentierung zu unterbinden. Ist die automatische Verlinkung aktiviert, werden Begriffe in den Texten markiert und auto- matisch auf das Schlagwort verlinkt. Für die Darstellung eines Glossars kann eine von sieben Ansichten mit verschiedenen Infor- mationsvolumina gewählt werden. Zusätzlich wird mit der Konfiguration festgelegt, ob ein alphabetischer Index dargestellt werden soll. Dies ist zu empfehlen, weil es die alphabeti- sche Suche erleichtert. Es sind auch rein praktische Einstellungen in dieser Rubrik vorzunehmen. Beispielsweise kann die Zahl der angezeigten Einträge definiert werden. Die Standardeinstellung wurde auf eine Listung von maximal zehn Einträgen festgelegt. Es kann zudem eine einfache Auf- bereitung in ein druckbares Darstellungsformat aktiviert werden. Ein Ausdruck auf dem Papier ist damit ohne störende Randbereiche des Moodle-Systems und damit papiersparend möglich. Bild 11.28 Wie jede Aktivität muss auch ein Glossar explizit benannt werden. Eine Beschreibung ist erforderlich, deren Einblendung ist jedoch wahlfrei.
364 11 Aktivitäten – Werkzeuge zur Kursgestaltung
Bild 11.29 Die Checkbox „Kursübergreifendes Glossar“ steht allein der Administration zur
Verfügung.
Bild 11.30 Hier sind sehr wichtige Einstellungen vorzunehmen: So wird entschieden, ob Autoren ihre
Beiträge direkt posten dürfen oder ob eine lehrende Person die Beiträge prüfen und freigeben muss.11.3 Arbeitsmaterialien interaktiv 365 11.3.2.2 Eintrag hinzufügen Einen Beitrag kann jede Teilnehmerin oder jeder Teilnehmer anlegen, wenn die Schaltflä- che Eintrag hinzufügen im Bild vorhanden ist. Es sind bis zu vier Eingaben zu machen: Der Name des Begriffs, wie er später auch im Index erscheinen wird, und dessen Erklärung sind Pflichteinträge. Darüber hinaus können Synonyme des Begriffs angegeben werden. Neben der Beschreibung des Begriffs können zusätzlich auch Dateien auf das System hoch- geladen werden, die in einem direkten Zusammenhang mit dem erläuterten Begriff stehen. Bild 11.31 Das Glossar wächst dynamisch mit den Einträgen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Dies müssen nicht zwingend Lehrende sein.
366 11 Aktivitäten – Werkzeuge zur Kursgestaltung
Bild 11.32 Der Begriff wird als Stichwort definiert und eine Erklärung in einem HTML-Textfeld
formuliert. Zweckmäßig ist zudem bei Bedarf die Eingabe von Alternativbegriffen.
Bild 11.33 Nach der direkten Eingabe oder einer eventuell erforderlichen Freigabe wird der Begriff
ins Glossar aufgenommen.11.3 Arbeitsmaterialien interaktiv 367
11.3.2.3 Einträge zur Freigabe
Der Einsatz eines Glossars ist mit dem Risiko des Cross Site Scripting verbunden. Nichts-
destotrotz ist das Glossar ein wertvolles interaktives Bildungsinstrument, weil es Lernende
direkt in die Gestaltung der Unterrichtsmedien mit einbezieht und damit auch Verantwortung
an diese überträgt. Dennoch sollte die Gestaltung des Glossars nicht anarchistisch erfolgen,
sondern die Prüfung der Beiträge durch eine Verantwortung übernehmende Person erfordern.
Alternative: Kollektives Feedback
Alternativ zur durch Lehrende mithilfe der Freigabebeschränkung gesteuerten
inhaltlichen Gestaltung des Glossars eröffnet eine nicht beschränkte Eingabe
eine offene Diskussion. Voraussetzung ist allerdings, dass das Glossar in
Verbindung mit der Möglichkeit Kommentare zu setzen konfiguriert wurde.
Zudem sollte eine ständige Bearbeitung möglich sein, damit Fehler von den
Autoren selbstständig behoben werden können. Die Kommentare reflektieren
die Leistungen auf Augenhöhe durch Lernende untereinander.
■
Wird die Eingabe unter Vorbehalt gemacht, ändert sich zunächst für die Autoren des Bei-
trags nichts. Es gibt lediglich einen Hinweis, dass dieser Beitrag für andere unsichtbar ist.
Lehrende bekommen beim Besuch des Glossars einen Hinweis, dass freizugebende Einträge
existieren. Sie können diese direkt aufrufen und bei Bedarf selbst bearbeiten. Sie können
aber auch eine direkte Entscheidung treffen und Beiträge löschen oder annehmen.
Bild 11.34 Setzt die Veröffentlichung im Glossar die Freigabe durch eine lehrende Person voraus,
so wird dem Autor nach der Formulierung des Beitrags ein Hinweis gesendet, dass der Beitrag für
andere Nutzerinnen und Nutzer nicht sichtbar ist.368 11 Aktivitäten – Werkzeuge zur Kursgestaltung
Bild 11.35 Das Lehrpersonal bekommt beim Besuch des Glossars einen Hinweis, dass zur Über
prüfung eingebrachte Beiträge vorliegen.
Bild 11.36 Lehrende können dem Beitrag zustimmen (1, „Daumen hoch“) bzw. ihn ablehnen oder
direkt bearbeiten (2).
11.3.3 Wiki
Ähnlich wie ein Glossar stellt auch ein Wiki eine Art „Wörterbuch“ dar. Jedem ist gewiss die
weltweit bearbeitete Plattform Wikipedia bekannt. Vergleichbares kann man im kleinen
Ausmaß im eigenen Moodle-System realisieren. Wikis sind – wie auch bereits beim Glossar
gesehen – eine hervorragende Herausforderung für Gruppen. Das entspricht dem Prinzip
eines Wikis: Eine Autorin oder ein Autor verfasst einen Aufsatz über ein bestimmtes Thema.12.5 Externe Tools (Auswahl) 493
■■12.5 Externe Tools (Auswahl)
In diesem Abschnitt sollen nun zwei externe Lern-Tools vorgestellt werden:
Hot Potatoes kann über den SCORM-Standard in Moodle integriert werden. Hot Potatoes
gehört zu den etablierten Tools, bietet allerdings nur eine begrenzte Zahl von Lernspielen
an.
H5P ist eine noch sehr junge Technologie, die viel Potenzial für die Gestaltung multime-
dialer und interaktiver Lerninhalte bietet.
Beide externe Tools sind von großer Bedeutung in der Gestaltung didaktisch guter Lehr
konzepte. Sie dienen der Auflockerung elektronischer Kurse und fördern die Motivation
beim Lernen. Zudem bieten diese Tools die Möglichkeit, den Stoff auf verschiedene Weise zu
präsentieren. Man erreicht damit Lernende mit unterschiedlichen Talenten und Interessen.
12.5.1 Hot Potatoes
Hot Potatoes ist eine Art bildungstechnischer Kreativbaukasten, der aus sechs Komponen-
ten besteht. Zunächst einmal sind die fünf Programmmodule für die Gestaltung der inter-
aktiven Lehreinheiten zu nennen. Darüber hinaus gibt es den sogenannten Masher. Diese
Programmkomponente ist für die Kombination der Lehreinheiten und deren Export zu
ständig.
Die fünf Programmodule sind:
JQuiz – Multiple Choice-Quizfragen
JCloze – Lückentext
JCross – Kreuzworträtsel
JMatch – Zuordnung
JMix – der „Schüttelsatz“
Download Hot Potatoes
Hot Potatoes ist kostenlos auf der deutschsprachigen Seite zu bekommen.
Es empfiehlt sich, stets die aktuellste Version zu verwenden. Beta-Versionen
sind grundsätzlich noch in einer fortgeschrittenen Testphase und sollten für
den Live-Einsatz nur nach einer ausführlichen Prüfung verwendet werden.
https://www.hotpotatoes.de
■494 12 Ergänzende Lernhilfen für Moodle
Bild 12.39 Wer Programme aus dem Internet herunterlädt, sollte grundsätzlich die originalen
Quellen verwenden.
12.5.1.1 Hot Potatoes – externes Programm
Hot Potatoes ist ein eigenständiges Programm. Es werden also keinerlei administrative
Rechte im Moodle-System benötigt, um Lehrinhalte mit Hot Potatoes zu erstellen. Um diese
später in einen Kurs einzugliedern, benötigt es allerdings Teacher-Rechte. Diese sind nötig,
um ein externes Lernpaket zu verwenden.
Die Kurseinheiten werden einzeln in jeweils einem Lernspiel erstellt. Mithilfe des Mashers
werden die Lektionen kombiniert und in das richtige Format exportiert. Die Bedienung
erfolgt über ein grafisches Menü des Programmfensters.
ild 12.40
B
Hot Potatoes ist ein Paket aus fünf
verschiedenen Lernspielen.12.5 Externe Tools (Auswahl) 495
12.5.1.2 JCloze – der Lückentext
In Moodle gibt es den Fragentyp5 Lückentext. Dieser Aufgabentyp ist jedoch mit einer recht
unkomfortablen Syntax verbunden, um die Fragen zu entwickeln. Hot Potatoes bietet hier
mit JCloze eine Alternative. Dabei ist es nicht notwendig, besondere Regeln zu beachten. Es
wird einfach der Textblock in das Editorfenster hineinkopiert und in diesem Text werden
bei Bedarf die entsprechenden Lücken eingebaut. Das passiert mit einem Mausklick.
Lücken können gezielt gesetzt werden (empfohlen), wobei hier konkret die interessanten
Fachbegriffe ausgewählt werden. Alternativ dazu kann man automatisch Lücken setzen las-
sen, indem der Abstand der Lücken mit der Zahl der Wörter festgelegt wird. Diese Variante
eignet sich für Sprachtrainings, bei denen die Lernenden die Sätze vollenden müssen. Zu
kurze Intervalle sind jedoch schwierig, weil dann die Sätze nicht mehr mit eindeutigen
Worten rekonstruiert werden können.
Grundsätzlich können alle Lücken in der Aufgabenstellung direkt nachbearbeitet oder –
wenn sie ohne Sinn wären – aus dem Text gelöscht werden. In diesem Fall wird der Text mit
dem ursprünglich an dieser Position befindlichen Begriff wiederhergestellt. Mit der Bear-
beitung der Lücken ist es möglich, wahrscheinlich verwendete Alternativbegriffe festzu
legen, die ebenfalls als richtig angesehen werden. Wenn rein fachliche Begriffe geprüft
werden sollen, dann können auch mögliche Schreibfehler und Varianten verwendet werden.
Das sind zum Beispiel Groß- und Kleinschreibung, Schreibweisen mit „ss“ oder „ß“ etc.
Bild 12.41 Sollen einfache Schreibfehler toleriert werden? In diesem Fall kann zum Beispiel
ein kleingeschriebenes Lösungswort alternativ als richtig anerkannt werden.
5
Die Fragentypen des Moodle-Systems werden im Kapitel zu Fragenkatalogen in Moodle erläutert.496 12 Ergänzende Lernhilfen für Moodle
Bild 12.42 Um das fertige Lernspiel in Moodle importieren zu können, muss es aus Hot Potatoes
heraus in ein SCORM-Archiv exportiert werden.
12.5.1.3 JQuiz – Multiple Choice-Fragen
Multiple Choice-Fragen sind ein Klassiker in elektronischen Prüfungen. Sie haben den Vor-
teil, ein schnelles und eindeutiges Ergebnis liefern zu können. Allerdings sind diese Fragen
auch nicht unumstritten, was nicht allein für elektronische Prüfungen gilt. Bei Multiple
Choice-Fragen kommt es darauf an, nicht das Geschick des sinnerfassenden Lesens, son-
dern das Fachwissen zu prüfen.
Es werden eine Frage und mehrere Antworten zu dieser Frage formuliert. Die richtige Ant-
wort bzw. die richtigen Antworten werden mit einer Checkbox als richtig markiert. Sehr
wichtig bei elektronischen Lehrsystemen und vor allem bei den Prüfungen ist ein direktes
Feedback. Dies sollte sowohl bei einer richtigen, vor allem aber auch bei einer falschen
Antwort direkt erfolgen. In der Konfiguration der Antworten lässt sich ein Feedback formu-
lieren, was auch direkt auf die Antwortmöglichkeiten abgestimmt werden kann.
Ziel von Feedback in elektronischen Lernsystemen
Feedback gehört zu den wichtigsten didaktischen Werkzeugen einer Lehrerin
oder eines Lehrers. Es genügt nicht, einfach eine Antwort oder ein Statement
eines Lernenden mit richtig oder falsch zu bewerten. Die Bewertung muss
begründet werden, damit auch aus einem Fehler ein Lernerfolg erwachsen
kann. Besonders wichtig ist dies in elektronischen Lehrsystemen, wo es
meist keinen direkten Kontakt zu den Lehrenden gibt.
■12.5 Externe Tools (Auswahl) 497
Bild 12.43 Hot Potatoes bietet eine sehr einfache Oberfläche zur Erstellung von Multiple-
Choice-Fragen.
12.5.1.4 JCross – das Hot-Potatoes-Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel sind grundsätzlich sehr beliebt, vor allem im Sprachentraining, wo es auf
richtige Schreibweisen ankommt. Die Variante in Hot Potatoes kann nicht auf ein Glossar in
Moodle oder auf die im System vorhandene Fragensammlung zugreifen. Die Begriffe müs-
sen manuell in die Aufgabenstellung eingearbeitet und die zugehören Fragen entsprechend
formuliert werden. Das ist selbstverständlich mit einem gewissen Aufwand verbunden.
Es wird zuerst eine Wortliste erstellt. Diese enthält die Begriffe, die später in das Kreuzwort-
rätsel einzutragen sind. Aus dieser Wortliste wird das Raster erzeugt, in das die Lösungs-
begriffe horizontal und vertikal eingetragen werden. Damit ist die Lösung bei der Entwick-
lung des Rätsels bereits ersichtlich.
Die Fragen zu den Lösungsbegriffen werden nachträglich formuliert. Natürlich ist das eine
sehr zeitaufwendige Arbeit. Man kann allerdings Fragen und die Begriffe extern vorberei-
ten. Beispielsweise lassen sich Fragen und die Begriffe in einer Excel- oder LibreOffice-
Tabelle in größeren Volumina vorbereiten und dann per Copy and Paste in die Felder des
Hot-Potatoes-Programms einfügen.
JCross ist mit Vorbereitungsaufwand verbunden
Der Vorbereitungsaufwand für das JCross-Modul in Hot Potatoes ist vergleichs-
weise groß, weil Hot Potatoes als externes Tool nicht auf Moodle-interne
Fragensammlungen zugreifen kann. Es fehlt leider auch eine direkte Import-
Funktion auf Tabellen oder Textdateien.
■498 12 Ergänzende Lernhilfen für Moodle
ild 12.44
B
Zuerst werden die Lösungsbegriffe fest
gelegt. Das Raster und die Anordnung der
Begriffe errechnet Hot Potatoes.
Bild 12.45 Die Lösungsbegriffe werden nach der Berechnung des Rasters in dasselbe
automatisch eingetragen. Darum müssen sich Lehrende nicht kümmern.
ild 12.46
B
Nach dem Aufbau des Rasters
werden die Fragestellungen
zu jedem einzelnen Begriff
formuliert.12.5 Externe Tools (Auswahl) 499
12.5.1.5 JMatch – Zuordnung
Ein sehr einfaches Spiel, dessen Schwierigkeitsgrad nicht zuletzt auch von der Fragestel-
lung als solche abhängt, ist das Zuordnungsspiel JMatch – sinnvoll einsetzbar ist es natür-
lich in der Sprachenausbildung. So können Verben beispielsweise verschiedenen Zeitfor-
men zugeordnet werden. Vorsichtig muss man jedoch sein, wenn es um die Zuordnung der
sprachlichen Fälle geht, was meist nicht eindeutig gelingt. Zum Beispiel ist bei „Sprache“
(singular) der Genitiv und der Dativ jeweils „der Sprache“. Die beiden Antworten wären
identisch. Das erkennt das Spiel jedoch nicht, weil es feste Zuordnungen zu den Eingabe-
feldern anlegt, nicht jedoch zu deren Inhalten.
Beim Zuordnungsspiel: Auf Eindeutigkeit achten!
Beim Zuordnungsspiel dürfen auf keinem Fall zwei identische Lösungs- oder
Frageworte verwendet werden. Was formal richtig ist, wird vom System leider
nicht zwingend erkannt.
■
ild 12.47
B
Bei der Formulierung der Lösungs-
paare muss auf deren Eindeutig-
keit geachtet werden. Das Spiel
wertet intern lediglich die Zuord-
nung der Felder aus, versteht aber
nicht, was darin enthalten ist.
12.5.1.6 JMix – der „Schüttelsatz“
Zum Üben des Satzbaus im Sprachtraining eignet sich auch der Schüttelsatz. Satzfragmente
werden vom System durcheinander gewürfelt und die Aufgabe der Lernenden ist es, diese
in die richtige Reihenfolge zu bringen. Das Spiel lässt sich auch mit einer kleinen Geschichte
oder einem Fachtext gestalten.
Lehrende formulieren in Hot Potatoes JMix eine Aufgabe, indem sie Satzfragmente Zeile für
Zeile in das Feld Lösungssatz eintragen. In der Festlegung des Textes muss der Text natür-
lich in der richtigen Reihenfolge formuliert werden.500 12 Ergänzende Lernhilfen für Moodle
ild 12.48
B
Die Lösungsfragmente werden in
einzelnen Zeilen formuliert. Die
Reihenfolge muss hier allerdings
stimmen. Die Verwürfelung übernimmt
das Programm.
12.5.1.7 Der Masher
Der Masher ist nicht unbedingt erforderlich, um einzelne Hot-Potatoes-Aufgaben zu erstel-
len, denn diese können direkt aus dem Editor in ein SCORM-Archiv exportiert und in einen
Moodle-Kurs als Lernpaket importiert werden. Allerdings lassen sich mithilfe des Mashers
mehrere Aufgaben – auch ganz verschiedene Typen – miteinander kombinieren und als ein
Gesamtpaket speichern.
Die Dateien werden gezielt ausgewählt und können nachträglich in ihrer Reihenfolge bear-
beitet werden. Mit einem Klick auf Einheit erstellen wird ein gesamtes Lernpaket erstellt.
Bild 12.49 Es werden gezielt Hot-Potatoes-Aufgaben – nicht die SCORM-Pakete – für ein
gesamtes Lernpaket ausgewählt.Sie können auch lesen