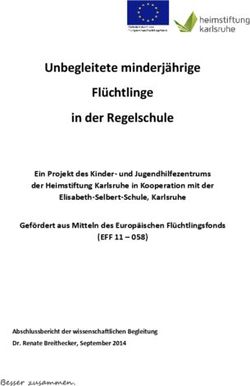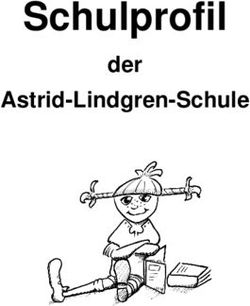Medienentwicklungsplanung für Schulen - Eine Anleitung Schritt für Schritt - Stadtmedienzentrum
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
IMPRESSUM
HERAUSGEBER
Gemeindetag Baden-Württemberg
Landkreistag Baden-Württemberg
Städtetag Baden-Württemberg
Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
Baden-Württemberg
AUTOREN DIESES HEFTES
Torsten Burger, Joachim Frisch, Jochen Hettinger,
Gert Schneider, Waldemar Stumpf, Jürgen Wingert
REDAKTION
Jochen Hettinger, Gert Schneider
V E RT R I E B
Landesmedienzentrum Baden-Württemberg
Standort Karlsruhe
Moltkestraße 64
76133 Karlsruhe
Diese Broschüre kann unter der Adresse www.support-
netz.de aus dem Internet heruntergeladen werden.
Inhaltliche Rückmeldungen senden Sie bitte an die
folgende E-Mail-Adresse: mep@lmz-bw.de.
Stuttgart, im Juli 2004
Die in dieser Veröffentlichung genannten Produkt-
namen sind eingetragene Warenzeichen der jewei-
ligen Firmen. Bei der Nennung von Produkten
handelt es sich lediglich um Beispiele. Aufgrund
des hohen Verbreitungsgrads an den Schulen basiert
die Ausstattungsempfehlung auf PC-gestützten Syste-
men. Damit soll keineswegs zum Ausdruck gebracht
werden, dass alternative Lösungen vom Einsatz an
Schulen ausgeschlossen sind.
2MEDIENENTWICKLUNGSPLANUNG FÜR SCHULEN
Medienentwicklungsplanung
für Schulen
Eine Anleitung Schritt für Schritt
S T U T T G A RT, I M J U L I 2 0 0 4
3I N H A LT
Vorwort 5
1. Einleitung 6
2. Was ist ein Medienentwicklungsplan? 7
3. Der Medienentwicklungsplan –
Schritt für Schritt 9
3.1 Phase 1: Teambildung und pädagogisches Konzept 9
3.2 Phase 2: Technisches Konzept
Ausstattung, Vernetzung, laufender Betrieb 13
3.3 Phase 3: Umsetzung und Evaluation 18
4. Hinweise für einzelne Schularten
(Bildungsplanbezug) 22
5. Zusammenfassung und Ausblick 23
6. Anhang 24
6.1 Materialien und Anmerkungen 24
6.2 Literaturhinweise 40
6.3 Ansprechpartner, nützliche Adressen 41
6.4 Projektablauf „Schulgebäudevernetzung“ (Beispiel) 42
4MEDIENENTWICKLUNGSPLANUNG FÜR SCHULEN
V O RW O RT
Das Lernen und Lehren mit Computer und Internet
kann den Unterricht interessanter, anregender und
effektiver machen. In vielen Fächern eröffnen sich
auf diese Weise ganz neue Lern- und Arbeitsmöglich-
keiten. Ohne die erforderliche Ausstattung und Ver-
netzung der Schulen können diese Ziele aber nicht
erreicht werden. Die Eckpunkte für die Ausstattung
der weiterführenden allgemein bildenden und beruf-
lichen Schulen mit Multimedia, die Vernetzung und
die Sicherstellung des laufenden Betriebs der Schul-
netze ergeben sich aus den Multimedia-Empfehlun-
gen des Landes und der Kommunalen Landesverbän-
de. Das dort beschriebene Leitbild der „vernetzten
Schule“, die alle erforderlichen Arbeits- und Nut-
zungsmöglichkeiten bietet, muss an die ganz konkre-
ten pädagogischen, organisatorischen und finanziel-
len Rahmenbedingungen der einzelnen Schule ange-
passt werden. Um diesen Prozess sinnvoll planen,
moderieren und steuern zu können, bietet sich der
„Medienentwicklungsplan“ an. Medienentwicklungs-
pläne stellen die Verbindung her zwischen Pädagogik
und Technik. Sie sind ein wichtiger Bestandteil eines
Schulcurriculums und können einen Beitrag leisten
zur inneren Schulentwicklung und zur Fortentwick-
lung des Unterrichts. Die vorliegende Broschüre soll
die Schulen und Schulträger in Baden-Württemberg
dabei unterstützen, Medienentwicklungspläne zu
erstellen und umzusetzen.
Auf der Grundlage der Multimedia-Empfehlungen
und in Ergänzung der Ausführungen dort soll diese
Publikation dabei ganz praktische Hilfestellungen
leisten. Sie ergänzt die gemeinsamen Multimedia-
empfehlungen des Landes und der Kommunalen
Landesverbände vom Dezember 2002. Wir hoffen,
dass die Schulen diese Hilfestellung nutzen und den
Prozess der Integration der neuen Medien in den
Unterricht und das schulische Lernen erfolgreich
bewältigen.
Die Herausgeber
51. EINLEITUNG
Computer im Unterricht, Lernen mit den neuen rungen aus der Praxis. Kurze Erläuterungen, Check-
Medien, Einsatz des Internets im Fachunterricht – listen und Übersichtsdarstellungen erleichtern die
diese Ziele werden heute nicht mehr in Frage Handhabung. Das zweite Kapitel erläutert, was unter
gestellt. Aber wie sieht es mit der erforderlichen Aus- einem Medienentwicklungsplan zu verstehen ist und
stattung und Vernetzung aus – in einer Zeit, in der bietet einen Überblick über den Aufbau und die
die finanziellen Spielräume immer enger werden? Struktur eines Medienentwicklungsplans. Im dritten
Die gemeinsamen „Multimedia-Empfehlungen“ 1 des Kapitel folgt eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für
Landes Baden-Württemberg und der Kommunalen die Erstellung eines Medienentwicklungsplans. Die
Landesverbände sind hierfür eine wesentliche spezifischen Anforderungen der einzelnen Schular-
Grundlage und geben wichtige Hilfestellungen. Sie ten werden im vierten Kapitel behandelt. Dabei ste-
empfehlen, dass die Schulen in Abstimmung mit hen die Anforderungen der neuen Bildungspläne im
dem Schulträger und auf der Basis des von ihm fest- Vordergrund. Neben einer Zusammenfassung der
gestellten Finanzierungsrahmens schulspezifische wesentlichen Aussagen der Handreichung bietet das
Medienentwicklungspläne erstellen, die die pädago- fünfte Kapitel einen Ausblick auf zukünftige Ent-
gisch-didaktischen Nutzungsmöglichkeiten und die wicklungen und Vorhaben. Im Anhang finden sich
dafür erforderlichen Vernetzungs- und Ausstattungs- eine Übersicht über wichtige Adressen und An-
szenarien sowie alle Erfordernisse für die Sicherstel- sprechpartner, Hinweise auf hilfreiche Informationen
lung des laufenden Betriebs der jeweiligen Schule im Internet und in gedruckter Form sowie weitere
einschließlich eines Wartungskonzepts beschreiben. Materialien.
Grundsätzliche Hinweise für die Erstellung eines sol- Was diese Handreichung allerdings nicht ersetzen
chen Medienentwicklungsplanes finden sich in kann, ist die Beratung im Einzelfall. Hier müssen
Abschnitt 6.1 der Multimedia-Empfehlungen. Darauf zum einen externe Experten zu Rate gezogen wer-
wird verwiesen. Was aber bislang fehlt, sind ein Kon- den, wenn es zum Beispiel um Fragen der ingenieur-
zept und eine „Schritt-für-Schritt-Anleitung“, um mäßigen Planung der Vernetzung oder um bauliche
eine sinnvolle, anforderungsgerechte und finanzier- Maßnahmen geht; zum anderen sei auf die zentrale
bare Planungsgrundlage für die einzelne Schule zu und dezentrale Schulnetzberatung verwiesen, die im
erstellen. Genau dies ist das Ziel der vorliegenden Rahmen des Projekts „Support-Netz“ angeboten
Handreichung. Sie wendet sich an alle, die mit der wird (weitere Informationen unter www.support-
Planung und Betreuung schulischer Netze zu tun netz.de, siehe Anhang).
haben: an die Schulleitungen, die Multimedia- und Da zur Zeit die Verwaltungsnetze in den Schulen
Netzwerkberaterinnen und -berater, die Mitarbeite- vom unterrichtlichen Bereich physikalisch getrennt
rinnen und Mitarbeiter der Kommunalverwaltung, eingerichtet und betrieben werden müssen, wird die-
aber auch an Händler und Firmen, die sich im ser Aspekt in der vorliegenden Broschüre nur am
Bereich „schulische Netze“ engagieren wollen, sowie Rande berücksichtigt (vergleiche Kapitel 3). Die
natürlich an alle interessierten Lehrkräfte in den beruflichen Schulen werden in vielen Fällen spezifi-
Schulen. sche und sehr viel weitergehende Ausstattungsanfor-
Die Leitfrage für die Erstellung eines Medienent- derungen haben. Für hauswirtschaftliche und sozial-
wicklungsplans lautet: Wie muss die Ausstattung, die Ver- pädagogische berufliche Schulen können die hier
netzung und der laufende Betrieb des schulischen Netzes gegebenen Hinweise aber durchaus ausreichend sein.
beschaffen sein, damit die pädagogischen Anforderungen und Ähnliches gilt für viele Sonderschulen: Der besonde-
die Aufgaben des Unterrichts unter Berücksichtigung der ört- re Ausstattungsbedarf beispielsweise für Schulen für
lich zur Verfügung stehenden Ressourcen am besten erfüllt wer- Körperbehinderte oder für Sinnesgeschädigte kann
den können? Die Antwort auf diese Frage kann nur in von Standort zu Standort je nach den Voraussetzun-
gemeinsamer Arbeit eines Teams aus verschiedenen gen der Schülerinnen und Schüler sehr unterschied-
Experten gefunden werden. Dieses pädagogische lich sein. Unabhängig davon ist für die allgemeine
„Medienkonzept“ wird dann in enger Abstimmung Medienentwicklungsplanung das für die Hauptschu-
zwischen Schule und Schulträger zu einem „Medien- len, Realschulen und Gymnasien beschriebene Vor-
entwicklungsplan“ weiterentwickelt. Die vorliegende gehen jedoch auch für diese Schulen sinnvoll.
Handreichung beschreibt in einzelnen Schritten und
1) Die Multimedia-Empfehlungen sind im Internet unter
anhand konkreter Beispiele, welche Kriterien zu der Adresse http://www. support-netz.de/ dt/multimedia
beachten sind. Sie orientiert sich dabei an den Erfah- empfehlungen.html verfügbar.
6MEDIENENTWICKLUNGSPLANUNG FÜR SCHULEN
2 . WA S I S T E I N M E D I E N E N T W I C K L U N G S P L A N ?
Für die Unterrichtsvorbereitung und für das Manage- Die Erstellung eines MEP gliedert sich in drei aufei-
ment von Projekten gibt es eine Vielzahl von Pla- nander aufbauende Phasen, die jeweils unterschiedli-
nungshilfen. Ein Medienentwicklungsplan ist eine che Schwerpunkte haben (vergleiche Abbildung 1).
Planungshilfe für den Medieneinsatz und die dafür Die erste Phase umfasst die Arbeitsschritte von der Bil-
erforderlichen technischen und organisatorischen dung eines MEP-Teams über die Bestandsaufnahme,
Voraussetzungen in Schulen. Etwas genauer lässt sich die Beschreibung der Anforderungen (pädagogisches
der Begriff „Medienentwicklungsplan“ folgenderma- Konzept) bis hin zur Definition der Ziele. Im Mittel-
ßen definieren: punkt steht die Erarbeitung eines pädagogischen
Konzepts zum Einsatz der Medien im Unterricht
Ein Medienentwicklungsplan („MEP“) ist ein Instrument, (Medienkonzept). Diese Phase liegt schwerpunktmä-
mit dem die Schule (Schulleitung und Kollegium) in Abstim- ßig im Verantwortungsbereich der Schule, die sich
mung mit dem Schulträger den Einsatz der Medien in der aber bereits zu diesem Zeitpunkt mit dem Schulträ-
Schule planen und die dafür erforderlichen Voraussetzungen ger insbesondere im Hinblick auf die finanziellen
beschreiben kann. Ausgangspunkt ist ein pädagogisches Kon- Rahmenbedingungen abstimmen sollte.
zept für den Einsatz der Medien, das sich an pädagogisch-
didaktischen Anforderungen orientiert. Ferner ist der finan- In der zweiten Phase des Medienentwicklungsplans ste-
zielle Rahmen des Schulträgers von Beginn an zu berücksichti- hen technische Fragen im Vordergrund. Hier geht es
gen. Auf dieser Grundlage werden in Kooperation zwischen um die Bestandsaufnahme der Vernetzung und der
Schule und Schulträger ein technisches Konzept zur Umset- vorhandenen Ausstattung sowie um die Ausarbeitung
zung dieser Anforderungen (Vernetzungs-, Ausstattungs-, eines Ausstattungskonzepts, eines Wartungs- und
Wartungs- und Nutzungskonzept) sowie ein Finanzierungs- Betriebskonzepts und eines Nutzungskonzepts. In
und Zeitplan erarbeitet. Die Erstellung eines Medienentwick- dieser Phase des Medienentwicklungsplans wird der
lungsplans als Prozess ist ebenso wichtig wie das schriftlich Schulträger wichtige Aufgaben übernehmen. Eine
fixierte Ergebnis dieses Prozesses. technische Bestandsaufnahme als Grundlage für die
weitere Planung ist von Lehrkräften in der Regel
Weitere Erläuterungen finden sich in Tabelle 1: Kri- nicht zu leisten, ebenso wenig die Erstellung eines
terien für einen Medienentwickungsplan. Vernetzungs- und Betriebskonzepts. In jedem Fall
3.4 Evaluation 1.1 Team bilden
3.3 Zeitplan 1.2 Bestandsaufnahme
Medieneinsatz
3.2 Beschluss 1.3 Päd. Medienkonzept
Phase 3: Phase 1:
Beschluss, Team und
Zeitplan, päd. Medien-
Überprüfung konzept
3.1 Finanzierung 1.4 Ziele
Phase 2:
Bestandsaufnahme,
Technische Konzeption
2.5 Nutzungskonzept 2.1 Bestandaufnahme
Technik
2.4 Service- und 2.2 Vernetzungskonzept
Betriebskonzept
2.3 Ausstattungskonzept
Abb. 1: Phasen und Schritte bei der Erstellung eines Medienentwicklungsplans
7muss aber die Schule eng beteiligt werden, damit Gibt es auch Nachteile?
sich die Planungen an den schulischen Bedürfnissen Den Arbeits- und Zeitaufwand für einen MEP darf
orientieren. man nicht unterschätzen. Allerdings hilft ein guter
In der dritten Phase werden die zu erwartenden Kos- Medienentwicklungsplan auch dabei, Zeit einzuspa-
ten für die Ausstattung, die Vernetzung und den lau- ren, die zum Beispiel bei späteren Korrekturen und
fenden Betrieb errechnet und in ein Finanzierungs- Veränderungen aufgewendet werden müsste. Die
konzept umgesetzt. Der Medienentwicklungsplan Erarbeitung eines MEP stellt fachliche Anforderun-
wird sodann von den Gremien der Schule und den gen, die möglicherweise nicht überall vorhanden
zuständigen Stellen des Schulträgers diskutiert und sind. Hier sollte man fachliche Unterstützung zum
verabschiedet. Damit ist er die Grundlage sowohl für Beispiel seitens der „Projektgruppe Schulnetzbera-
die haushaltsrechtliche Umsetzung durch den Schul- tung“ beim Landesmedienzentrum, der dezentralen
träger als auch für die pädagogische Umsetzung im Schulnetzberatung und Beratungsangebote externer
Rahmen des pädagogischen Konzeptes der Schule Partner, die gegebenenfalls über den Schulträger ver-
für den angegebenen Zeitraum. Gemeinsam wird ein mittelt werden, in Anspruch nehmen (Informationen
Zeitplan erstellt, der die gesetzten Ziele konkretisiert dazu im Anhang). Dieser Aufwand lohnt sich, wenn
und zeitlich verankert (Meilensteinplanung). Dabei man die hohen Kosten für Hard- und Software,
wird bestimmt, wie festgestellt werden kann, ob die Betreuung und Support sowie die Vernetzung in den
Ziele – auch auf der Grundlage der Haushaltssituati- Schulen berücksichtigt. Fehlentscheidungen wirken
on des Schulträgers – erreicht werden konnten und sich hier nicht nur für den Einsatz im Unterricht
wie der MEP gegebenenfalls fortgeschrieben werden negativ aus, sondern können auch zu hohen Folge-
soll. kosten führen.
Das folgende Kapitel beschreibt die einzelnen
Die Vorteile eines Medienentwicklungsplans Schritte bei der Erstellung eines Medienentwick-
Ein MEP bietet für alle Beteiligten wichtige Vorteile: lungsplans anhand von Leitfragen, für deren Beant-
wortung jeweils spezifische Hilfsmittel vorgestellt
• Der MEP verbindet das pädagogische Konzept mit werden.
dem technischen (Ausstattung, Vernetzung, War-
tung) und dem organisatorischen Konzept („Nut- KRITERIEN FÜR DEN
zungskonzept“). Dadurch wird der pädagogisch- MEDIENENTWICKLUNGSPLAN
didaktisch sinnvolle Medieneinsatz in der Schule Grundlage sind die Eckpunkte der gemeinsamen
auf Dauer gewährleistet. Multimedia-Empfehlungen
• Der MEP unterstützt die Schule bei der Integrati- Berücksichtigung der neuen Bildungspläne und der
on des Medieneinsatzes und der Medienbildung in unterrichtlichen Anforderungen
das gemeinsam zu erarbeitende Schulcurriculum Medieneinsatz und Medienbildung als Teil des
und bietet so eine wichtige Hilfe bei der Umset- Schulcurriculums
zung der neuen Bildungspläne. Der Einsatz der Nachhaltigkeit und Langfristigkeit der Planung
Medien wird damit zu einem Anliegen des ganzen Flexibilität für künftige Entwicklungen und
Kollegiums beziehungsweise der ganzen Schule und Anforderungen
nicht nur Aufgabe einiger weniger „Multimedia- Transparenz bei der Planung für die Schule und den
Spezialisten“. Schulträger
• Der MEP ist die Basis für die Zusammenarbeit zwi- Orientierung an den vorhandenen personellen, räumlichen
schen Kollegium, Schulleitung und Schulträger. und finanziellen Möglichkeiten für die Umsetzung
• Für den Schulträger erhöht der MEP die Planbar- Verständlichkeit (nicht-technische Formulierung)
keit und „Wertsicherung“ der Vernetzung und Aus- Vernetzte Betrachtung unterschiedlicher Handlungs-
stattung der Schule. Fehlentscheidungen können dimensionen
dadurch vermieden werden. Außerdem bietet er Orientierung an Standards und technischen Leitbildern,
eine gute Grundlage, um die erforderlichen Maß- ohne technisches Spezialwissen vorauszusetzen
nahmen für unterschiedliche Schulen eines Schul- Überprüfbarkeit der Ziele und Maßnahmen
trägers zu koordinieren.
Tabelle 1: Allgemeine Kriterien für einen
Medienentwicklungsplan
8MEDIENENTWICKLUNGSPLANUNG FÜR SCHULEN
3. DER MEDIENENTWICKLUNGSPLAN – SCHRITT FÜR SCHRITT
Für jede der drei im vorangehenden Kapitel genann- 3.1 PHASE 1: TEAMBILDUNG UND PÄDAGO-
ten Planungsphasen werden im Folgenden konkrete GISCHES KONZEPT
Arbeitshilfen beschrieben. Die Leitfragen zu jedem
der erforderlichen Arbeitsschritte werden erläutert 3.1.1 Projektteam zusammenstellen
und – sofern möglich – durch konkrete Arbeitshilfen Leitfragen:
(zum Beispiel zur Erhebung und Auswertung der Die Tabelle 2 enthält eine Übersicht über die Leitfra-
erforderlichen Daten) ergänzt. Bei diesen Arbeitshil- gen, die bei der Bildung des MEP-Teams hilfreich
fen handelt es sich im Wesentlichen um Tabellen sein können. Für eine effiziente Arbeit sollte das eigent-
und Formulare, die – als leere Textdateien – unter liche Projektteam aus nicht zu vielen Personen beste-
der URL www.support-netz.de aus dem Internet hen. Die Schulleitung sollte in jedem Fall vertreten
heruntergeladen und mit einem gängigen Textverar- sein. In allen Phasen können bei Bedarf weitere Teil-
beitungsprogramm weiterbearbeitet werden können nehmerinnen und Teilnehmer hinzukommen.
(eine Zusammenstellung aller Arbeitshilfen bezie- Arbeitshilfen:
hungsweise Materialien findet sich im Anhang Seite Material 1-1: „Das Projektteam“ (siehe Anhang Seite
24 ff). Diese Angaben werden durch weitere Hinweise 25, im Internet: www.support-netz.de).
ergänzt. Weitere Hinweise:
Natürlich handelt es sich hierbei nicht um verbind- Die Erstellung eines Medienentwicklungsplans (und
liche Vorgaben. Die Erfahrung hat aber gezeigt, dass mehr noch die Umsetzung dieses Plans) lässt sich
es sich im Verlauf des Planungsprozesses und insbe- auch als „Projekt“ betrachten. Hinweise auf weiter-
sondere später bei der Umsetzung der Planung aus- führende Informationen zum Projektmanagement
zahlt, wenn man am Anfang sehr sorgfältig und im finden sich im Anhang. Für die Unterstützung der
Zweifel eher zu viele als zu wenige Informationen Zusammenarbeit in Gruppen hat sich die Moderati-
zusammenträgt. onsmethode besonders bewährt (Literaturhinweise
dazu im Anhang).
LEITFRAGE ERLÄUTERUNG
Welche Aufgaben hat das MEP-Team? Die Aufgaben der MEP-Teams sollten gemeinsam diskutiert, inhaltlich bestimmt
und mit der Schulleitung und dem Schulträger abgestimmt werden. Zu den Kern-
aufgaben des MEP-Teams gehören die Erstellung des Medienentwicklungs-
plans, alle dafür erforderlichen Abstimmungs- und Kommunikationsaufgaben, die
Begleitung der Umsetzung und die Fortschreibung und Aktualisierung der
Planung.
Wer soll im MEP-Team mitarbeiten? In dem Team sollten mitarbeiten: Schulleitung, Netzwerkberaterin / Netzwerk-
berater, Multimediaberaterin / Multimediaberater, Vertreterin / Vertreter des
Schulträgers, Fachbereichsleiterinnen und Fachbereichsleiter und gegebenen-
falls Vertreter einer Firma oder eine Schulnetzberaterin / ein Schulnetzberater.
Wer ist innerhalb des Teams Die Aufgaben im Team sollten möglichst genau bestimmt sein und wo erforder-
für welche Bereiche zuständig? lich auch gegeneinander abgegrenzt werden (Abstimmung mit der Schulleitung
beziehungsweise dem Schulträger, Koordinierung von Beratungsterminen …).
Welche Kompetenzen sind vor- Insbesondere in technischen Fragen (zum Beispiel Planung der Gebäude-
handen, welche müssen dazu vernetzung, Planung des schulischen Computernetzes) wird es erforderlich
geholt werden? sein, externe Beraterinnen beziehungsweise Berater hinzuzuziehen (Schulnetz-
beraterin oder -berater, Firma …).
Wann sollen die Ergebnisse Die Erstellung eines Medienentwicklungsplans dauert ungefähr ein halbes
vorliegen? Schuljahr. Die Schulleitung und der Schulträger sollten eine realistische
Vorstellung dieser Erarbeitungszeit haben.
Wie werden im MEP-Team Das MEP-Team hat eine große Verantwortung, auch in finanzieller Hinsicht.
Entscheidungen getroffen? Die Teammitglieder sollten festlegen, wie sie bei strittigen Fragen vorgehen
wollen (zum Beispiel Klärung durch Abstimmung) und welche Regeln für
die gemeinsame Arbeit gelten.
Tabelle 2: Leitfragen „Team zusammenstellen“
93.1.2 Bestandsaufnahme Medieneinsatz neben Material 1- 8 mit Material 1 - 9 auch eine
Leitfragen: Excel-Tabelle angeboten. Damit ist auch eine grafi-
In diesem Bereich (vergleiche Tabelle 3) soll doku- sche Auswertung der Fragebögen möglich.
mentiert werden, wie in der Schule bislang mit Me- Weitere Hinweise:
dien gearbeitet wurde, inwieweit Schülerinnen und Die Erhebung der Daten kann in Papierform oder
Schüler einbezogen wurden, welche Fortbildungs- aber auch durch eine E-Mail an die Lehrkräfte der
maßnahmen bislang durchgeführt wurden und über Schule erfolgen. Bei der Auswertung der Fragen zum
welche Kompetenzen die Lehrerinnen und Lehrer Fortbildungsstand und den Fortbildungswünschen
im IT-Bereich verfügen. kann es sinnvoll sein, eine personenbezogene Aus-
Arbeitshilfen: wertung durchzuführen, um zum Beispiel die Teil-
Die Materialien 1 - 2: „Einsatz des Computers in den nahme an Fortbildungen besser planen zu können.
Fächern“ und Material 1 - 3: „Bisheriger Computer- Diese Angaben müssen selbstverständlich vertraulich
einsatz im Unterricht“ können für die Erfassung des behandelt werden. Der Schulleitung sollten sie aber
Ist-Standes in der Schule verwendet werden. Materi- auf jeden Fall zur Verfügung stehen.
al 1- 4: „Probleme …“ hilft bei der Erfassung der bis-
lang aufgetretenen Probleme. Fragen nach einer 3.1.3 Die unterrichtlichen Anforderungen beschrei-
Benutzerordnung und der Einbeziehung von Schüle- ben (pädagogisches Medienkonzept)
rinnen und Schülern stellt Material 1-5. Für die In dieser Phase sollte das Projektteam Aufgaben an
Dokumentation der bisher durchgeführten Fortbil- Fach- und Stufenkonferenzen delegieren, damit die
dungen steht mit Material 1- 6 ein Fragebogen zur Kompetenz aller Lehrerinnen und Lehrer in das
Verfügung, ebenso für die Erfassung der medienbezo- pädagogische Medienkonzept einfließen kann. Nur
genen Kompetenzen der Lehrkräfte (Material 1- 7). so kann dem Leitbild des „fächerintegrativen Einsat-
Für die Auswertung der Lehrkräftebefragung wird zes der neuen Medien“ (vergleiche Multimedia-Emp-
LEITFRAGE ERLÄUTERUNG
Wie werden die Medien im Der Medieneinsatz im Unterricht soll in den folgenden drei Bereichen be-
Unterricht eingesetzt? schrieben werden: informationstechnische Grundbildung, Medieneinsatz in den
Fächern und Medienerziehung / aktive Medienarbeit. Dabei geht es auch darum,
zu dokumentieren, in welchen Unterrichtssituationen, Klassenstufen, zu welchen
Unterrichtsinhalten und mit welchen Zielen die Medien eingesetzt werden.
Wie ist die Mediennutzung Die Beantwortung der Leitfrage sollte Angaben über die aktuelle Regelung
organisiert? zur Nutzung der Computer und anderer Medien enthalten (zum Beispiel
Benutzerordnung, Belegungspläne, Computerarbeitsplätze außerhalb
der Computerräume …). Die Aufgaben und Zuständigkeiten sollen erfasst
werden.
Erfüllt die verfügbare Hard- und Hier geht es um die Frage, inwiefern die Medienausstattung (Hard- und
Software einschließlich Intranet Software, Vernetzung, Netzwerk) den Anforderungen in der Vergangenheit
die Anforderungen des Unterrichts? genügt hat oder ob hier bereits Mängel beziehungsweise ein dringender Bedarf
nach Änderung oder Erweiterung der Ausstattung und Vernetzung aufgetreten
sind.
Gibt es Probleme in der Nutzung Dazu zählen u. a. Probleme bei der Zugänglichkeit und Nutzung der Medien
der Medien? (zum Beispiel ständig belegter Computerraum), aber auch Probleme mit der
Technik und der Wartung und Betreuung der Hard- und Software und des Netz-
werkes. Auch Schwierigkeiten mit der methodisch-didaktischen Integration der
Medien im Unterricht sollen hier beschrieben werden.
Wie sind Fortbildungsstand und Zu einer Bestandsaufnahme des Medieneinsatzes gehört auch eine Über-
Fortbildungsbedarf im Kollegium? sicht über die medienbezogenen Qualifikationen und Kompetenzen des
Kollegiums: Welche Themen bezüglich Hard- und Software, Einsatz der
Medien im Untericht und pädagogische Nutzung des schulischen Netzwerkes
und des Internet sind bereits ausreichend behandelt worden, wo besteht Fort-
bildungsbedarf?
Tabelle 3: Leitfragen „Bestandsaufnahme“
10MEDIENENTWICKLUNGSPLANUNG FÜR SCHULEN
fehlung Seite 5) entsprochen werden. Dabei ist nicht Auf der Grundlage der neuen Bildungsstandards (http://
nur an den Einsatz des Computers zu denken, son- www.bildungsstandards-bw.de) sollte nun die bisher
dern auch andere Mediengeräte wie zum Beispiel geleistete konzeptionelle Arbeit (siehe Material 1-3
Whiteboard, DVD-Player, Camcorder, Minidisc- „Bisheriger Computereinsatz im Unterricht“) fortge-
Recorder und Ähnliches erfüllen wichtige Aufgaben setzt werden. Ausgehend von den in den Bildungs-
in einem Medienkonzept. standards formulierten Anforderungen stehen be-
Als Einstieg in die Thematik könnte ein pädagogi- stimmte Leitfragen im Mittelpunkt (siehe Tabelle 4
scher Tag geplant werden, der allen Lehrerinnen und Leitfragen für das pädagogische Medienkonzept).
Lehrern der Schule das Konzept und den Stellenwert Die Beantwortung der Leitfragen kann bei der Be-
eines MEP verdeutlicht, die bislang vorhandenen schreibung des pädagogischen Medienkonzepts hel-
Konzeptionen und die Ergebnisse der Ist-Stand- fen, allerdings wird es in jedem Fall notwendig sein,
Erhebung (vergleiche Tabelle 3 Bestandsaufnahme) die Fragen an die konkrete Situation der einzelnen
zusammenfasst und erste allgemeine Zielvorstellun- Schule anzupassen. Das ist insbesondere auch hin-
gen formuliert. sichtlich der ab 2004/2005 geltenden Kontingent-
stundentafeln und des zu erarbeitenden Schulcurri-
Mögliche Tagesordnung:
Pädagogischer Tag zum „Medienentwicklungsplan“ culums erforderlich.
Das Planungsteam hat die Aufgabe, die Ergebnisse
1. MEP – was ist das?
des pädagogischen Tages und die Konzepte der Fach-
2. MEP an unserer Schule
bereiche zu einem in sich stimmigen Gesamtkonzept
3. Gruppenarbeit der einzelnen Fachgruppen
zusammenzuführen. Für die einzelnen Fächer und
4. Wir machen uns auf den Weg
Fächerverbünde beziehungsweise affinen Fächer wird
BEREICH LEITFRAGE
Fächer In welchen Fächern beziehungsweise Fächerverbünden sollen die Medien
Schulcurriculum eingesetzt werden? In welchen Klassenstufen? Wie sollen sie in das „Schul-
curriculum“ integriert werden?
Informationstechnische In welchen Fächern und mit welcher Unterrichtsorganisation sollen die
Kompetenzen informationstechnischen Kompetenzen für die Nutzung der Medien vermittelt
werden (Computer als Lerngegenstand)?
Fachinhalte Welche Fachinhalte sollen in den Fächern mit Hilfe von Medien vermittelt
Schlüsselqualifikationen werden (Schwerpunkte)? Welche Schlüsselqualifikationen (zum Beispiel
Methodenkompetenzen) sollen durch den Medieneinsatz unterstützt werden?
Unterrichtsformen In welchen Unterrichtsformen (Methoden, Sozialformen, Unterrichtsorganisa-
tion) sollen die Medien eingesetzt werden (zum Beispiel Gruppenarbeit, Arbeit
im Klassenverband, Projektunterricht …)?
Medienerziehung Wie sollen die Medien für die Medienerziehung und die aktive Medienarbeit
eingesetzt werden (zum Beispiel Erstellung einer Schülerzeitung)?
Förderangebote Sollen die Medien in die Unterstützungs- und Förderangebote der Schule
integriert werden?
Medienprojekte Welche besonderen Medienprojekte sind geplant?
Öffnung von Schule Möchte die Schule sich nach außen durch die Medien darstellen (Öffnung
Kooperationen der Schule)? Sind Kooperationen geplant (zum Beispiel mit dem außer-
Ganztagsangebote schulischen Bereich)? Sind Ganztagsangebote geplant, bei denen die Medien
eine Rolle spielen sollen?
Hausaufgaben Sollen die Medien auch bei den Hausaufgaben genutzt werden können?
Prüfungen Sollen die Medien bei Prüfungen benutzt werden können?
Unterrichtsvorbereitung Welche Rolle spielen die Medien bei der Unterrichtsvorbereitung?
Medienprofil Möchte die Schule ein Medienprofil erarbeiten?
Fortbildungsbedarf Gibt es Fortbildungsbedarf im Kollegium hinsichtlich Medienkompetenzen,
medienpädagogischer Kompetenzen und Fachdidaktik und Medien?
Tabelle 4: Leitfragen für das pädagogische Medienkonzept
11es sehr wichtig sein, die Kompetenzen und Inhalte untereinander dienen. Eine ähnliche Grafik könnte
zu bestimmen, die mit Unterstützung der Medien das MEP-Team auch für die benötigte Hardware er-
erarbeitet und vermittelt werden sollen. Bei der Aus- stellen. Die detaillierte Planung ist allerdings Thema
stattung mit Software sollten einige Vorüberlegungen des folgenden Kapitels (Technisches Konzept: Aus-
stattfinden. Programme sollten über einen möglichst stattung, Vernetzung, laufender Betrieb).
langen Zeitraum benutzbar sein, weil:
• jedes Programm eine Einarbeitungszeit erfordert. 3.1.4 Ziele formulieren
Je länger es im Gebrauch ist, desto günstiger wird Das MEP-Team verfügt nun über die erforderlichen
die Relation Einarbeitungszeit zur Nutzungszeit. Informationen, um die Ziele des Medienentwick-
• für Schülerinnen und Schüler eine Vertrautheit und lungsplans zu formulieren.
Sicherheit im Umgang mit dem Programm entsteht. Leitfragen:
• eine Planbarkeit über die Schuljahre hinweg be- Die Formulierung der Ziele sollte sich an folgenden
steht. Kolleginnen und Kollegen wissen, welche Leitfragen orientieren:
Voraussetzungen sie in den einzelnen Klassenstu- • Welche konkreten Ziele werden mit dem Einsatz
fen erwarten können. der Medien im Unterricht verfolgt (pädagogische
• die Beschränkung auf einige wenige Programme Ziele)?
den Arbeitseinsatz der Lehrerinnen und Lehrer • Welche Ziele verfolgt der Schulträger mit der Ein-
hinsichtlich der Vorbereitung erleichtert. führung und Umsetzung des Medienentwicklungs-
• die schulinterne Fortbildung erleichtert wird. plans?
• die Administration der Netzwerke vereinfacht wird. • Gibt es weitere Ziele beziehungsweise Vorgaben,
die berücksichtigt werden müssen?
Mit Hilfe einer Mindmap können die Anforderungen Material:
der einzelnen Fächer beziehungsweise Fachbereiche Das Material 1-12 im Anhang enthält Beispiele für-
sehr übersichtlich dargestellt werden (vergleiche Ab- Kompetenzen und Inhalte. Unter www.support-
bildung 2). Diese Darstellung kann als Diskussions- netz.de ist ein entsprechendes leeres Formular ver-
grundlage für die Abstimmung der Fachbereiche fügbar, in das die Ziele eingetragen werden können.
Übungsprogramme Ph, Ch, Bio Tabellenkalkulation
Simulationen Geometrieprogramme
Mathematik
Steuern und Regeln Naturwissenschaften/Technik Übungsprogramme
Messwerterfassung Computer Algebra Systeme
CAD
Lexika Geisteswissenschaften Textverarbeitung
Themenprogramme und CDs MindManager
Deutsch
Lexikon
Übungsprogramme
Bildbearbeitung Vokalbeltrainer
Zeichenprogramme Kunst Sprachen Übungsprogramme
Videobearbeitung Wörterbuch
Notationsprogramme Präsentationsprogramm
Sequenzer Musik Allgemeines Datenbank (Lokando)
Videobearbeitung Internet
Abb. 2: Softwareeinsatz in der Schule (Beispiel Realschule)
12MEDIENENTWICKLUNGSPLANUNG FÜR SCHULEN
Weitere Hinweise: 3 . 2 P H A S E 2 : T E C H N I S C H E S K O N Z E P T:
Ziele müssen nicht nur angemessen und fachlich A U S S TAT T U N G , V E R N E T Z U N G , L A U F E N D E R
richtig sein, sie sollten auch den folgenden Kriterien BETRIEB
entsprechen:
• Ziele sollen einen Zielzustand möglichst eindeutig 3.2.1 Bestandsaufnahme (Ausstattung, Vernetzung,
und konkret beschreiben. laufender Betrieb)
• Ziele sollen durch das Projekt erreichbar sein. Leitfragen:
• Ziele müssen – zur Erleichterung der Kommunika- Der Medienentwicklungsplan muss die vorhandene
tion – einfach formuliert und mit allen Beteiligten Ausstattung und Vernetzung der Schule und die or-
abgestimmt sein. ganisatorischen Regelungen zur Wartung, Betreuung
• Ziele müssen in einem eindeutigen, widerspruchs- und zum Support berücksichtigen. Eine genaue Be-
freien Verhältnis zu den anderen (auch über- und standsaufnahme ist daher die Grundlage für jede
untergeordneten) Zielen stehen (klare Zielhierar- Medienentwicklungsplanung. Ausgehend von den in
chie). Tabelle 5 zusammengestellten Leitfragen werden im
• Die Ziele des Projekts sollten mit vorgegebenen Folgenden die wesentlichsten Gesichtspunkte und
Zielen (anderer Handlungsbereiche) und Rahmen- Kriterien für die Bestandsaufnahme beschrieben.
bedingungen „harmonieren“. Grundsätzlich ist darauf hinzuweisen, dass eine tech-
• Ziele müssen operationalisiert und damit messbar nische Bestandsaufnahme nur von qualifiziertem
gemacht werden. Fachpersonal durchgeführt werden sollte. Gerade
• Ziele sollen motivieren. wenn vorhandene Hard- und Software bei Erweite-
rungen und Neuausstattungen weiter genutzt wer-
Nur wenn die Ziele eindeutig und klar formuliert den soll, ist eine ins Detail gehende Bestandsaufnah-
werden, kann man während und nach der Umsetzung me notwendig. Nicht selten unterscheiden sich sogar
des Medienentwicklungsplans prüfen, ob sie erreicht die bei einem Händler gekauften und gemeinsam
werden konnten (vergleiche 3.3.4 Kapitel Evalua- beschafften Geräte in ihrem „Innenleben“ erheblich
tion). voneinander. Der Vorteil einer genauen technischen
BEREICH LEITFRAGEN
EDV-Ausstattung Welche Ausstattung gibt es bislang (Computer, Peripheriegeräte, Software)? In
welchen Räumen können die Medien genutzt werden?
Vernetzung Welche Räume sind bislang vernetzt? Gibt es eine strukturierte Verkabelung?
Wie leistungsfähig ist das Netz? Welche baulichen Voraussetzungen liegen vor?
Reicht die Elektroverkabelung aus (Stromversorgung)?
Server Wo steht der Server? Wie ist er ausgestattet? Mit welchem Netzwerkbetriebs-
system (Musterlösung) wird der Server betrieben?
Internetzugang Gibt es einen zentralen Internetzugang? Wie ist dieser realisiert? Welcher
Provider wird genutzt?
Zuständigkeiten Wie sind die Zuständigkeiten innerhalb der Schule verteilt (Netzwerkberaterin
oder -berater, Multimediaberaterin oder -berater, Schulleitung …)?
Laufender Betrieb Wie ist der laufende Betrieb (Wartung, Betreuung, Support) organisiert? Welche
Aufgaben übernimmt die Schule und welche der Schulträger? Gibt es Verträge
mit Händlern und Firmen? Existieren Vorgaben des Schulträgers (zum Beispiel
vertragliche Bindung an bestimmte Firmen oder Ähnliches)?
Tabelle 5: Leitfragen „Bestandsaufnahme“
13Bestandsaufnahme liegt darin, dass die Planung und ar sowie allgemeine und fachspezifische Peripherie-
Beschaffung auf dieser Grundlage wesentlich genau- geräte, vorhandene Software und Vernetzung. Bei
er erfolgen kann, so dass Fehlinvestitionen oder Pro- der vorhandenen Software ist insbesondere zu beach-
bleme beim laufenden Betrieb vermieden werden. ten, ob diese zentral auf dem Server installiert wer-
Zum anderen kann diese Bestandsaufnahme als den kann. Hinweise für die serverbasierte Installation
Grundlage für eine kontinuierliche Bestandserfas- der Software können über die URL www.support-
sung und -verwaltung („Asset Management“) dienen. netz.de abgerufen werden.
Diese Bestandsdaten sind für den Support und die
weitere Planung insbesondere für den Schulträger 3.2.2 Vernetzungskonzept
unverzichtbar. Die gemeinsamen „Multimedia-Empfehlungen“ des
Arbeitshilfen: Landes und der Kommunalen Landesverbände vom
Für die Bestandsaufnahme in den Bereichen „Orga- Dezember 2002 formulieren als Ziel der Vernetzung
nisation“ und „Technik“ stehen die folgenden Vorla- und Ausstattung der Schulen mit Multimedia bis
gen zur Verfügung (vergleiche Anhang und digital zum Jahr 2006: „Die Vernetzung soll multimediales
unter www.support-netz.de): Arbeiten und den ständigen Internetzugriff an jedem
• Organisation: Aufgaben im EDV-Bereich, Lösung Rechner sowie die Wiederherstellung der Arbeitssta-
technischer Probleme (M 2-1). tionen ermöglichen … Für die Ausstattung und Ver-
• Technik: Server, Räume, Arbeitsstationen, Mobi- netzung der weiterführenden Schulen wird daher
liar, Peripheriegeräte allgemein, Peripheriegeräte angestrebt, dass in jedem Klassen- und Fachunter-
fachspezifisch, vorhandene Software, Vernetzung richtsraum multimediales und vernetztes Arbeiten
(M 2-2). möglich ist“ (Multimedia-Empfehlungen, Eckpunkte,
Weitere Hinweise: Seite 7). Die dazu erforderliche Netzwerkkonzeption
Bei der Bestandsaufnahme der organisatorischen Re- wird in Abschnitt 6.2.1 der Multimedia-Empfehlun-
gelungen soll festgestellt werden, wie die Zuständig- gen beschrieben. Detaillierte Hinweise zur Planung
keiten und Verantwortlichkeiten für den unterrichtli- der Vernetzung, zu technischen Alternativen der Ver-
chen EDV-Bereich an der Schule verteilt sind. Zuerst netzung (Funkvernetzung, Vernetzung über Stromka-
soll erhoben werden, wer für welche laufenden Auf- bel), zum separaten Serverraum und zum Server
gaben und wer für den Fall einer Störung im schuli- sowie zur Internetanbindung (Zugang, Provideraus-
schen Netz und an den Arbeitsstationen zuständig wahl, Filtersysteme) enthalten die Abschnitte 6.2
ist. Die Bestandsaufnahme Technik umfasst die The- und 6.3 der Multimedia-Empfehlungen. In Abschnitt
men Server, Arbeitsstationen in den verschiedenen 6.2.2 wird ein möglicher Stufenplan für die Vernet-
Räumen der Schule sowie mobile Stationen, Mobili- zung und Ausstattung beschrieben.
BEREICH LEITFRAGEN
Schulhausvernetzung, Welche Räume sollen vernetzt werden? Wie soll die strukturierte Verkabelung
Verkabelung realisiert werden?
Sind elektrotechnische und bauliche Maßnahmen erforderlich?
Wo ist der zentrale Serverraum vorgesehen, wie muss dieser eingerichtet
werden (zum Beispiel Sicherheitsmaßnahmen)?
Soll die Schulhausvernetzung in Stufen realisiert werden? Ist eine schulüber-
greifende Netzstruktur geplant?
Wie ist die Abnahme des Netzes geregelt?
Serverbereich Welche Anforderungen sind an den Server und den zentralen Serverraum zu
stellen? Welche aktiven Komponenten werden benötigt? Ist eine unter-
brechungsfreie Stromversorgung erforderlich?
Serverbetriebssystem Welches Serverbetriebssystem (Musterlösung) soll eingesetzt werden?
Internetzugang Wie soll der Internetzugang künftig realisiert werden? Welche Bandbreite wird
benötigt? Ist eine Standleitung mit fester IP-Adresse erforderlich (Erreichbarkeit
des Servers von außen)? Welche Filtersysteme und welche technischen Schutz-
vorrichtungen sind vorgesehen? Welche Anforderungen sollte der Internet
Service Provider erfüllen (vergleiche Multimedia-Empfehlungen Seite 21)?
Tabelle 6: Leitfragen „Vernetzungskonzept“
14MEDIENENTWICKLUNGSPLANUNG FÜR SCHULEN
Leitfragen: le. Die Leitfragen zu diesem Schritt bei der Erarbei-
Die Leitfragen (vergleiche Tabelle 6) beziehen sich tung eines Medienentwicklungsplans sind in Tabelle
auf die Bereiche „Schulhausvernetzung“, „Serverbe- 7 zusammengestellt.
reich“ (einschließlich so genannter „aktiver Kompo- Die Multimedia-Empfehlungen geben Hinweise zu
nenten“), „Serverbetriebssystem“ und „Internetzugang“. den Anforderungen, die an Arbeitsplatzrechner in
Das Betriebssystem der Arbeitsstationen muss natür- der Schule zu stellen sind (vergleiche Multimedia-
lich bei der Auswahl des geeigneten Serverbetriebs- Empfehlungen, Kapitel 6.3, Seite 17 ff). Alle Geräte,
systems berücksichtigt werden. auch Peripheriegeräte wie zum Beispiel Drucker,
Weitere Hinweise: sollten netzwerkfähig sein, so dass sie über das schu-
Die Planung der Schulhausvernetzung muss von Fach- lische Netz genutzt und – soweit möglich – auch ge-
leuten durchgeführt werden (siehe Anlage 6.4 Seite 42). wartet werden können. Gerade bei Druckern ist das
Beratung und technische Leistungen können unter auch deshalb wichtig, weil nur so effektive Schutz-
anderem auch über regionale Rechenzentren bezo- und Kontrollmaßnahmen eingerichtet werden kön-
gen werden. Alternative Konzepte der Vernetzung nen (Begrenzung der Anzahl zu druckender Seiten,
sind immer unter dem Aspekt der Bandbreite zu Zugriff auf Farbdrucker ...).
betrachten. Diese Bandbreite wird in der zukünftigen Die Grundgedanken bei der Auswahl von Unter-
Netzwerknutzung größer werden. In Zukunft werden richtssoftware wurden bereits in Abschnitt 3.1.3 dar-
vermehrt Medien online verteilt und im Unterrichts- gestellt („Plattformgedanke“). Grundsätzlich ist zu
einsatz über das schulische Netz abgerufen werden unterscheiden zwischen
(vergleiche das Projekt SESAM). Weiterführende In- • Betriebssystem-Software
formationen zu alternativen Konzepten der Vernet- • Dienstprogrammen (zum Beispiel zur Abwehr von
zung finden Sie in den Multimedia-Empfehlungen in Viren)
Abschnitt 6.2.4, Seite 17 ff). • Bürokommunikationssoftware (Office-Software)
• Lernsoftware, Software für den Unterricht
3.2.3 Ausstattungskonzept • Software zur Bearbeitung und Erstellung von Medien
Leitfragen: • Spezieller Software (zum Beispiel in beruflichen
Die Anforderungen an die Ausstattung der Schule Schulen und Sonderschulen)
mit Multimedia (Hard- und Software) leiten sich von Soweit dies technisch möglich ist, sollte die Software
den Zielen des pädagogischen Medienkonzepts ab. immer auf dem zentralen Server der Schule installiert
Berücksichtigt werden müssen aber auch die bereits werden. Gründliche Überlegung erfordert auch die
vorhandene Ausstattung sowie die (geplante bezie- Versorgung der Schule mit digitalen Medien. Anders
hungsweise bereits realisierte) Vernetzung der Schu- als zum Beispiel Lernprogramme oder Bürokommu-
BEREICH LEITFRAGEN
Arbeitsstationen Wie müssen die Arbeitsstationen ausgestattet sein (Grundkonfiguration)? Sind
neben stationären Arbeitsstationen auch mobile Arbeitsstationen (Notebooks,
Medienwagen mit Beamer …) erforderlich? Wie wird der Anschluss an das
schulische Netzwerk realisiert?
Peripheriegeräte Welche Peripheriegeräte (Drucker, Scanner, Beamer, Kameras, Interfaces zur
Messwerterfassung …) werden benötigt? Wie werden sie in das Schulnetz
integriert?
Ergonomie, Diebstahlsicherung, Welche ergonomischen Kriterien sind zu beachten? Ist eine Diebstahl-
Beleuchtung und Möblierung sicherung erforderlich? Muss die Beleuchtung verändert werden? Welche
Möblierung ist erforderlich?
Software Welche Software wird benötigt (Client-Betriebssytem, Bürokommunikations-
software, Lernsoftware, Dienstprogramme …)? Welche digitalen Medien sollen
eingesetzt werden? Wie wird die Software- und Medienauswahl, -beschaffung
und -bereitstellung organisiert?
Bestandsverwaltung Ist ein zentrales Management der Ausstattung geplant („Asset-Management“)?
Tabelle 7: Leitfragen „Ausstattungskonzept“
15nikationssoftware werden diese Medien (zum Bei- 3.2.4 Service- und Betriebskonzept
spiel multimediale Lernumgebungen, Filme auf DVD, Die Sicherstellung des laufenden Betriebs eines schu-
digitalisierte Karten und Fotografien ...) häufig nur lischen Netzwerkes fängt mit der Planung der Ver-
für einen begrenzten Zeitraum benötigt. Das Landes- netzung und des Serverbereichs an. Nur wenn hier
medienzentrum stellt ein Medieninformationssystem wartungsarme und zuverlässig funktionierende Lö-
bereit, in dem über das Internet recherchiert werden sungen zum Einsatz kommen, kann die Wartung und
kann (www.lmz-bw.de). Über die Stadt- und Kreis- Betreuung des Netzes mit vertretbarem Aufwand
medienzentren können diese Medien beschafft oder sichergestellt werden. Das gilt nicht nur für die Ver-
ausgeliehen werden. Jede Schule sollte sich hinsicht- meidung und schnelle Behebung von Fehlern, son-
lich ihres Bedarfs an entsprechenden Medien und dern auch für immer wieder erforderliche Arbeiten
den Möglichkeiten des Erwerbs von Lizenzen durch wie zum Beispiel die Installation von Software.
das jeweils zuständige Medienzentrum beraten lassen. Im Hardwarebereich hat sich die „Vor-Ort-Garantie“
Materialien: bewährt (Hardwareaustausch), ergänzend dazu müs-
Material M 3-2 sen Regelungen für Nachkauf und Ersatz verschlisse-
Weitere Hinweise: ner Teile getroffen werden (Hat die Schule ein eige-
Die „Multimedia-Empfehlungen“ enthalten auf Seite nes Budget? Bis zu welcher Summe sind Anschaffun-
17 ff Hinweise, die bei Ausschreibung und Kauf von gen schulintern möglich? Bei welcher Firma soll ein-
Multimedia-Hard- und -Software beachtet werden gekauft werden? ...). Werden entsprechende Verein-
sollten. Ganz besonders wichtig ist es, bei der Be- barungen mit dem Händler bereits bei der Beschaf-
schaffung der Arbeitsplatzrechner auf identische fung der Ausstattung getroffen, sind die Kosten für
Bauteile, Treiber und Betriebssystemversionen zu diese Dienstleistungen vergleichsweise niedrig.
achten. Die Netzwerkkarten müssen über das Netz Um die Wartung, die Betreuung und den Support für
starten („booten“) können. Auch zur Beleuchtung, das schulische Netz sicherzustellen, ist eine klare
zur Diebstahlsicherung und zur Möblierung finden Rollen- und Aufgabenverteilung erforderlich. Die Ta-
sich dort weitere Angaben. Die Möblierung entschei- belle in Kapitel 7.2 der gemeinsamen „Multimedia-
det ganz wesentlich über die Nutzung der Ausstat- Empfehlungen“ gibt eine Übersicht über die zu
tung im Unterricht (zum Beispiel die Art und Anord- berücksichtigenden Tätigkeitsbereiche. Hinweise auf
nung der Tische) und hat so direkte Auswirkungen weiterführende Informationen zu grundlegenden
auf Unterrichtsorganisation und -methoden. Nicht Standards und Qualitätskriterien für technische
unwichtig ist auch die Versorgung der Schule mit Unterstützungsangebote (so genannter „ITIL-Stan-
Verbrauchsmaterialien: Häufig sind diese bei be- dard“) finden sich in Anhang 6.2. Zu berücksichtigen
stimmten Geräten sehr teuer, so dass unabhängig ist auch der Schulungs- und Fortbildungsbedarf der
von den Anschaffungskosten die Betriebskosten den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mit entspre-
Ausschlag für die Beschaffung bestimmter Geräte chenden Aufgaben betraut sind.
geben können.
BEREICH LEITFRAGEN
Rollen- und Aufgabenverteilung Wer ist für den laufenden Betrieb zuständig? Wer übernimmt einfache
Wartungsarbeiten (Ansprechpartner, Zuständigkeiten)? Wie und durch wen wird
Anwendungssoftware installiert?
Support bei Störungen Soll bei Störungsfällen die zentrale Hotline für schulische Netze beim
Landesmedienzentrum genutzt werden? Ist eine Ferndiagnose beziehungsweise
-wartung geplant?
Vor-Ort-Support Wer macht den Vor-Ort-Support? Sollen externe Dienstleister eingebunden wer-
den? Wie sollen die Beauftragten und die Kostenübernahme geregelt werden?
Schulungs- und Unterstützungs- Welche Schulungs- und Fortbildungsmaßnahmen sind für die Netzwerk-
bedarf beraterinnen und -berater sowie für die sonstigen Mitwirkenden erforderlich?
Wie kann die aktuelle Information dieser Zielgruppe sichergestellt werden? Sind
weitere Unterstützungsmaßnahmen erforderlich (zum Beispiel durch regionale
Netzwerkarbeitskreise)?
Tabelle 8: Leitfragen „Service- und Betriebskonzept“
16MEDIENENTWICKLUNGSPLANUNG FÜR SCHULEN
Nur in den seltensten Fällen wird eine Schule ohne Material:
externen Support auskommen. Dazu zählt der telefo- M 2-3 Nutzungskonzept
nische Hotline-Support beispielsweise des Landes- Weitere Hinweise:
medienzentrums ebenso wie Vor-Ort-Einsätze von Die Nutzung des Internets darf nur unter der Auf-
Supportdienstleistern. Das Landesmedienzentrum bie- sicht von Lehrkräften erfolgen. Verletzt eine Lehr-
tet für Schulen in Baden-Württemberg, die mit einer kraft ihre / seine Aufsichtspflicht, kann dies rechtli-
Musterlösung ausgestattet sind, eine telefonische che Folgen haben (vergleiche dazu auch Kapitel
Hotline an. Sofern die Schule das wünscht, kann die 6.3.6.1 „Filtersysteme“, Multimedia-Empfehlungen,
Hotline auch eine Ferndiagnose des schulischen Net- Seite 20). Die Aufsicht kann nicht auf Schülerinnen
zes durchführen. Nähere Informationen hierzu sind und Schüler übertragen werden, wohl aber können
über das Online-Portal www.support-netz.de zu er- diese unterstützend einbezogen werden.
halten (vergleiche auch die Informationen in Anhang Hinweise auf weiterführende Informationsmöglich-
6.3 „Ansprechpartner, nützliche Adressen“). keiten zum Thema „Sichere Internetnutzung“ enthält
Für spezielle Anwendungssoftware muss gegebenenfalls der Anhang 6.2. Das Landesforschungsnetz „BelWü“
bei den Herstellern Softwaresupport eingekauft werden. bietet einen Zugang für Schulen an, der jugendge-
Leitfragen: fährdende Inhalte aus dem Angebot des World-
Siehe Tabelle 8. Wide-Web herausfiltert (weitere Informationen dazu
unter http://www.belwue.de/services/wwwproxy. html).
3.2.5 Nutzungskonzept Die Verwendung zentraler Filtersysteme bei den In-
Das Ausstattungs- und das Vernetzungskonzept sind ternet-Service-Providern ist lokal installierten Filtern
die Grundlage für den Einsatz der Medien in der vorzuziehen, da letztere einen sehr hohen Aufwand
Schule. Das pädagogische Medienkonzept benennt bei der laufenden Aktualisierung verursachen und
die Zielsetzungen und die konkreten Einsatzbereiche leichter umgangen werden können.
im Unterricht – doch ohne ein „Nutzungskonzept“
lässt sich die Verwendung der Medien in der Schule Eine sichere Nutzung der Medien, insbesondere des
in der Praxis nicht organisieren. Dazu gehören zum Internets, kann nur durch ein abgestimmtes schuli-
einen Absprachen darüber, zu welchen Zeiten wel- sches Nutzungskonzept erreicht werden, in dem alle
che Geräte genutzt werden können (Belegungsplä- vier Bereiche berücksichtigt werden:
ne), zum anderen müssen Regeln aufgestellt und ver- 1. Technische Maßnahmen (Filtersysteme)
einbart werden, wie Schülerinnen und Schüler die 2. Pädagogische Aufsicht
Ausstattung und insbesondere den Zugang ins Inter- 3. Präventive Medienerziehung, Förderung der
net nutzen dürfen und sollen. Medienkompetenz
Leitfragen: 4. Benutzungsvereinbarungen, Kontrollen und
Die Tabelle 9 fasst die relevanten Leitfragen zusammen. Sanktionen.
BEREICH LEITFRAGEN
Organisation und Zugang Wie soll der Zugang zu den Geräten organisiert werden (gegebenenfalls auch in
der unterrichtsfreien Zeit)? Wer ist für die entsprechenden Regelungen (Bele-
gungspläne, Nutzung mobiler Einheiten) zuständig? Wo kann man sich infor-
mieren (zum Beispiel im Intranet, am schwarzen Brett …)?
Benutzungsvereinbarungen Was muss in den Benutzungsvereinbarungen enthalten sein, wer erarbeitet
diese Vereinbarungen, wie werden sie in Kraft gesetzt? Wer achtet auf die
Einhaltung der Vereinbarungen?
Technische Schutzmaßnahmen Welche technischen Schutzmaßnahmen bei der Nutzung des Internets (Filter-
systeme) sind erforderlich und wie sollen diese eingerichtet werden (Nutzung
zentraler Filterdienste von Internet-Service-Providern wie zum Beispiel BelWü)?
Wer ist für die stichprobenartige Überprüfung der Zugriffskontrolle zuständig?
Aufsicht Wie wird die Aufsicht organisiert? Können gegebenfalls ältere Schülerinnen und
Schüler unterstützend einbezogen werden?
Präventive medienerzieherische In welcher Klassenstufe, in welchem Fach werden die erforderlichen Medien-
Maßnahmen kompetenzen vermittelt (Verarbeitung von Medieneinflüssen, verantwortungs-
volle und kritisch-reflexive Mediennutzung, rechtliche und ethische Aspekte)?
Tabelle 9: Leitfragen „Nutzungskonzept“
173 . 3 P H A S E 3 : U M S E T Z U N G U N D E VA L U AT I O N berücksichtigt werden. Auch die Kosten für die
erforderlichen Beschaffungen von Hard- und Soft-
Die dritte Phase bei der Erstellung des Medienent- ware müssen kalkuliert und gegebenenfalls in unter-
wicklungsplans umfasst die folgenden Schritte: schiedlichen Finanzierungsvarianten dargestellt wer-
1. Kostenplanung und Finanzierung den. Bei den Ausgaben für die Wartung, Betreuung
2. Verabschiedung, Beschlussfassung und den Support müssen insbesondere die Kosten
3. Zeitplan für die Umsetzung des MEP für den Vor-Ort-Einsatz eines Support-Dienstleisters
4. Evaluation berücksichtigt werden. Und schließlich sollten Mittel
für Ersatzbeschaffungen und das „technology refresh-
Die Tabelle 10 gibt einen Überblick über die entspre- ment“ vorgesehen werden. Erfahrungsgemäß lassen
chenden Leitfragen. sich einige Probleme, die im laufenden Betrieb auf-
treten, nur durch Aufrüstung und Erweiterung der
3.3.1 Kostenplanung und Finanzierung vorhandenen Ausstattung beheben.
Um die tatsächlichen Kosten für die Beschaffung Vergleichende Studien (zum Beispiel e-nitiative
und den Betrieb von Computeranlagen zu bestim- NRW) zeigen, dass die Gesamtkosten nur in gerin-
men, geht man in der Wirtschaft vom Ansatz der gem Maße vom gewählten Netzwerkbetriebssystem
„Total Cost of Ownership (TCO)“ aus. Obwohl sich abhängig sind. Bei einem einheitlich festgelegten
dieses Berechnungsmodell nicht unmittelbar auf den Qualitätsstandard unterscheiden sich auch die Hard-
Bereich der Schule übertragen lässt, ist es auch hier ware-Investitionen nur unwesentlich. Einsparungen
erforderlich, neben den Investitionskosten für Hard- beim Einsatz von „Thin Clients“ in einem Schulnetz
und Software auch die Kosten für bauliche Maßnah- zum Beispiel gleichen sich durch erhöhte Kosten für
men, Wartung, Support, Fort- und Weiterbildung die Client-Server-Software und die erforderliche leis-
sowie andere laufende Kosten zu berücksichtigen. tungsfähigere Server-Hardware wieder aus. Ein er-
Zu den Kosten für die Vernetzung gehören unter hebliches Einsparungspotential ergibt sich aus der
anderem bauliche Maßnahmen, Kosten für die Da- Art der Administration. Systeme, die eine zentrale
tenleitungen, für den Serverbereich und die aktiven Administration ermöglichen, verursachen deutlich
Komponenten. Auch wenn die Schule bereits zum weniger Kosten als Standard-Netzwerke.
Teil vernetzt ist, müssen hier die gegebenenfalls zu- Hier setzen die Musterlösung des Landes Baden-
sätzlich anfallenden Kosten errechnet werden. Die Württemberg an. Die automatisierte Installation, das
Kosten für die Internetverbindung müssen ebenfalls Prinzip der selbstheilenden Arbeitsstationen und die
LEITFRAGE ERLÄUTERUNG
Finanzierung Mit welchen Kosten muss für die Vernetzung gerechnet werden?
Wie hoch sind die Kosten für die geplanten Beschaffungen?
Welche Kosten fallen für Betreuung, Wartung und Support an?
Was kostet die erforderliche Software (Einkauf von Lizenzen)?
Welche Mittel sind für Ersatzbeschaffungen und das „technology
refreshment“ erforderlich?
In welchem Umfang und zu welchen Zeitpunkten stehen die Mittel
zur Verfügung? Wie soll die Finanzierung erfolgen?
In welchen Realisierungsstufen kann beziehungsweise soll die Umsetzung des
Medienentwicklungsplans erfolgen? Wie ist dies bei der finanziellen Planung zu
berücksichtigen?
Verabschiedung, Welche Gremien in der Schule und beim Schulträger müssen dem Medien-
Beschlussfassung entwicklungsplan zustimmen?
Vorbereitung und Durchführung dieser Gremienbeschlüsse.
Zeitplan für die Umsetzung Welche Teilziele gibt es? Welche Ziele sind besonders wichtig (Prioritäten,
des MEP Stufenkonzept)?
Wann sollen diese erreicht sein (Meilensteine)?
Evaluation Wie kann die Erreichung der Ziele gemeinsam geprüft werden?
Was geschieht, wenn Ziele geändert werden müssen und eine neue
Planung erforderlich wird?
Welche Konsequenzen kann die Überprüfung der Ziele haben?
Tabelle 10: Leitfragen für Phase 3 „Umsetzung und Evaluation“
18Sie können auch lesen