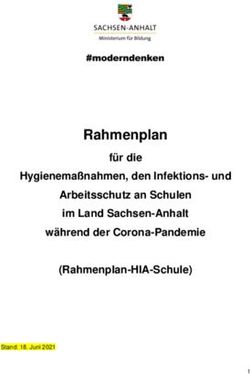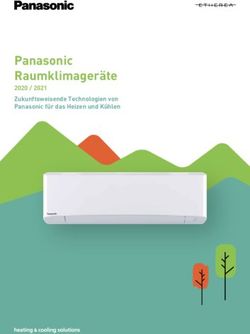IT - Plan für die Schulen - der Stadt Marburg
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
IT - Plan
für die Schulen
der Stadt Marburg
Magistrat der Universitätsstadt Marburg, Schulamt, Markt 18, 35037 MarburgInhaltsverzeichnis
1 Vorwort 4
2 Allgemeines 6
3 Ausstattung 10
3.1 Grund- und Sonderschulen 10
3.1.1 Grundschulen 10
Allgemeines 10
Ausstattungsstandards 11
3.1.2 Sonderschulen 13
Pestalozzischule 13
Schule für Praktisch Bildbare 14
Fronhofschule 14
Schule für Körperbehinderte an der Erich Kästner- Schule 14
3.2 Sekundarstufen I und II 16
3.2.1 Allgemeines 16
3.2.2 Ausstattungsstandards 16
EDV-Fachräume 16
Sonstige Ausstattung 17
3.3 Berufliche Schulen 21
4 Netzwerk 22
4.1 Allgemeines 22
4.2 Ist-Zustand 22
4.3 Schulinterne Vernetzung 23
4.4 Externe Vernetzung 29
5 Support 33
5.1 Status 33
5.2 Zielsetzung 34
5.3 Organisatorische Vorgaben 35
5.4 Technische Vorgaben 36
5.5 Supportebenen 38
5.6 Partnerschaften / Kooperationen 41
5.7 Kosten 41
- 2-6 Gesamtübersicht Investitionskosten 43
6.1 Kosten der Hardware 43
6.2 Kosten der Vernetzung 45
7 Umsetzung des IT-Plans / Prioritäten 46
7.1 s@z-Pakete als perspektivische Lösung 47
7.2 Leasing 49
8 Anlagen 51
8.1 Anlage 1 - Begriffsbestimmung 51
8.2 Anlage 2 - Zusammensetzung der Arbeitsgruppen 53
8.3 Anlage 3 - Warenkorb 54
8.4 Anlage 4 - Konzeption der Schulen 57
- 3-Vorwort
Nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir. Dieser auf den römischen
Philosophen Seneca zurückgehende Satz gilt als programmatische Feststellung:
‚Das Leben’ in der heutigen Zeit m
i Allgemeinen sowie die beruflichen Anforde-
rungen im Besonderen verlangen in zunehmendem Maße den Einsatz moderner
Kommunikationsmittel, wie Computer, Digitaltechnik und Internet.
Ganz gleich, ob man die Medienkompetenz als Schlüsselqualifikation - ja sogar
als 4. Kulturtechnik - bezeichnet oder ob man in ihr bestenfalls ein modernes
didaktisches Hilfsmittel sieht, es ist unumstritten, dass ihr ein immer bedeuten-
derer Stellenwert innerhalb der schulischen Ausbildung beizumessen ist. Selbst
eine kritische Betrachtungsweise führt zu dem Schluss, dass es Aufgabe der
Schule sein muss, die Schülerinnen und Schüler auf einen verantwortungsvollen
Umgang mit der Informationstechnik vorzubereiten.
Am 23.Mai 2001 haben die Hessische Landesregierung, die Schulträger und die
Wirtschaft mit der Unterzeichnung einer gemeinsamen Erklärung den Weg für
einen verantwortungsvollen und effektiven Einsatz der neuen Technologien im
Unterricht an unseren Schulen bereitet. Neben der Verbesserung der IT - Infra-
struktur bezieht die „schule@zukunft“ betitelte Initiative erstmals auch die Quali-
fizierung aller Lehrerinnen und Lehrer sowie Anregungen und Lösungsansätze
hinsichtlich der Wartungs- und Supportfrage strategisch ein.
Die Stadt Marburg als Schulträger für insgesamt 27 Schulen hat sich bereits seit
Jahren ihrer Verantwortung im Bereich der informationstechnischen Ausstattung
der Bildungseinrichtungen gestellt und mit angemessenem finanziellem und per-
sonellem Aufwand dazu beigetragen, dass vernetzte EDV - Räume, Medienecken
und Einzelarbeitsplätze eingerichtet werden konnten. Darüber hinaus wurden
Lösungen erprobt, um den Schulen bei der Planung, Beschaffung, Wartung und
Instandsetzung der Technik Unterstützung zuteil werden zu lassen.
Der nun vorliegende IT - Plan soll unsere gemeinsam mit den Schulen auf die
didaktischen Ansprüche abgestimmten Strategien bündeln und soll ihnen jeder-
zeit eine innovative Ausrichtung geben können. Darüber hinaus soll der IT - Plan
auch Ausgangspunkt und Plattform einer strukturierteren Planung und Umset-
- 4-zung für uns als Schulträger sein. Nicht zuletzt aus diesem Grund ist es zwingend
erforderlich, dass er einer ständigen Weiterentwicklung und Anpassung an ver-
änderte Rahmenbedingungen und Anforderungen unterzogen wird.
Aufgrund der Schnelllebigkeit der heutigen Welt ist es sicher nicht immer leicht,
den Anforderungen der Zeit in vollem Umfang gerecht zu werden. Mit dem IT -
Plan versucht die Stadt Marburg allerdings, die notwendigen jeweils aktuellen
Investitionen zielgerichtet und innovationsfähig einzusetzen.
Unsere Zielsetzung dabei ist, die Schülerinnen und Schüler heute und auch mor-
gen erfolgreich auf das Leben vorzubereiten.
Egon Vaupel
Bürgermeister
- 5-Allgemeines
Zielvorstellung
Grundlage für die jetzt beginnende Ausstattungsoffensive der Marburger Schulen
mit moderner Informations- und Kommunikationstechnik durch das Programm
Schule @ Zukunft ist die Erstellung eines Technologieplanes (IT-Plan).
Bereits in den vergangenen Jahren wurden die Schulen der Stadt Marburg unter
Bereitstellung erheblicher Investitionsmittel mit EDV-Komponenten versorgt. Alle
Schulen der Sekundarstufen I und II verfügen über modern ausgestattete EDV-
Räume. Auch die beruflichen Schulen sind entsprechend ihrem unterschiedlichen
Bedarf sehr gut mit mehreren EDV-Räumen ausgestattet.
Die Stadt Marburg hat in jedem Jahr deutlich höhere Investitionen in den Bereich
EDV vorgenommen, als dies im Rahmen der Schulbaupauschale des Landes Hes-
sen verpflichtend vorgegeben war.
Die Ausstattungen erfolgten jedoch ausschließlich aufgrund der Anmeldungen der
Schulen, ohne dass dem eine gesamtstädtische Konzeption zu Grunde lag.
Dies soll sich nun ändern. Die Begründung ergibt sich nicht nur aus der Notwen-
digkeit, die immensen Haushaltsmittel, die für die Neuausstattung der Schulen
mit EDV notwendig sind, wirtschaftlich einzusetzen, sondern es wird das Ziel
verfolgt, eine einheitliche Ausstattung zu erreichen, die sich insbesondere auf
den Bereich des Support positiv auswirken soll. Dazu gehören technische
Vorgaben im Hinblick auf die Hardware-Ausstattung, die einheitliche Ausstattung
mit Betriebssystemen und die Vorgabe standardisierter Serverkonfigurationen.
Vorgehensweise
Der IT-Plan sollte von Anfang an in enger Abstimmung mit den Schulen erarbei-
tet werden. Um dies zu erreichen, wurden drei Arbeitsgruppen für die Bereiche
- 6-Ø Grund- und Sonderschulen,
Ø Sekundarstufen I und II und
Ø Netzwerke und Support
gebildet.
Teilnehmer/innen waren Vertreter/innen der betroffenen Schulen, Vertre-
ter/innen des Hessischen Landesinstituts für Pädagogik und des Staatlichen
Schulamtes sowie Mitarbeiter/innen verschiedener Ämter der Stadtverwaltung.
Die Zusammensetzung der Arbeitsgruppen ist der Anlage 2 zu entnehmen.
Auf der Basis des vorab ermittelten Ist-Zustandes an den Marburger Schulen
wurden in insgesamt 9 Sitzungen die Grundlagen für die nachfolgenden Aus-
führungen des IT-Plans gemeinsam erarbeitet.
An dieser Stelle sei den Mitgliedern der Arbeitsgruppen nochmals herzlich ge-
dankt.
Standards
In den nachfolgenden Ausführungen zu den einzelnen Schulformen und den
unterschiedlichen technischen Bereichen wurden Standards festgelegt, die als
Grundlage für die Beschaffungsmaßnahmen der IT-Ausstattung in den kommen-
den Jahren dienen sollen. Dies bedeutet jedoch keine starre Vorgabe. Berück-
sichtigt man den rasanten technischen Fortschritt in der Informationstechnologie
sowie die sicherlich folgenden Veränderungen in Pädagogik und Didaktik, müssen
diese Standards regelmäßig überprüft und ggf. fortgeschrieben werden. In
diesem Rahmen soll es auch möglich sein, besondere Projekte an den Schulen
ergänzend zu fördern.
Kosten/Finanzierung
Die Ausstattungsoffensive für die Marburger Schulen ist, wie das gesamte Pro-
gramm Schule @ Zukunft, auf fünf Jahre ausgelegt, beginnend mit dem Jahr
2001. Seitens des Landes wird (berechnet nach Schülerzahlen) bezogen auf die
- 7-Laufzeit von fünf Jahren, ein Zuschuss in Höhe von ca. 260.000,00 € gezahlt.
Dazu kommen verpflichtende Komplementärmittel der Stadt Marburg in Höhe
von 340.000,00 € für das Programm Schule @ Zukunft.
Diese Haushaltsmittel sind zu ergänzen um Gelder für Pilotprojekte, in denen be-
sondere Innovationen zunächst an einzelnen Schulen getestet werden sollen
sowie um die Mittel für die notwendigen Ergänzungen und Ersatzbeschaffungen,
die bereits in den vergangenen Jahren jeweils in den städtischen Haushalten vor-
gesehen waren. Es errechnet sich dann eine Investitionssumme in Höhe von ca.
1 Mio. € für die Jahre 2001 - 2005 (siehe Kostenaufstellung ab Seite 43).
In diesen Mitteln sind noch keine Kosten für den Bereich des Support enthalten.
Wie den entsprechenden Ausführungen ab der Seite 41 zu entnehmen ist, liegen
bisher noch keine klaren und verbindlichen Regelungen zwischen dem Land
Hessen und den Kommunen zur Aufteilung der Kosten des Support vor. Nach
dem derzeitigen Stand der Verhandlungen sollen die Kosten für den Support vor-
aussichtlich jeweils zur Hälfte zwischen dem Land und den Kommunen aufgeteilt
werden. Der Gesamtansatz ist somit nach einer abschließenden Regelung
entsprechend zu erhöhen.
Auch die Festlegung dieser Haushaltsmittel stellt nur einen Rahmen dar. Letzt-
endlich ist Grundlage für die Umsetzung des IT-Plans die Veranschlagung der
entsprechenden Investitionsmittel in den jeweiligen Haushalten durch die Stadt-
verordnetenversammlung.
Verfahren
Die Schulen können im Rahmen der nachfolgenden Standards Mittel beim Schul-
amt abrufen. Grundlage hierfür ist ein konkretes Medienkonzept der Schule, das
dem Schulamt vorzulegen ist (siehe Anlage 4). Die Schule muss darlegen, wie sie
neue Medien in den Unterricht integrieren und die Medienkompetenz der Schüle-
rinnen und Schüler fördern will. Dabei ist deutlich auch auf die Medienkompetenz
der Lehrkräfte einzugehen. Auf der Basis dieses Medienkonzepts in Form einer
Bestandsaufnahme und einer Zielplanung soll dann die - schrittweise - Ausstat-
tung der Schule beantragt werden.
- 8-Ausblick
Die Ausstattung der Schulen mit neuen Medien mit einem Standard wie von
vielen Fachleuten gefordert, kann von der Stadt Marburg allein nicht bewältigt
werden. Insofern ist die Beteiligung des Landes im Hinblick auf die ergänzenden
Haushaltsmittel und die erwarteten Regelungen für den Bereich Support ein
wichtiges Zeichen.
An dieser Stelle appellieren wir an das Land, das Programm Schule @ Zukunft
nicht nur als Anschubfinanzierung zu verstehen, sondern sich über das Pro-
gramm hinaus dauerhaft und verbindlich an den Ausgaben im Bereich der EDV zu
beteiligen und ergänzende Investitionszuweisungen zu leisten. Gleiches gilt für
den Bereich der Lehreraus- und -fortbildung. Nur konkrete Aus- und Fortbil-
dungsmaßnahmen gewährleisten einen sinnvollen und effektiven Einsatz der
Hardware-Ausstattung in den Schulen.
Dieser Appell geht auch an den dritten Partner des Projekts Schule @ Zukunft,
nämlich die hessischen Unternehmer. Auch die Wirtschaft wird aufgefordert, sich
im Rahmen der Schwalbacher Erklärung verstärkt an dieser wichtigen Zukunfts-
investition zu beteiligen.
- 9-Ausstattung
Grund- und Sonderschulen
Während dreier Sitzungen mit Vertreter/innen der Grund- und Sonderschulen,
des Hessischen Landesinstituts für Pädagogik (HeLP) und des Staatlichen Schul-
amtes wurden die Strukturen für die Ausführungen zu den Grund- und Sonder-
schulen erarbeitet. Außerdem wurde eine Umfrage bei den Schulen vorgenom-
men, in welchem Umfang bisher EDV im Unterricht genutzt wird.
Es wurde deutlich, dass die Anforderungen in den Grundschulen und in den Son-
derschulen sehr unterschiedlich sind, so dass die beiden Schulformen nachfol-
gend getrennt behandelt werden, wobei die allgemeinen Aussagen zu den
Grundschulen i.d.R. auch für die Sonderschulen zutreffen.
Grundschulen
Allgemeines
Bei den Sitzungen wurde deutlich, dass sowohl die Ausstattung als auch die Nut-
zung und die Einbindung in den Unterricht der Grundschulen sehr unterschiedlich
sind. Die Palette reicht von der Nutzung sehr alter, gebrauchter PC in den Klas-
senräumen durch einzelne Lehrkräfte bis hin zu konkreten Konzepten zur
Nutzung der EDV im Unterricht in den einzelnen Jahrgangsstufen einer Grund-
schule.
Mit Ausnahme einiger Neuanschaffungen des Schulträgers bzw. der Finanzierung
aus den Budgets der Schulen verfügen die Grund- und Sonderschulen in der
Regel über ältere PC aus Sponsoring oder Elternspenden. Dies beeinträchtigt
natürlich einerseits die Nutzung und Einbindung in den Unterricht und erfordert
andererseits einen relativ hohen Wartungsbedarf. Darüber hinaus werden kon-
krete Planungen und das Erstellen von Konzeptionen erschwert.
Die derzeitige Ausstattung wird entweder als Einzel-PC in den Klassenräumen
verwendet oder es erfolgt eine Organisation eines kleinen Computerraumes in
der Schule. Es haben sich ca. 2/3 der Grundschulen einen kleinen Computerraum
- 10 -eingerichtet, da viele Arbeitsformen im Bereich der Grundschulen in einem
solchen Raum besser durchzuführen sind als durch die klassischen Einzel-PC
bzw. kleinere Medieninseln in den Klassenräumen.
Insofern wurden die Anforderungen an die zukünftige EDV-Ausstattung auch
sehr unterschiedlich formuliert. Von den Schulen wird mit differenzierten Ar-
gumenten sowohl der Nutzung einzelner PC in den Klassenräumen als auch der
Einrichtung kleiner Computerräume Präferenz eingeräumt.
Im Gegensatz zur bisherigen Ausstattungen der Grund- und Sonderschulen steht
jedoch die Bedeutung des Einsatzes der EDV auch in diesen Schulformen. Die
Schülerinnen und Schüler sollen bereits im Grundschulalter an den PC herange-
führt werden, und sie sollen die Grundfunktionen des PC erlernen.
Konkret stellen sich folgende Einsatzmöglichkeiten dar:
Ø Verfassen und Gestalten eigener Texte und Geschichten
Ø Vertiefen des Lernstoffes durch Lernprogramme
Ø PC als Förder- und Differenzierungsmedium
Ø Nutzung von Informationsmedien und Internet
Ø Email-Nutzung
Ø Besondere Projekte (z.B. Schulzeitung gestalten)
Diese Einsatzmöglichkeiten und die dadurch einzusetzende Software erfordern
jedoch auch von den PC in Grundschulen eine gute Performance. Es ist nicht
damit getan, die Grundschulen mit gebrauchten PC auszustatten, sondern die
differenzierten Nutzungsmöglichkeiten bedingen eine entsprechend hochwertige
Ausstattung.
Ausstattungsstandard
Insofern muss es ein Ziel sein, alle Grundschulklassen mit kleinen Medieninseln
von zwei bis vier PC auszustatten und darüber hinaus in den Schulen auch einen
Computerraum für die gesonderte Arbeit zur Verfügung zu stellen. Eine solche
- 11 -Ausstattung bedingt dann natürlich auch die Vernetzung der Klassenräume
verbunden mit der Anbindung der PC an einen Server und das Internet.
Dieses Ziel ist jedoch langfristig anzustreben. Derzeit rechtfertigen weder die
konkreten Konzepte und Lehrpläne für den Bereich der Grundschulen noch der
Ausbildungsstand der Lehrkräfte eine solch immense Investition.
Trotz alledem muss auch die Ausstattung der Grundschulen mit einer hohen Pri-
orität versehen werden. Insofern sollte mittelfristig ein Standard erreicht wer-
den, nach dem alle Grundschulen über zwei PC pro Klasse verfügen. Die
Höchstzahl neuer und leistungsstarker PC sollte dabei zunächst auf 10 pro Schule
beschränkt sein.
Im Rahmen dieses Programmes wären somit für die Grundschulen insgesamt ca.
160 PC neu zu beschaffen, wobei davon auszugangen wird, dass ein Teil der PC
bereits vorhanden ist (in der Summe ca. 20%).
Berücksichtigt man den Umstand, dass derzeit an vielen Schulen noch keine
konkreten Konzeptionen vorliegen und auch die entsprechenden Schulungen der
Lehrkräfte noch durchgeführt werden müssen, können diese Investitionen sicher-
lich auf die nächsten 3 - 4 Jahre verteilt werden. In diesem Zeitrahmen wären
auch die Finanzmittel zur Verfügung zu stellen.
Grundvoraussetzung für eine entsprechende Finanzzuweisung aus dem Pro-
gramm Schule@Zukunft ist es jedoch, dass seitens der Schulen eine konkrete
Konzeption zur Einbindung der EDV in den Unterricht vorgelegt wird. Darüber
hinaus ist auch die Qualifikation der Lehrkräfte zu dokumentieren.
Zentraler Punkt einer solchen Konzeption muss die Frage sein, in welchem
Bereich die EDV eingesetzt wird.
Nach den Diskussionen zeichnen sich drei Bereiche ab:
a) 1 - 2 PC in jedem Klassenraum
b) 3 - 4 PC in einigen Klassenräumen
c) Einrichtung eines Computerraums mit ca. 10 PC
- 12 -Es wird zu sehr unterschiedlichen Konzeptionen in den Schulen kommen, die
durchaus auch mehrere der o. g. Punkte beinhalten und auch die jetzt vorhande-
nen (älteren PC) umfassen. Wichtig ist jedoch, dass es sich um ein schlüssiges
Konzept handelt, das zukunftssicher Auskunft über den EDV-Einsatz an der
jeweiligen Schule gibt.
In diesem Zusammenhang werden das Land Hessen, das Staatliche Schulamt
und das HeLP aufgefordert, insbesondere die Grundschulen verstärkt zu unter-
stützen. Gerade bei der Erarbeitung von Konzeptionen zur Einbindung in den
Unterricht in Grundschulen müssen Hilfestellungen gegeben werden.
Ansonsten genießt grundsätzlich die Vernetzung einer gesamten Grundschule
keine Priorität. Unabhängig davon sind natürlich bei anstehenden Umbau-,
Renovierungs- und Neubaumaßnahmen die Voraussetzungen zu schaffen, dass in
Zukunft eine Vernetzung der Schulen möglich ist.
Sonderschulen
Die Anforderungen an den EDV-Einsatz in den Sonderschulen sind sehr unter-
schiedlich. Zu berücksichtigen sind hier die individuellen Bedürfnisse und Kon-
zeptionen einer Schule für Lern- und Erziehungshilfe (Pestalozzischule), einer
Schule für Praktisch Bildbare, einer Schule für Körperbehinderte (an der Erich
Kästner-Schule) und einer Schule für Sprachbehinderte (Fronhofschule).
Insofern werden diese Schulen nachfolgend kurz einzeln behandelt, da eine
Gesamtkonzeption nicht vorzunehmen ist.
Zur Frage der Vernetzung der gesamten Schule wird jedoch auf die Ausführun-
gen im Bereich der Grundschulen verwiesen:
a) Pestalozzischule
Die Anforderungen der Pestalozzischule orientieren sich eher an dem Bereich
der Grundschulen und der Sekundarstufe I. Berücksichtigt man die pädagogi-
schen Erfordernisse, so muss die Pestalozzischule über einen EDV-Raum ent-
sprechend der Sekundarstufe I verfügen. Die Schule wird einen entsprechen-
den Antrag auf Einrichtung eines solchen Raumes stellen. Ansonsten wird
- 13 -derzeit an der Schule ein Konzept zur weiteren Einbindung der EDV erarbei-
tet. Im Rahmen dieser Konzeption können zusätzliche Anforderungen entste-
hen, die jedoch zum heutigen Zeitpunkt in diesen Plan nicht aufgenommen
werden können.
b) Schule für Praktisch Bildbare
In der Schule für Praktisch Bildbare kommen bereits heute in vielen Gruppen-
räumen PC zum Einsatz. Es handelt sich jedoch zumeist um ältere und somit
nicht leistungsfähige Geräte. Es kommt eine besonders auf den Personenkreis
der Schüler/innen zugeschnittene Software zum Einsatz. Zusätzlich werden
allgemeine Spiel- und Lernprogramme eingesetzt.
Perspektivisch sollte jeder der 10 Gruppenräume über einen leistungsfähigen
PC verfügen. Ein gesonderter Computerraum ist pädagogisch nicht sinnvoll.
c) Fronhofschule
Die Fronhofschule verfügt über relativ kleine Lerngruppen, die es gut ermögli-
chen, den PC in den Klassenräumen einzusetzen. Die Schule wünscht den Ein-
satz von zwei PC pro Klassenraum, so dass hier die allgemeine Konzeption der
Grundschulen angewandt werden kann.
d) Schule für Körperbehinderte an der Erich Kästner-Schule
Die Situation an der Schule für Körperbehinderte bedingt den Einsatz von PC
in den Klassenräumen aber auch die Nutzung kleinerer Medieninseln für eine
Lerngruppe.
Für einige Schüler/innen stellt der PC augrund ihrer Behinderung ein notwen-
diges Hilfsmittel dar. Andererseits werden zusätzlich Lernprogramme analog
der Regelschulen eingesetzt. Durch die relativ kleinen Lerngruppen und auf-
grund der personellen Ausstattung ist es hier sinnvoll, die Klassenräume mit
PC auszustatten. Jede Klasse sollte daher mit mindestens einem leistungsfä-
higen PC ausgestattet sein.
Ergänz end dazu erfolgt in einem kleineren Computerraum eine „Grundschu-
lung“ und die Durchführung gesonderter Projekte, die in Klassen nicht mög-
- 14 -lich sind. Insofern ist auch die Ausstattung eines Computerraumes mit ca. 6
PC vorzusehen.
- 15 -Sekundarstufen I und II
Allgemeines
An dieser Stelle muss nicht gesondert auf die Notwendigkeit des Einsatzes der
neuen Medien in den Klassen der Sekundarstufen I und II eingegangen werden.
Die Einbindung der neuen Medien in den Unterricht, die informationstechnische
Grundbildung und die Nutzung des Internet sind an allen Schulen obligatorisch.
Die neuen Lehrpläne ab dem Schuljahr 2002/03 sehen deutliche Strukturen der
informations- und kommunikationstechnischen Grundbildung und Medien-
erziehung vor und verpflichten die Schulen zum Einsatz der neuen Medien. Dies
umfasst die Unterrichtung in der Handhabung der Computer, die Einführung in
Textverarbeitung u. ä. mehr, so dass in der Regel die klassischen EDV-Räume
zur Verfügung zu stellen sind. Darüber hinaus beinhalten sie in den nachfolgen-
den Jahrgangsstufen auch die Einbindung der neuen Medien und somit der PC in
die Themenkomplexe der einzelnen Unterrichtsfächer.
Insofern ist der Ausstattung der Schulen mit Sekundarstufen I und II eine hohe
Priorität einzuräumen.
In drei Arbeitsgruppensitzungen wurde mit Vertreter/innen der Schulen, des
Staatlichen Schulamtes und des HeLP der derzeitige Einsatz der EDV diskutiert
und Perspektiven für die Zukunft entwickelt.
Daraus ergeben sich für die Schulen in der Stadt Marburg die nachfolgenden
Standards.
Ausstattungsstandard
EDV-Fachräume
Jede Schule mit Sekundarstufe I und II verfügt über einen modern aus-
gestatteten EDV-Raum mit 15 Schülerarbeitsplätzen, einem Lehrerarbeitsplatz
und einem Server. Dieser EDV-Raum ist mit entsprechendem Mobiliar aus-
gestattet, vernetzt und verfügt darüber hinaus über die notwendigen Peripherie-
Geräte wie Drucker, Scanner, Digitalkamera und Videodatenprojektor.
- 16 -In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass dieser Standard in der
Stadt Marburg an allen Schulen erreicht ist.
Die Konfiguration zukünftig auszustattender Räume richtet sich nach dem jeweils
aktuellen technischen Standard und ist für den jetzigen Zeitpunkt der Anlage 3
zu entnehmen.
Unter Berücksichtigung des rasanten technischen Fortschritts im Bereich der EDV
ist davon auszugehen, dass nach ca. sechs Jahren eine Neuausstattung der
Hardware, zumindest aber eine entsprechende Aufrüstung notwendig ist.
An den drei Marburger Gymnasien reicht ein EDV-Raum nicht aus. Aufgrund der
Schülerz ahlen und der Nutzung, die in Zukunft sicherlich noch zunehmen wird,
ist in der Regel ein zweiter EDV-Raum notwendig, der ebenfalls über eine
hochwertige Ausstattung verfügen muss.
Diese Ausstattung sollte sich an dem ersten EDV-Raum orientieren, kann aber
auch eine konkrete Schwerpunktsetzung der jeweiligen Schule berücksichtigen
und beispielsweise über mehr Arbeitsplätze bei einem reduzierten technischen
Standard verfügen.
Auch in den Haupt- und Realschulen sowie der Richtsberg-Gesamtschule geht
man davon aus, dass in Zukunft die Nutzung so ansteigt, dass ein zweiter EDV-
Raum notwendig ist. Auch hier ist die individuelle Schwerpunktsetzung der
Schule zu berücksichtigen. Es reicht jedoch aus, den Raum auf einem niedrigeren
technischen Niveau (beispielsweise mit gebrauchten PC) zu bestücken.
Sonstige Ausstattung
Neben diesen klassischen EDV-Räumen wird folgender Standard festgelegt, an
dem sich die noch zu erstellenden Medienkonzepte der Schulen orientieren
sollten.
a) Eine mobile Präsentationseinheit bestehend aus einem Notebook und
einem Beamer.
b) Eine Medienecke bzw. ein „Internet-Cafe“ mit vier bis sechs vernetzten
Arbeitsplätzen und einem Zugang zum Schulserver sowie zum Internet zur
- 17 -Nutzung für kleinere Arbeitsgruppen. Sie sollen insbesondere zur Internetre-
cherche dienen. Für diesen Raum muss eine konkrete Konzeption und eine
Nutzungsordnung vorliegen.
c) Die naturwissenschaftlichen Fachräume verfügen über mindestens einen
leistungsfähigen PC. Nach Möglichkeit soll dieser PC Zugang zum Schulnetz
und zum Internet haben, und es ist pro Schule ein (mobiler) Beamer vorzuse-
hen.
d) Die Schule soll über mindestens zwei Lehrerarbeitsplätze verfügen, beste-
hend aus einem leistungsfähigen PC mit Anschluss an das Schulnetz und das
Internet sowie einem Drucker und einem Scanner.
Der Standard zu den Punkten a) - d) wurde von den Schulen wie folgt begrün-
det:
Zu a)
Zur Arbeit mit neuen Medien gehört, dass diese im Unterricht eingesetzt und
entsprechend für alle Schüler/innen präsentiert werden können. Dies kann gut
über eine mobile Präsentationseinheit erfolgen. Diese muss nicht zwangsläufig
einen direkten Zugang zum Schulnetz bzw. dem Internet haben, da lokal
entsprechende Präsentationen vorbereitet und im Unterricht vorgeführt werden
können. Diese Einheit kann sowohl von Lehrer/innen als auch Schüler/innen
genutzt werden.
Zu b)
In den Arbeitsgruppensitzungen wurde ausgiebig über die Nutzung von PC in den
Klassenräumen diskutiert. Es bestand weitgehend Einigkeit darüber, dass derzeit
der Einsatz einzelner PC in den Klassenräumen keinen Sinn macht und pädago-
gisch nur sehr schwer in den Unterricht einzubinden ist. Dies ist u. a. damit
begründet, dass die Geräte z. T. veraltet sind und in der Regel über keinen Netz-
Zugang verfügen. Selbst wenn dieser jedoch gewährleistet wäre, sieht man nur
begrenzte Einsatzmöglichkeiten, die den immensen Investitionsbedarf nur
bedingt rechtfertigen. Vor diesem Hintergrund sollte jede Schule über eine frei
zugängliche Medienecke verfügen, die auch im Unterricht von einzelnen
Schüler/innen genutzt werden soll.
- 18 -Zu c)
Gerade in den naturwissenschaftlichen Fachräumen macht der Einsatz eines PC
Sinn. Die neuen Medien können hier sehr gut dazu genutzt werden, Versuche zu
dokumentieren, Experimente vorzuführen oder aber den PC beispielsweise für
entsprechende Messprotokolle einzusetzen. Insofern sollte jeder naturwissen-
schaftliche Fachraum über einen leistungsfähigen PC verfügen. Ähnlich den Aus-
führungen zu den mobilen Präsentationseinheiten muss dieser nicht zwangsläufig
an das Internet bzw. Schulnetz angeschlossen sein, wobei dies allerdings auch
aus Gründen des Supports Sinn macht. Notwendig ist darüber hinaus, dass eine
entsprechende Präsentation über einen mobilen Beamer möglich ist.
Zu d)
Der Einsatz neuer Medien im Unterricht muss auch den Lehrkräften die Möglich-
keit geben, den Unterricht am PC vorzubereiten, eine Internet-Recherche durch-
zuführen u. ä. mehr. Dazu erscheint es notwendig, dass auch Lehrerarbeits-
plätze zur Verfügung zu stellen sind, die einen Anschluss an den Server der
Schule sowie das Internet haben sollten und darüber hinaus über die ent-
sprechenden Peripherie-Geräte (Drucker, Scanner, Brenner) verfügen müssen.
Wie bereits ausgeführt, kommt der Ausstattung der Schulen mit Sekundarstufen
I und II eine hohe Priorität zu. Konkrete Beschaffungsmaßnahmen sind aller-
dings auch an diesen Schulen vom Vorliegen einer konkreten Konzeption zum
Einsatz der EDV in der jeweiligen Schule abhängig.
Perspektivisch dazu wurde angeregt zu überprüfen, inwieweit mobile Laptop-
Einheiten eingesetzt werden können. Zur Begründung ist anzuführen, dass viele
Schulen Raumprobleme haben und somit fest eingerichtete EDV-Räume nur
bedingt geschaffen werden können. Darüber hinaus kann ein Laptop-Pool kurz -
fristig eingesetzt werden und ist nicht nur von einer Klasse, sondern
möglicherweise durch die Mobilität auch von mehreren kleineren Lerngruppen
gleichzeitig zu nutzen.
Dazu notwendig wäre die Anschaffung von 15 Laptops, die entsprechend
vernetzt sind und für die eine Aufbewahrungseinheit zu schaffen ist, die den
Support und die dauerhafte Einsatzfähigkeit ermöglichen. Es handelt sich hier um
eine erhebliche Investition, die perspektivisch einen deutlichen
- 19 -Innovationsfortschritt bietet, vorab jedoch zunächst einmal an einzelnen Schulen
erprobt werden sollte.
Hinsichtlich der Vernetzung der Schulen mit Sekundarstufen I und II wird auf die
Ausführungen ab Seite 22 verwiesen. Grundsätzlich muss die Schule über einen
zentralen Server verfügen, der die EDV-Räume, die Medienecken ggf. die natur-
wissenschaftlichen Fachräume und die Lehrerarbeitsplätze versorgt.
Perspektivisch ist, wie in allen anderen Schulformen auch, die Vernetzung der
gesamten Schule anzustreben. Erst wenn dieses Ziel umgesetzt ist, wird es zu
einem verstärkten Einsatz von EDV in den Klassenräumen kommen.
- 20 -Berufliche Schulen
Der Bedarf an EDV in den drei beruflichen Schulen der Stadt Marburg ist sehr
unterschiedlich und richtet sich nach den einzelnen Berufs- und Ausbildungs-
feldern. In allen Schulen wurden in den vergangenen Jahren erhebliche Mittel
investiert, um die über 20 EDV-Fachräume einzurichten und immer wieder den
gestiegenen technischen Anforderungen anzupassen.
Aufgrund der besonderen Anforderung an die einzelnen Berufsfelder ist es nicht
möglich, im Rahmen dieses Planes eine konkrete IT-Konzeption vorzunehmen.
Vielmehr muss der Schulträger flexibel auf neue Anforderungen reagieren.
Insofern erfolgt hier keine konkrete Festlegung, sondern lediglich die Aussage,
dass auch für die Zukunft sicherzustellen ist, dass die beruflichen Schulen über
eine ausreichende EDV-Ausstattung verfügen, die es ihnen ermöglichen, ihrem
Bildungsauftrag gerecht zu werden. Dazu sind, wie in den vergangenen Jahren
auch, entsprechende Haushaltsmittel zur Verfügung zu stellen, die vorrangig aus
den Mitteln der Schulbaupauschale des Landes Hessen, d.h., gesonderten Haus-
haltsveranschlagungen der Stadt Marburg zu finanzieren sind.
Ergänzend dazu besteht außerhalb der berufsspezifischen Anforderungen ein
ähnlicher Bedarf wie an den Schulen der Sekundarstufe I und II.
Insofern sind die dort formulierten Standards (Präsentationseinheit, Medienecke,
naturwissenschaftliche Fachräume und Lehrerarbeitsplätze) auch auf die beruf-
lichen Schulen zu übertragen. Auch hier sind die Beschaffungsmaßnahmen vom
Vorliegen konkreter Konzeptionen für diese Bereiche abhängig.
Dabei sollen spezifische Anforderungen einzelner Schulen berücksichtigt werden.
Aufgrund des hohen Ausstattungsstandards kommt den Bereichen Netzwerk und
Support in den beruflichen Schulen eine besondere Bedeutung zu. Sie sind mit
einer hohen Priorität zu versehen.
- 21 -Netzwerk
Allgemeines
Den neuen Medien kommt als Hilfsmittel für ein zielgerichteteres, interessanteres
und vielschichtigeres Lehren und Lernen eine entscheidende Schlüsselrolle zu.
Sie können selbst Inhalt eines Unterrichtes sein, sie können jedoch auch zur För-
derung von Medienkompetenz eingesetzt werden.
Zwingende Voraussetzung dafür ist neben einer bedarfsorientiert ausgerichteten
Ausstattung und einer möglichst hohen Verfügbarkeit der eingesetzten Kompo-
nenten auch die schulinterne Vernetzung mit Möglichkeiten zur Nutzung der
„externen“ Vernetzung - des Internet, des E-Mail - Dienstes sowie der Vernet-
zung der Schulen untereinander. Eine hohe Verfügbarkeit ist vor allem durch eine
wartungsarme und manipulationsresistente IT-Struktur zu erreichen, die, als
Standard auszuarbeiten und für alle Marburger Schulen verbindlich festzulegen,
Aufgabe einer vom Schulamt initiierten Arbeitsgruppe war. Die Standardisierung
der Ausstattung und der Netzstruktur ist von entscheidender Wichtigkeit, da nur
einheitliche Komponenten und Strukturen eine effiziente Betreuung und Wartung
möglich machen.
Der Vernetzung von Arbeitsplätzen in möglichst allen Unterrichtsräumen ist hohe
Priorität einzuräumen, weil sie die technische Voraussetzung für die unterricht-
liche Nutzung, für den Zugang zum Internet aber auch für innovative Formen der
Administration, Wartung und Fehlerbehebung ist.
Ist-Zustand
Im Zusammenhang mit dem initiierten Projekt schule@zukunft wurde im Früh-
jahr 2001 eine Umfrage an sämtlichen Marburger Schulen vorgenommen, um
den aktuellen IT - Ausstattungsstand zu ermitteln.
Demnach verfügten zum damaligen Zeitpunkt 14 Schulen über mindestens einen
funktionsbereiten EDV - Raum (alle Sek. I/II - Schulen, alle Berufsschulen, 6
Grundschulen, keine Sonderschule). Die PC in den einzelnen EDV - Räumen
- 22 -waren bis auf eine Ausnahme (1 EDV-Raum in der ARS) untereinander als Ether-
net - Netzwerke (ca. 60 % 10/100BaseT-Twisted Pair, ca. 40 % 10Base2-BNC)
verbunden. In den Beruflichen Schulen und dem Gymnasium Philippinum exis-
tierte darüber hinaus bereits eine Kombination mehrerer EDV - Räume über
einen dedizierten Schulserver.
Dort, wo bereits eine schulinterne Vernetzung existiert ist diese als „gewachsen“
und sehr heterogen zu bezeichnen: Neue Netzsegmente und Unterverteilungen
wurden nacheinander an die bestehende Netzstruktur angebunden.
Größtenteils wurde das Kabelnetzwerk in vorhandenen Brüstungskanälen verlegt.
In neueren EDV - Räumen wurden auch die möbelseitigen Kabelkanäle genutzt.
Die EDV - Ausstattung in den Grundschulen, Arbeitsplatz-PC und Drucker, wurde
oft eigenverantwortlich lose und ohne Kabelführung direkt untereinander ver-
netzt.
In allen Marburger Schulen konnte über mindestens einen PC die Verbindung
zum Internet hergestellt werden. Dort, wo ein EDV - Raum vorhanden war,
wurde die Zugangsmöglichkeit meist für alle Rechner geschaffen.
Die Internet - Anbindung vernetzter Rechner erfolgte entweder über einen expli-
ziten Hardware - Router oder über eine auf einem Server installierte Software -
Lösung, z.B. AVM Ken. In der Regel wurden die von der Deutschen Telekom
kostenfrei zur Verfügung gestellten ISDN - Anschlüsse genutzt. Dort, wo es
erforderlich war, wurden weitere kostenpflichtige Anschlüsse installiert.
Schulinterne Vernetzung
Schulnetz
Die fächerübergreifende Nutzung der neuen Medien erfordert, dass Computer in
allen Unterrichtsräumen zugänglich sein müssen. Dadurch ist eine schulweite,
über das Netzwerk einzelner EDV - Räume hinausgehende Vernetzung erforder-
lich.
Entsprechend den Festlegungen für die einzelnen Schulformen und ausgehend
von der derzeitigen IT - Struktur in den Marburger Schulen soll der schulinterne
- 23 -Vernetzungsgrad kontinuierlich ausgebaut werden. Perspektivisch soll der
fächerübergreifende Einsatz der neuen Medien in allen Unterrichtsräumen mög-
lich sein. Der Umfang der Gebäudevernetzung ist allerdings weiterhin maßgeblich
von einem pädagogischen IT - Konzept der jeweiligen Schule abhängig. Das Bau-
amt der Stadt hat dafür Sorge zu tragen, dass ohnehin fällige Neu-, Um - und
Erweiterungsbaumaßnahmen sowie Renovierungsarbeiten zur Umsetzung dieser
Vorgabe genutzt werden. Die Erweiterung der schulischen IT-Infrastruktur soll
dadurch in Zukunft ohne tiefgreifendere bauliche Maßnahmen vorgenommen
werden können.
Die Schüler- und Lehrerarbeitsplätze in EDV - Räumen und naturwissenschaft-
lichen Fachräumen, die PC in Bibliothek, Medienecken, Internet - Cafe und Leh-
rerzimmer und die darüber hinaus vorgesehenen Anschlusspunkte in den Klas-
senräumen sind in ein leistungsfähiges schulweites Rechnernetz einzubinden,
welches entsprechend den Richtlinien für eine strukturierte Gebäudeverkabelung
zu konzipieren ist. Das Modell der strukturierten Verkabelung
• ermöglicht die strukturierte Konzeption des Netzes,
• beinhaltet die redundante Auslegung zur Erhöhung der Ausfallsicherheit,
• fördert die Integrations- und Migrationsfähigkeit der gesamten Netzarchi-
tektur,
• kann zur Reduzierung des Administrations- und Wartungsaufwandes beitra-
gen und
• bietet einen weitgehenden Investitionsschutz für die nächsten 10 - 15 Jahre.
Aus Gründen der Kompatibilität und hinsichtlich der Perspektive, Schulnetze an
das städtische „Local Area Network“ ( LAN ) anzubinden, wurde vereinbart, das
von der Stadt Marburg bereits großflächig eingesetzte Konzept für eine struktu-
rierte Verkabelung auch in den Schulen zu verwenden. Dieses Konzept basiert
zur Zeit auf der von Lucent/ Avaya entwickelten sogenannten Systimax/
GigaSpeed-Verkabelung. Dementsprechend sind für die Gebäude- und Etagen-
verkabelung (Sekundär- und Tertiärbereich der strukturierten Verkabelung)
grundsätzlich ungeschirmte, 8-adrig aufgelegte Kupferkabel (Twisted Pair, TP)
der Gigabit Ethernet-Kategorie 6 zu verlegen. Für die Geländeverkabelung
(Primärbereich) sowie dort, wo es die Längenbeschränkungen für kupferbasierte
- 24 -Kabel erfordern, sollen Lichtwellenleiter (Glasfaserkabel) verwendet werden. Um
eine hohe Qualität der installierten Verkabelung zu gewährleisten, müssen aus-
führliche Prüfprotokolle einer dafür zertifizierten Elektro-Firma vorgelegt werden.
Die Verkabelung verbindet die Anschlussdosen sternförmig mit einem Sternmit-
telpunkt, in der Regel einem Hub/Switch bzw. einem Patchpanel in einem für
19“-Geräte optimierten Netzwerkschrank. Der Netzwerkschrank ist den Erforder-
nissen entsprechend als Stand- oder Wandmodell, mit integriertem Lüfter bzw.
Kühlsystem, auszuwählen.
EDV - Raum
Die EDV - Fachraum - Netze, in der Regel bestehend aus 15 Schülerarbeits-
plätzen und einem Lehrerarbeitsplatz, sind über einen Hub/Switch mittels
Kupferkabel oder - falls aufgrund der Längenbeschränkungen erforderlich - mit-
tels Lichtwellenleiter an ein Patchfeld im LAN - Serverschrank anzubinden.
Strom- und Netzkabel werden an den Wandflächen entlang in Brüstungskanälen
mit getrennten Stegen verlegt, die grundsätzlich auch die Anschlussdosen für die
Arbeitsplätze beinhalten. Je Schüler-/ Lehrerarbeitsplatz ist eine RJ 45 - Doppel-
anschlussdose vorzusehen. Um Kapazitäten für Netzerweiterungen bzw. anzu-
schließende Peripheriegeräte zu erhalten, sind fünf weitere Doppelanschluss-
dosen einzuplanen. Falls erforderlich, wird das EDV - Mobiliar mit weiteren Netz-
und Stromanschlussmöglichkeiten ausgestattet. Als Steckersystem müssen die in
der Euro-Norm EN 50173 spezifizierten RJ 45 - Verbinder und Anschlussdosen
verwendet werden.
Da Sicherungen beim gleichzeitigen Einschalten mehrer Computer der dabei ent-
stehenden Spitzenbelastung oft nicht gewachsen sind, sollen die Räume elektro-
technisch mit mehreren getrennten Stromkreisen - für jeweils ca. 4 PC - bedient
werden. Die die Schülerarbeitsplätze versorgenden Stromkreise müssen anhand
eines Schlüsselschalters mit optischer Kontrollmöglichkeit regelbar sein. Um
mögliche Überspannungen und Kurzschlüsse zu vermeiden ist es von Vorteil,
dass die Einschaltung der Stromkreise minimal zeitversetzt erfolgt.
- 25 -Einzelplätze
Perspektivisch sind alle Klassenräume mit mindestens einer Doppel - Netz-
anschlussdose auszustatten, um Einzelplätze oder - über einen Hub - auch
mehrere Arbeitsplätze, evtl. in Form von Medieninseln, an das Schulnetz anzu-
binden.
Außerhalb von klassischen EDV-Räumen, in Unterrichtsräumen wo statische PC-
Arbeitsplätze nicht erforderlich sind, können so auch mobile Präsentations-
einheiten ohne großen Aufwand angeschlossen werden. Bestückt mit einem her-
kömmlichen PC mit Monitor oder alternativ unter Verwendung eines Notebooks
sowie eines Beamers und Lautsprecherboxen können derartige Sets auf fahr-
baren PC-Wagen für die multimediale Unterrichtsunterstützung in den Klassen-
räumen herangezogen werden.
Alternative: Funk - Vernetzung
In Ausnahmefällen, aber als durchaus mögliche Ergänzung oder Alternative zu
den kabelbasierten Netzen, können auch Funknetze dort in Betracht kommen, wo
es die individuelle schulische Planung, Ausstattung und Infrastruktur zulässt.
Besonders interessant ist deren Einsatz in Kombination mit mobilen Notebooks
oder mobilen Desktop - PC. Allerdings ist zu beachten, dass die derzeitige dem
Standard 802.11b entsprechende Bandbreite solcher Netzwerke mit nominell 11
MBit/s /effektiv ca. 5 MBit/s) nicht ausreicht, heutzutage bereits übliche multi-
mediale Anwendungen - mit Ausnahme des Internet - oder Administrations-
/Wartungstools in hinlänglich guter Performance zu übermitteln bzw. auszufüh-
ren. Sofern der erforderliche Standard (802.11a) in Deutschland zugelassen
wird, ist in nächster Zeit zu erwarten, dass Funk-LAN - Komponenten mit einer
bis zu 5 - fach höheren Bandbreite zu erschwinglichen Preisen auf dem Markt
angeboten werden. Zu beachten ist, dass die Übertragungsqualität und die
Reichweite stark von den Umgebungseinflüssen abhängig sind. Darüber hinaus
liegen abschließende wissenschaftliche Untersuchungen über die Auswirkungen
der Strahlenemissionen von Funkvernetzungen noch nicht vor. Diese Diskussio-
nen und die technische Weiterentwicklung hinsichtlich der Funk - Vernetzung
- 26 -sind aufmerksam weiter zu verfolgen und hinsichtlich eines eventuellen umfang-
reicheren Einsatzes der Funktechnologie zu prüfen.
Alternative: Vernetzung über Stromleitungen
Bestrebungen, die in jedem Gebäude vorhandene Stromversorgungsnetze zur
Datenübertragung zu nutzen, gibt es seit einigen Jahren. Der derzeitige
Sachstand lässt es allerdings als sehr ungewiss erscheinen, dass die „Powerline“
- Technologie zu einer effektiven und kostengünstigen Alternative zur
herkömmlichen Verkabelung werden könnte. Einige der Entwickler und Vertreiber
dieser Technologie haben ihr diesbezügliches Produkt bereits wieder vom Markt
zurück gezogen.
Netzwerk - Struktur
Zum Aufbau eines schulweiten Netzwerkes wird auf die vom PI Frankfurt als
„klassisches Konzept“ bezeichnete dezentrale Struktur zurück gegriffen. Ziel ist
es, eine wartungsarme und manipulationsresistente IT - Struktur zu schaffen,
die auch die pädagogischen Rahmenbedingungen einbezieht. Dabei sind
organisatorische und technische Vorgaben (s. Kapitel „Support“) zu
berücksichtigen und aufeinander abzustimmen.
Zentraler Schulserver
Für die schulweite Benutzerverwaltung, die Bereitstellung von Daten,
Informationen, Speicherplatz, CD-ROMs und Diensten soll perspektivisch ein
zentraler Schulserver eingesetzt werden. Der Aufwand für die Administration und
den Support fällt dadurch deutlich geringer aus.
Zur Minimierung des Installations- und Wartungsaufwandes soll eine statische
Benutzerverwaltung eingerichtet werden, wie sie das Konzept des PI Frankfurt
vorschlägt. Demzufolge existieren zwei fixe Benutzergruppen, bezeichnet als
„Lehrer“ und „Schüler“. Die Einrichtung der Lehrer - Gruppe als
personenorientierte Benutzerverwaltung mit individuellen Daten erfolgt einmalig
- 27 -und ist nur relativ wenigen Veränderungen unterworfen. Die
arbeitsplatzorientierte Schüler - Benutzerverwaltung wird mit allgemeinen PC-
platzbezogenen Daten aufgebaut und erfolgt somit anonymisiert. Persönliche
Daten kann die Lehrer - Benutzergruppe üblicherweise über ein
„Homeverzeichnis“ auf dem Server sichern, der Schülergruppe wird das Sichern
privater oder persönlicher Daten über einen FTP-Server - eingerichtet auf dem
zentralen Schulserver - ermöglicht. Gleichzeitig kann auf dem FTP-Server auch
ein schulweit oder projektbezogen nutzbares Austauschverzeichnis eingerichtet
werden.
Vordefinierte Benutzer- Server - und Laufwerkstrukturen stehen online über
www.lo -net.de kostenlos zum download zur Verfügung.
Ein zusätzlicher dedizierter Server kann sowohl die Funktion eines Sicherungs
- Servers (BDC) als auch die Funktion eines Kommunikationsservers übernehmen
und dient als solcher primär zur Anbindung des Schulnetzes an das Internet.
Alternative: Terminalserver- Server/ Thin-Client
Als Alternative zu herkömmlichen Server - Client - Netzwerken stehen
sogenannte lokale Terminalserver - oder Server/ Thin - Client - Varianten zur
Disposition.
Die Kapazitäten für die Bereitstellung der Anwendungen, die Rechnerleistung bei
der Ausführung der Applikationen, Datensicherungsmöglichkeiten und üppig
dimensionierter Speicherplatz werden nur auf dem Server bereitgehalten, der
entsprechend hochleistungsfähig konzipiert werden muss. Die Client -
Arbeitsplätze werden primär als Eingabe- und Anzeigeterminals eingesetzt und
erfordern nur eine um eine leistungsfähige Grafikkarte und einen ergonomischen
17“ - Monitor ergänzte Minimal - Ausstattung. Dies birgt reizvolle wirtschaftliche
und logistische Vorteile, kann man doch bereits PC ab der 386er -
Leistungskategorie als Client-PC weiter verwenden. Zur Zeit ist diese Netzwerk -
Variante allerdings noch mit einigen Inkompatibilitäten hinsichtlich üblicher
Windows- und Schul - Software sowie Einschränkungen im Betrieb des
Netzwerkes behaftet. Den günstigen Hardware - Kosten stehen ferner hohe
Kosten für die Software (für Server und Client) entgegen und relativieren den
Preisvorteil deutlich.
- 28 -Daher wurde entschieden, die Weiterentwicklung der Terminalserver/ Thin -
Client - Systeme zu verfolgen. Dort, wo diese Lösung im Einklang mit den
pädagogischen und infrastrukturellen Bedingungen sinnvoll erscheint, z.B. für
bestimmte berufsfeldbezogene Anwendungen in den Berufsschulen, ist es
durchaus denbar, sie bereits jetzt, parallel zur klassischen Server-/ Client -
Variante in den übrigen Bereichen einer Schule zu implementieren.
Unter der Bezeichnung Application Service Providing (ASP) wird eine Technik
angeboten, die auf dem gleichen Grundgedanken wie die Terminalserver -
Variante basiert: Anwendungen/ Applikationen werden nicht lokal gespeichert,
sondern bei Bedarf von zentraler Stelle abgerufen. ASP - Dienste greifen dabei
auf die entsprechenden Applikationen auf Servern im Internet zu, die somit nicht
mehr gekauft, sondern nur für die Zeit der Nutzung gemietet werden müssen.
Neben den Anschaffungskosten für die Software entfallen dadurch auch die
Investitionen für die Pflege und Aktualisierung.
Externe Vernetzung
Zugangsmöglichkeiten zum Internet
Erst die Verbindung zum Internet mit allen seinen komplexen
Nutzungsmöglichkeiten macht einen Schulcomputer zu einem vielseitigen und
leistungsfähigen Lernmedium.
Es wird daher angestrebt, allen PC in EDV - Räumen, naturwissenschaftlichen
Fachräumen, in Medienecken und im Lehrerzimmer einen Zugang zum Internet
zu ermöglichen. Computer, die gemeinsame Internet- (oder Server-) dienste
nutzen wollen, müssen entweder einzeln an eine Telefonleitung angeschlossen
werden, oder sie nutzen eine entsprechende lokale Vernetzung.
Um mit einem oder mehreren Computern Zugang zum Internet zu erlangen,
braucht man neben einigen Hard- und Softwarevoraussetzungen zwingend auch
einen Kommunikationsanschluss und einen Dienste - Anbieter (Provider).
Jede Marburger Schule in städtischer Trägerschaft verfügt inzwischen über einen
von der Deutschen Telekom AG im Rahmen der Initiative T@School unentgeltlich
bereitgestellten ISDN - Anschluss mit gebührenfreiem T-Online - Zugang zum
- 29 -Internet für Unterrichtszwecke und realisiert den Zugang in der Regel bereits
über einen Provider ihrer Wahl. Perspektivisch wäre es aus administrativen
Gründen sinnvoll, einen geeigneten zentralen Provider zu finden.
Von der Möglichkeit, lokale E-Mail-Server einzurichten und jedem Schüler und
jedem Lehrer so eine eigene E-Mail-Adresse zur Verfügung zu stellen, sollte im
Hinblick auf die Minimierung des Einrichtungs- und Wartungsaufwandes Abstand
genommen werden. Darüber hinaus gibt es fernmelderechtliche Bedenken bei
der privaten Nutzung schulischer E-Mail - Accounts. Als praktikable Alternative
bietet sich an, von jedem Internet-PC aus greifbare, webbasierte E-Mail -
Accounts zu nutzen.
Die Deutsche Telekom ist derzeit dabei, die ISDN - Anschlüsse zu gleichen Kon-
ditionen um einen ebenfalls kostenfreien T-DSL - Anschluss - der einen ca. 7 -
fach höheren Datendurchsatz ermöglicht - zu erweitern bzw. umzuwandeln, so-
fern dies technisch möglich ist.
Technisch wird der ISDN - Anschluss durch die Installation eines NTBA - Gerätes
mit sogenanntem S0 - Bus realisiert, an den ein mit einer ISDN - und Netzwerk-
karte ausgestatteter (Kommunikations-) Server angeschlossen wird, der seiner-
seits die Verbindung über einen Switch und ggf. weiteren Netzverteilern (Hubs)
zu den an das interne Netzwerk angeschlossenen PC herstellt. Nur der mit
einem Software - Router wie z.B. AVM Ken! ausgestattete Kommunikations-
server ist physikalisch mit dem Telefonnetz verbunden und arbeitet als Proxy -
Server für die PC im Netz. Wird eine einmal aufgerufene Internetseite noch ein-
mal angefordert, erfolgt kein erneuter Transport über die Internet-Verbindung,
vielmehr kann die Anforderung aus dem lokalen Zwischenspeicher abgerufen
werden. Sofern ein T-DSL - Anschluss genutzt werden kann, ist der Server mit
einer weiteren Netzwerkkarte mit dem DSL-Modem zu verbinden.
Schulsekretariat/ Schulverwaltung
Der Internet - Zugang der Schulsekretariate/ Schulverwaltung ist aus Gründen
des Datenschutzes zwingend vom Unterrichtsnetz getrennt zu betreiben
und muss erforderlichenfalls über einen weiteren, dann allerdings
kostenpflichtigen ISDN/ DSL - Anschluss an das Internet angebunden werden.
- 30 -Auf dem Weg, die Schulverwaltung in das städtische Intranet zu integrieren und
künftig auch den Zugang in das Internet mittels der Kommunikationsstrukturen
der Stadt zu realisieren, hat das Schulamt eine datenschutzrechtlich abge-
sicherte Zwischenlösung erarbeitet. Demnach erhält der Verwaltungsbereich über
einen skalierbaren Hardware - Router mit Firewall - Funktion Zugriff auf Internet
- und E-Mail - Dienste. Als Provider fungiert das Marburger Unternehmen ICC,
das auch für die Anbindung des städtischen Bereiches zuständig ist und dadurch
eine zukünftige Integration der Schulverwaltung in das Stadt - LAN ohne größe-
ren organisatorischen Aufwand ermöglicht. Darüber hinaus gestaltet sich die Ein-
richtung und Pflege der Mail - und Web - Dienste einfacher, wenn sie über eine
zentrale Infrastruktur erfolgen kann.
Sicherheit im Netzwerk der Schule und im Internet
Eine verantwortliche Nutzung des Internets im Rahmen der schulischen Angebote
(Unterricht, Bibliothek, Medienecken usw.) setzt sowohl einen technischen
Schutz der PC im lokalen Netzwerk vor Angriffen aus dem Inter- und Intranet,
vor Computerviren und vor fahrlässigem Benutzerverhalten als auch einen
inhaltlichen Schutz vor diversen Angeboten im Internet voraus. Die Problema-
tik wird im Rahmen dieses IT - Planes aus organisatorischen Gründen nur über-
sichtsweise behandelt und wird zu einem späteren Zeitpunkt explizit thema-
tisiert.
Ein umfangreicher technischer Schutz für die Rechnersysteme einer Schule
beginnt bei der Sicherung der Räume, in denen Computer mit sensiblen Daten
aufgestellt sind, sieht die Verwendung von Passwörtern, den Einsatz von Soft-
warelösungen und nicht zuletzt die Einbindung von Firewall - Konzepten vor.
Schutz vor unerwünschten Internet - Inhalten kann in erster Linie ein Proxy -
Server gewährleisten. Anfragen eines LAN-Benutzers werden gefiltert an das In-
ternet weitergereicht, verbotene Adressen werden geblockt. Ähnliches leistet
kommerzielle Software vorrangig hinsichtlich des Schutzes einzelner lokaler
Rechner.
- 31 -Jeglicher inhaltlicher Schutz steht ab einem gewissen Grad in deutlichem Kon-
trast zu dem eigentlichen innovativen Nutzungscharakter des Internets, schränkt
er nicht selten die Recherche- und Kommunikationsmöglichkeiten deutlich ein.
Daher ist es eminent wichtig, den Schülerinnen und Schülern auf Grundlage
eines schulspezifisch definierten Konzeptes einen verantwortungsbewußten und
kritischen Umgang mit den neuen Medien zu vermitteln.
- 32 -Support
Die dauerhafte Implementierung moderner Informations- und Kommunikations-
technologien als eine zentrale Aufgabe der Schulträger erfordert transparente,
aufeinander abgestimmte Prozesse und eine dauerhafte organisatorische Struk-
tur. Deshalb soll hier im Rahmen der IT-Planung ein eng mit den Ausstattungs-
vorhaben verzahntes Supportkonzept vorgelegt werden. Dies ist dringend erfor-
derlich, um Risiken von Fehlinvestitionen oder nicht absehbaren Folgekosten zu
minimieren.
Die Planung zukünftiger IT-Strukturen zeichnet sich zum einen durch einen deut-
lichen Anstieg installierter Hardware in Form von
Ø Ergänzung bisheriger EDV-Räume
Ø zusätzlichen PC-Arbeitsplätze in Klassenräumen
Ø frei zugänglichen Medienecken und Internetcafes
als auch durch eine entscheidende Erweiterung der Funktionalitäten aus:
Ø Bereitstellung schulweiter Daten und Netzdienste
Ø weitgehende Vernetzung aller PC incl. Internetanbindung
Daraus wird deutlich, wie der Supportaufwand zukünftig allein durch diese
Erweiterung der Infrastruktur und der zur Verfügung zu stellenden Dienste
wachsen wird. Über den bereits zu leistenden Support für Einzelplatz-PCs und
vernetzte PCs in EDV-Räumen hinaus wird die Administration eines Schulnetzes
mit allen planerischen Vorrausetzungen zu leisten sein.
Status
Wie im ersten Teil des Planes „Ausstattung“ hinreichend beschrieben, finden wir
in den Schulen fast durchgängig eine sehr heterogene Infrastruktur vor, sowohl
was die eingesetzte Hardware als auch Betriebsysteme und Standardsoftware
betrifft. Aktionen, Spendeninitiativen, die Notwendigkeit der Ausschreibungs-
- 33 -Sie können auch lesen