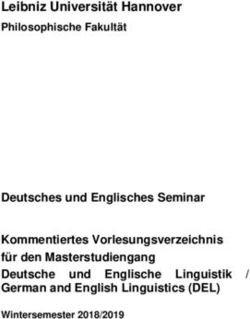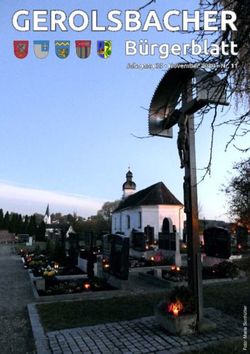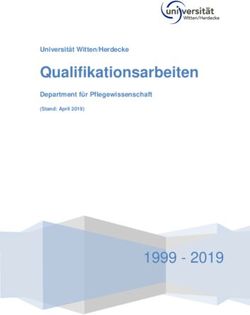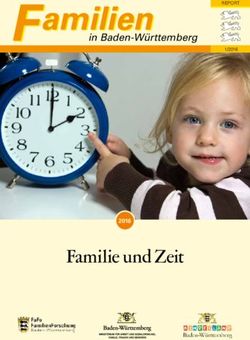Metaphern und Identität in biographischen Interviews mit deutsch-jüdischen Migranten in Israel
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Metaphern und Identität in biographischen Interviews mit
deutsch-jüdischen Migranten in Israel
Simona Leonardi, Universität Neapel Federico II (simona.leonardi@unina.it)
Abstract
Gegenstand der Untersuchung sind biographische narrative Interviews aus dem
Korpus, das Anne Betten und Mitarbeiterinnen zwischen 1989 und 2007 mit meist in den
1930er Jahren in Palästina/Israel eingewanderten deutschsprachigen Juden zusammen-
gestellt haben. Anhand einer qualitativen linguistischen Metaphernanalyse wird der Ver-
wendung bestimmter Bilder im Rahmen der Identitätskonstruktion nachgegangen: Es geht
einerseits um Metaphern, die das Migrationserlebnis als Bruch thematisieren, anderseits um
Metaphern, die dazu beitragen, die eigene Lebensgeschichte als ein kohärentes und har-
monisches Ganzes zu rekonstruieren. Eine feinkörnige linguistische Analyse dieser Me-
taphern bzw. der zugrundeliegenden Konzeptualisierungen, die auch die Rolle von Agency
und Positionierung mit einbezieht, erweist sich als ertragreich, um Facetten der Identitäts-
konstruktion zu offenbaren, die während des Interviews nicht immer bewusst gesteuert
werden. Aus den analysierten Beispielen wird ferner deutlich, dass metaphorische For-
mulierungen ein wichtiges Element zur Herstellung von Textkohärenz sind, denn sie
werden oft über mehrere Sätze oder auch über das ganze Interview hin fortgeführt.
On the basis of narratives from the corpus put together by Anne Betten and collaborators
between 1989 and 2007, which consists of narrative interviews with Jewish immigrants who
went to Palestine/Israel from German-speaking areas mainly in the 1930s, I carry out a
qualitative analysis of metaphorical expressions used by the speakers when they deal with
questions regarding their identity construction. While the metaphors employed mostly
highlight the profound break in their lives caused by migration, expressions contributing to
present their life story as a coherent and harmonic whole are also used. A fine-grained
linguistic investigation of these formulations and their underlying conceptualisations, also
including the role of agency and positioning, will prove fruitful in revealing aspects of the
speakers’ identity construction that are not explicitly presented in the course of the
interviews. A further outcome of the analysis is that metaphorical expressions can be an
important factor in producing text coherence, as they often span across several sentences or a
whole interview.
1. Einleitung: Das Korpus, biographische Interviews und Identität
Gegenstand meiner Untersuchung sind Interviews aus dem sogenannten
Israelkorpus, das zwischen 1989 und 2007 von der Sprachwissenschaftlerin
Anne Betten und Mitarbeiterinnen in Israel zusammengestellt wurde; es
handelt sich um narrative biographische Interviews mit Israelis, die vor-
wiegend in den dreißiger Jahren aus rassistischen und politischen Gründen
Nazi-Deutschland bzw. die nach und nach annektierten Gebiete verlassen
mussten und in das damalige Palästina einwanderten. Das von der DFG
77metaphorik.de 29/2019 unterstützte Projekt sollte ursprünglich die „Sprachbewahrung nach der Emigration“ dokumentieren, wie später der Titel der beiden von Anne Betten herausgegebenen Bände zum Projekt lautete.1 Im Rahmen der Datenerhebung wurden soziolinguistische und auch ethnografische Methoden angewandt, 2 denn die Teilnehmenden am Projekt wurden auch auf der Grundlage eines vierseitigen Fragebogens ausgewählt, durch den Daten wie Alter, Geburtsort, Herkunft von Eltern und Großeltern, Zeitpunkt der Emigration und Gründe dafür sowie sprachliche und soziale Praktiken (d.h. Fragen wie „Kenntnis des Iwrit“, „Sprache innerhalb der Familie“, „Sprachsituation (z.B. „In welcher Sprache denken Sie? Was lesen Sie?“, „soziale Kontakte in Israel“ und „Kontakte zum deutschsprachigen Raum“) ermittelt wurden. Dadurch, durch informelle Gespräche und teilnehmende Beobachtung wurde ethnogra- phisches Wissen gewonnen.3 Im Lauf eines biographischen Gesprächs, in dem die interviewten Personen ihre Lebensgeschichte erzählen, wird Identitätsarbeit betrieben (vgl. Ricoeur 1996; Lucius-Hoene/Deppermann 2004a, passim, z.B. 56). Es sei darauf hingewiesen, dass (autobiographisches) Erzählen hier als „autobiographische Gesamterzählung“, d.h. als „Oberbegriff für das gesamte kommunikative Verfahren“ verstanden wird (Lucius-Hoene/Deppermann 2004a: 142). Die autobiographische Gesamterzählung kann diverse Textsorten miteinbeziehen: 1) Erzählen im weiteren Sinne als spezifisch diachrone Darstellungsform, die 1 S. Betten (1995) u. Betten/Du-nour (2000). Das Korpus, das aus drei Unterkorpora besteht („Emigrantendeutsch in Israel“ (IS), „Emigrantendeutsch in Israel: Wiener in Jerusalem“ (ISW) und „Zweite Generation deutschsprachiger Migranten in Israel“ (ISZ)), ist in Mannheim bei dem AGD (Archiv für gesprochenes Deutsch) des IDS (Institut für Deutsche Sprache), aufbewahrt und über die DGD (Datenbank für gesprochenes Deutsch) via Internet erreichbar, s. https://dgd.ids-mannheim.de; es ist auch am Institute of Contemporary Jewry/Oral History Division der Hebrew University of Jerusalem archiviert (vgl. Betten/Du- nour; Emigrantendeutsch in Israel). In diesem Beitrag werde ich mich auf Interviews aus dem Unterkorpus IS beziehen. 2 S. De Fina/Tseng (2017: 383), die in den meisten linguistischen Studien zu Identität und Migration eine „ethnographic orientation“ feststellen. 3 S. Deppermann (2000) „Zu Nutzen und Notwendigkeit von Ethnographie für die Kon- versationsanalyse“ (so der Untertitel seines Aufsatzes). Im ursprünglichen Korpus IS (1989– 1994) wurden die Interviews von vier Interviewerinnen geführt: Anne Betten, Miryam Du- nour, Eva Eylon und Kristine Hecker. Während Du-nour und Eylon selber in Israel lebten und somit zu dem zu untersuchenden Feld gehörten, kamen Betten und Hecker aus Deutschland; für sie gilt die Notwendigkeit ethnographischen Wissens. Die Fragebögen zum Korpus IS sind bei über die DGD zugänglich (unter ‚Zusatzmaterialien‘). 78
Leonardi: Metaphern und Identität in biographischen Interviews
ihrerseits verschiedene Muster umfasst (a. szenisch-episodische Erzählung,
vgl. Labov/Waletzky 1967, b. Bericht, c. Chronik und d. Anekdote), 2)
Beschreiben und schließlich 3) Argumentieren (Lucius-Hoene/Deppermann
2004a: 142–145; s. auch De Fina/Tseng 2017: 381).
Die Sprechenden leisten Identitätsarbeit, weil das (dialogische) Interview
interaktiv angelegt ist und in dieser Interaktion die erzählenden Personen
Aspekte der eigenen Identität aushandeln können (vgl. Lucius-Hoene
2000: [5–6]). In der Art und Weise wie sie frühere Stufen des Ichs in der
Erzählung auftreten lassen und an den Reaktionen der interviewenden Person
werden „Facetten und Strategien von Identitätsarbeit sichtbar, in denen
personale und soziale Aspekte des erzählten wie des erzählenden Ichs in der
Situation selbst verhandelt werden“ (Lucius-Hoene/Deppermann 2004b: 168).
Dieser Auffassung liegt ein sozialkonstruktivistisches Konzept von Identität
zugrunde, das „die Dynamik, Multiplizität, Flexibilität und lebenslange Unab-
geschlossenheit individueller Identitätsprojekte“ postuliert und das somit „den
Konstruktionscharakter von Identität“ betont (Kresic 2016: 126, Herv. i. O.).
Im Medium des Erzählens wird eine Identität entwickelt, die sich als narrative
Identität entwirft; in diese fließen sowohl „die diachrone, auf einen Plot hin
orientierte Perspektive des Erzählens“ und die „alltäglichen […] Praktiken der
Identitätsherstellung und -darstellung“ (Lucius-Hoene/Deppermann 2004b:
167) ein. Der Ansatz der narrativen Identität geht von einer identitäts-
stiftenden Leistung des Erzählens aus, die Kontinuität und Kohärenz im Laufe
der Lebensgeschichte herstellt (Straub 2000: 205).
Ein wichtiges Instrument zur Analyse der narrativen Identität, wie sie sich in
der Erzählung konstituiert, ist die Positionierung.4 Die Analyse der Positionie-
rung hebt auf die diskursiven Handlungen ab, mit denen ein Sprechender
„sich zu einer sozial bestimmbaren Person macht […] und mit denen er dem
Interaktionspartner zu verstehen gibt, wie er gesehen werden möchte (Selbst-
positionierung)“ (Lucius-Hoene/Deppermann 2004b: 168–169). Fremdposi-
tionierung bezeichnet hingegen die Positionszuweisungen an andere
Personen.
Auch die Analyse der Agency-Kodierungen erweist sich als ertragreich. Die
Kategorie Agency umfasst nach Duranti (2001: bes. 268–269) folgende
4 S. Lucius-Hoene/Deppermann (2004b); Deppermann (2015); zur Positionierung im
sozialen Raum vgl. auch Harré/van Langenhove (1999).
79metaphorik.de 29/2019 Dimensionen: 1) Intentionalität (die auf eine eigene Initiative zurückgeht), 2) Auswirkungen auf Personen bzw. Entitäten (oder sich selbst) und 3) Verantwortung für die eigenen Handlungen (im Zusammenhang mit deren Bewertung). Die Interviews aus dem Korpus IS und späteren Ergänzungen wurden mehrfach im Horizont des Begriffs der „narrativen Identität“ analysiert. Zum Korpus IS vgl. z.B. Thüne (2010), die u.a. auf die Rolle sprachvariierenden Sprechens in der Redewiedergabe und auf die damit verbundenen Identitäts- facetten eingeht, und Betten (2013), die v.a. den Aus- und Umbau der Identität in den narrativen Selbstinszenierungen im Rahmen des Interviews verfolgt.5 Ziel meiner Untersuchung ist eine qualitative linguistische Metaphernanalyse, die auf die Verwendung bestimmter Bilder in den Interviews des Israelkorpus im Rahmen der Identitätskonstruktion hinweist und diese auslegen soll:6 Es geht einerseits um Metaphern, die das Migrationserlebnis als Bruch thema- tisieren (Bsp. 1–4), anderseits um Metaphern, die dazu beitragen, die eigene Lebensgeschichte als ein kohärentes und harmonisches Ganzes zu rekon- struieren (Bsp. 6–9). Eine häufige Strategie, durch die in den Erzählungen aus dem Israelkorpus thematisch Kohärenz und Kontinuität hergestellt wird, ist nämlich der Bezug auf die deutsche Sprache, Kultur 7 und auch auf die Landschaft, in der man aufgewachsen ist (s. Bsp. 2; 9). Es wird wiederholt aber auch der soziale, kulturelle Bruch durch die Emigration thematisiert (s.u. Bsp. 1–5) und die damit verbundene schwierige Lage im neuen Land. Beide Themenbereiche scheinen zentral zu sein innerhalb der Prozesse der Identitätsbildung, der Identitätsfindung oder -anpassung, was sich auch in der Selbstdarstellung während des Interviews zeigt. 5 S. auch Betten (2013c); mit Bezug auf die Identitätskonstruktionen der 2. Generation s. ferner Betten (2011) und (2016). 6 S. De Fina/Tseng (2017) für eine Zusammenfassung zur Forschung zu Identität und Migration; s. ferner Golden/Lanza (2013) im Hinblick auf die Verwendung von „Metaphors of culture“ in der Identitätskonstruktion. 7 S. Betten (2013a); viele Gesprächspartner*innen betrachten sich und die Schicksals- genoss*innen, die aus Deutschland und annektierten Gebieten nach Palästina auswanderten, als diejenigen, die die Vor-Nazi-Kultur weitergeführt und -gepflegt haben. Das gilt auch für den Sprachgebrauch, vgl. Betten (2000), wie der Haupttitel zeigt: „Vielleicht sind wir wirklich die einzigen Erben der Weimarer Kultur“, ein Zitat aus dem Interview mit Joseph Walk (= IS_E_00135); Österreicher*innen sprachen manchmal vom „Burgtheaterdeutsch“, dazu s.a. Betten (2011: 205–208). 80
Leonardi: Metaphern und Identität in biographischen Interviews
2. Metaphern
Wenn die neueren Identitätskonzepte auf den Konstruktionscharakter von
Identität hinweisen und dabei ihre Konstitution in der dialogischen
Interaktion hervorheben (s.o.), stellt dies auch eine Kritik an der
cartesianischen Auffassung des Ichs (De Fina 2011: 267) dar. Ähnliches gilt
auch für die Kognitive Linguistik und für ihre Metapherntheorie, die
wiederholt als Alternative zum cartesianischen „disembodied mind“ auftritt
(s. z.B. Lakoff/Johnson 1999: 400–409).
Die alternative Logik metaphorischer Formulierungen, die komplexe Er-
fahrungen gestalten und zum Ausdruck bringen, offenbart sich auch in auto-
biographischen Erzählungen. In der Biographie- und in der Erzählforschung8
wurde die Rolle metaphorischer Formulierungen hervorgehoben, denn diese
können nach der Auffassung der Kognitiven Linguistik9 Perspektivierungen,
wie auch Werthaltungen, Wünsche und Emotionen vermitteln. Das geschieht,
weil Metaphern kognitive Wahrnehmungs- und Begriffsmuster sind, mit
denen Menschen selbsterlebte komplexe Erfahrungen gestalten und zum
Ausdruck bringen. Sie stellen die Versprachlichung metaphorisch organi-
sierten Denkens dar, das das menschliche Kognitionssystem durchgehend
strukturiert.
Die Verankerung von Denkstrukturen und metaphorischen Konzepten „im
Fleisch“ (Lakoff/Johnson z.B. 1999) hat auch eine Entsprechung in Ent-
wicklungen der Psychologie, die den Begriff von Identität weiter erhellen: das
„dialogische Selbst“ (s. Hermans bzw. Hermans/Kempen mehrfach, z.B.
Hermans 2001), das die Person mit mehrfachen, facettenreichen Identitäten
sieht, ist ein „verkörpertes Selbst“ (Hermans 2001: 259).
Nach der kognitiven Linguistik besteht die für Metaphern kennzeichnende
Übertragung bekanntlich darin, Beziehungen aus einem Bereich („Bild-
spender“; „Herkunftsbereich“), der konkret in vertrauten körperlichen
8 Zur Metaphernanalyse in der Biographieforschung s. z.B. Straub/Sichler (1989) und
wiederholt Schmitt, etwa (2011) und (2014); in der Erzählforschung s. Golden/Lanza (2013)
und Thüne (2014); zum Israelkorpus s. Leonardi (2010); zur Identitätskonstruktion im Inter-
view mit Betti und Paul Alsberg s. Betten (2014); zur Sprachmetaphorik s.a. Leonardi (2013)
und Thüne/Leonardi (2011).
9 Vgl. Lakoff/Johnson (1980, 1999); Lakoff (1987); s. auch die jüngeren Untersuchungen von
Schwarz-Friesel, z.B. (2013), den von Spieß/Köpcke (2015) herausgegebenen Sammelband
und die Synthesen von Spieß (2014, 2017).
81metaphorik.de 29/2019 Wahrnehmungen/Tätigkeiten/Gegenständen verankert ist, in einen Bereich zu projizieren, der unscharfe Konturen hat und der mit komplexeren Erleb- nissen verbunden ist („Bildempfänger“, „Zielbereich“). Bei diesem Prozess werden einzelne Aspekte sowohl vom Bildspender als auch vom Bildempfän- ger hervorgehoben (highlighting), während andere ausgeblendet (hiding) (s. Lakoff/Johnson 1980: 10–11) werden – dies entspricht der selektiven Funktion metaphorischer Formulierungen. In einem Text bzw. in einer biographischen Erzählung können auch meta- phorische Ausdrücke aus verschiedenen Bildspendern und Bildempfängern in enger Abfolge vorkommen: eine solche metaphorische Verdichtung wird (metaphorisches) Cluster genannt (vgl. Koller 2003; Semino 2008: 24–25). Die Rekursivität von metaphorischen Ausdrücken in Clustern trägt erheblich zur Textkohärenz bei, denn, wenn Metaphern zu einem späteren Zeitpunkt wiederaufgenommen bzw. fortgeführt werden (s.u., v.a. Bsp. 1 und 2 sowie 4– 8), lassen sie eine Art „Metaphern-Echo“ (Koller 2003: 121) erklingen. In einer Metaphernfolge kann auch eine Argumentation entwickelt werden (Schwitalla 2001, s.u. Ballhorns Aufbau einer Patriotismus-Theorie, Bsp. 1). 3. Moshe Max Ballhorn und seine Theorie des Patriotismus Moshe (Max) Ballhorn wird 1913 in Berlin geboren;10 aufgewachsen ist er in Vietz im Landkreis Landsberg (Warthe), damals Mark Brandenburg, heute Witnica in der Woiwodschaft Lebus, Polen; er wird Kaufmännischer Ange- stellter. Ballhorn stammt aus einer vollkommen säkularisierten Familie („Wir haben ja kaum gewusst, dass wir Juden sind“, 11 min 36 s), deren Ein- stellungen er als „patriotisch“ bezeichnet. 11 Erst im Zuge antisemitischer Vorfälle wird ihm sein Judentum bewusst, wie er selber zusammenfasst: „dann bin ich aber zum Juden gemacht worden“ [20 min]. Seinen Patriotismus 10 S. dgd.ids-mannheim.de > Korpus IS > Ereignis IS_E_00006 (PID = http:// hdl.handle.net/10932/00-0332-C3AA-EE5A-9901-8). Die Aufnahme ist direkt durch fol- genden Link erreichber: http://hdl.handle.net/10932/00-0332-C3AA-153A-9801-A. Im Folgenden werden Kurzzitate aus diesem Interview mit Zeitangaben verortet. 11 „Meine Familie stammt aus, seit Jahrhunderten von Jahren, aus Westpreußen in Jastrow, verstehen Sie, und meine von väterlicher Seite und von mütterlicher Seite. Wenn es Deutsche gibt, dann sind wir es, verstehen Sie, dann sind wir die richtig patriotischen Deutschen“ (1 h 10 min 29 s – 1 h 10 min 44 s); vgl. Thüne/Leonardi (2011: 233) für eine Analyse des Ge- sprächsausschnitts, in dem diese Stelle auch vorkommt, mit Hinblick auf die Wurzel- metaphorik. 82
Leonardi: Metaphern und Identität in biographischen Interviews
hat er als Jugendlicher zum Zionismus gewendet („ich bin Patriot und ich war
deutscher Patriot, weil ich so erzogen worden bin und nachdem man mich
weggestoßen hat, bin ich jüdischer Patriot geworden“ (1 h 11 min 09 s – 1 h 11
min 16 s): Er tritt dem jüdischen Jugendbund Betar bei und als Einziger in der
Familie entscheidet er sich bald, so früh wie möglich, auszuwandern. 1933
erfolgt die Emigration nach Palästina, wo Ballhorn anfangs u. a. Bauarbeiter,
später Polizeioffizier (unter der britischen und dann der israelischen Re-
gierung) und schließlich Reiseleiter ist.
Im Lauf des Gesprächs mit Anne Betten entwickelt Ballhorn eine eigene
Theorie vom Patriotismus:
(1) Gespräch Anne Betten (AB) mit Moshe Max Ballhorn (MB) (geb. in Berlin
am 23.12.1913, Emigration nach Palästina 1933), Tiberias, 1.7.1990 (IS_E_00006,
1 h 27 min 27 s – 1 h 29 min 49 s; Gesamtlänge 2 h 19 min 01 s)
MB: [...] das ist doch Quatsch mit Rassen, wie sind die vermischt, wie
sind die Juden vermischt, wie sind die Deutschen vermischt, diese
arische Rasse, ich will schon nicht reden von dem Schrumpfarier
Goebbels etc. oder dem Hitler, der auch wie n Jude aussah, das ist
5 doch alles Quatsch, das ist doch Blödsinn, was heißt hier Jude, wir
sind genauso wie die Deutschen. Wir sind genauso Deutschen wie
die Hugenotten, die man vertrieben hat, Franzosen waren und das
Preußn gemacht haben, die haben einen großen Anteil an Preußen,
das waren keine Deutsche, das waren Hugenotten, protestantische
10 Hugenotten, einen riesigen Anteil haben, ich sehe nur die Namen
beim beim deutschen, beim preußischn Militär und von Rasse zu
reden, was sind denn die Preußen, die Preußen, das sind Slawen
gewesen. Preußen und Deutsche, das ist diese wunderbare
Mischung, nur die Mischung bringt was Positives zur Folge, nur
15 das ist fruchtbar, alles andere ist steril, reine Rasse ist steril und
wir Juden, was sind Juden, wir sind Deutsche, man hat uns
vertrieben und wir sagen, Geh zum Teufl, ihr wollt uns nicht haben,
wir brauchen euch nicht, wir können selber genug, wir haben genug
Eigenschaften, um selber Deutsche zu sein, ohne Deutschland und
20 die Olln, die leben noch alle (LACHT), die die sie sterbn langsam
aus, das ist richtig, Sie haben keine Ahnung, was das Land, wie das
Land profitiert hatte von der Einwanderung der Deutschen, sehn
83metaphorik.de 29/2019
Sie und wie die ein, man nennt sie Jeckes, das ist ein Ehrenname,
Jecke sagt man, ist ein Schimpfname, es ist, kommt aus Osteuropa.
25 Ich sage immer, ich bin, mit Stolz sag ich, dass ich Jecke bin und ich
sage sogar, ich bin sogar stolz, dass ich Preuße bin, ich kann nichts
dafür, ich kann gar nichts dafür, sehn Sie. Aber man kann mir das
nicht abstreiten, oderoderoder ich hab’s, kanns nicht verlieren, das
ist ein ein, das bin ich, wie kann ich das wegwerfen, sehn Sie. Oder
30 andere können sagen, du bist es nicht, ist doch unmöglich
(LACHT), aber wenn man mich rausschmeißt, ich kann auch
Deutscher sein oder Jude sein oder Mensch sein ohne in
Deutschland zu leben und in Deutschland zu wohnen und ich
versuche das zu sein und versuche meinen Kindern, aus meinen
35 Kindern anständige Menschen zu machen, ob sie nun Israelis sind
oder Deutsche oder Hottntottn, spielt keine Rolle.
Am Anfang dieses Gesprächsausschnitts schildert Ballhorn einen Patriotis-
mus, der fern von jedem Rassismus ist und in den verschiedene Kulturen
einfließen; diese können damit einen wichtigen Beitrag für ein Land leisten.
Das veranschaulicht er anhand des Beispiels der Hugenotten und deren
Beitrag zum Aufstieg Preußens (1/6–10). In diesem Rahmen hebt er die
positiven Elemente der „Mischung“ (1/14) hervor, indem er mit dem Adjektiv
„fruchtbar“ (1/15) auf eine organische Konzeptualisierung hinweist. Im
Gegensatz dazu ist „reine Rasse [...] steril“ (1/15). In dieser Argumentation
wird der Ausdruck „deutsche Juden“ positiv besetzt, gerade weil sie sowohl
Juden als auch Deutsche sind (1/16).
In der Folge widerspricht Ballhorn der Fremdpositionierung zu der die
deutschen (und später auch die europäischen) Juden gezwungen wurden, die
sich nicht nur in den Identitätskonstruktionen der Einzelnen niederschlug,
sondern auch in deren staatsbürgerlicher Identität. Obwohl nach Assmann/
Assmann (2006: 12) die staatsbürgerliche Identität „rein deskriptiv, auf
unverwechselbare Differenz hin festgelegt“ ist, mussten deutsche Juden ab
1933 rechtliche Beschränkungen und Diskriminierungsmaßnahmen erleben,
die auch ihre staatsbürgerliche Identität gefährdeten.12 Von den Etappen der
12Für eine ausführlichere Diskussion dieses Punkts mit Bezug auf das Israelkorpus s.
Leonardi (2013: 95–96).
84Leonardi: Metaphern und Identität in biographischen Interviews
Ausgrenzung und Verfolgung deutscher Juden sei hier nur erwähnt, dass die
Nürnberger Gesetze 1935 nicht nur akribisch das „Jüdisch-Sein“ festlegten,
sondern auch einen neuen Rechtsstatus mit vollen politischen Rechten ein-
führten, den Rechtsstatus des „deutschblütigen Reichsbürgers“, der Juden
vorenthalten war. Juden konnten dann nur noch „Staatsangehörige“ sein (vgl.
Essner 2002). Der Schluss von Ballhorns Argumentation ist, dass die deutschen
Juden (die von der „Mischung“ auch profitiert haben) nach ihren „Eigen-
schaften“ (1/19) Deutsche bleiben, paradoxerweise ohne Deutschland zu
brauchen (1/19–20).
Daraufhin weist er mit „die Olln“ und folgenden Postmodifikationen (1/19–
20, „die leben noch alle (LACHT), die die sie sterbn langsam aus“) auf die
Deutschen in Israel hin, von denen „das Land“, d.h. Israel, so „profitiert“ habe
– die aber im Lande spöttisch Jeckes genannt werden.13 Indem Ballhorn die
damals (1990) negativ besetzte Bezeichnung für sich beansprucht, wandelt er
ihre Konnotation ins Positive um (mit Stolz sag ich, 1/25) und positioniert sich
dabei in der Gruppe der Jeckes sowie gleich darauf in einer Untergruppe
davon, als „Preuße“. Mit dem Satz „man kann mir das nicht abstreiten“ (1/27–
28) verdeutlicht Ballhorn ex negativo, dass das Jecke-Sein bzw. das Deutsch-
Sein wesentliche Bestandteile seines Ichs sind; diesem liegt offensichtlich ein
Konzept von Identität zugrunde, das in den Jugendjahren (s.u.) durch das
kulturell-soziale Umfeld geprägt wurde. In dieser ersten, abstrakteren
Formulierung ist die (bedrohliche) Perspektive auf seine Identität eine äußere,
13 Es sei daran erinnert, dass dieses Interview mit Ballhorn aus dem Jahr 1990 stammt – in
den darauffolgenden Jahren hat in Israel die Bezeichnung Jecke allmählich positive
Konnotationen gewonnen; dazu schreibt Lavsky (2017: epub): „Until the 1990s, the epithet
‚Yekke‘ was used to express disrespect. It was meant to characterize the German Jews as to-
tally different from the Eastern European Jews, as being restrained, square, pedant, arrogant
and alienated. The source for this nickname is not clear.“ Mit Bezug auf die 2. Generation
bemerkt Anne Betten (2014: 157-158, Anm. 4): „Erst in den letzten 10 Jahren ist ein
wachsendes Interesse der 2. Generation an ihrem ‚jeckischen‘ Erbe zu verzeichnen, mani-
festiert z.B. durch die 2004 von Wissenschaftlern der 2. Generation in Jerusalem organisierte,
unerwartet zahlreich besuchte Jeckes-Konferenz […]. Aufmerksamkeit weit über Israel
hinaus erregte im Herbst 2012 der Erfolg des ‚Wörterbuchs des gesprochenen Deutsch in
Israel‘ [so der hebr. Titel], auf Deutsch ‚Sabre Deutsch - Das Lexikon der Jeckes‘ betitelt, für
das ein Team von Jeckes der 1. und v. a. 2. Generation 3 Jahre lang ‚charakteristische Jeckes-
Ausdrücke‘ sammeln ließ, die auch denen noch im Ohr sind, die kein flüssiges Deutsch mehr
beherrschen. Das umfangreiche, mit viel Werbegrafik der 1930er und 1940er Jahre bebilderte
Buch […] schaffte es in kürzester Zeit auf Platz 1 der israelischen Bestsellerliste“. Zu den den
Jeckes zugeschriebenen Eigenschaften, auch auf der Grundlage von Belegen aus den Kor-
pora IS und ISZ s. auch Betten (2013).
85metaphorik.de 29/2019
denn als Agens von abstreiten tritt das unpersönliche man (1/27) auf; nach
einem kurzen Zögern (oderoderoder) variiert er die Aussage, indem er eine
Innenperspektive annimmt und er selber zum Agens wird. Hier wird der Um-
gang mit den Bestandteilen seines Ichs konkreter, denn Ballhorn hebt ver-
schiedene Eigenschaften dieser Bestandteile durch eine aus verschiedenen
Verbmetaphern bestehenden Metaphernfolge hervor (clusters, s. Koller 2003):
Er besitzt sie (ich hab’s, 1/28), kann sie „nicht verlieren“ (1/28), sie sind also
integrale Bestandteile, und er kann sie auch nicht „wegwerfen“ (1/29). Der
Unterschied zwischen der Formulierung mit verlieren und der mit wegwerfen
liegt im Agentivitätsgrad, denn im Gegensatz zu verlieren setzt wegwerfen
Intentionalität und Kontrolle vor, d.h. eine stärkere Agentivität – auch wenn es
Ballhorn wollte, könnte er nach seiner Theorie diese Bestandteile nicht ab-
setzen. Wie er selber zusammenfasst, „das bin ich“ (1/29), was bedeutet, dass
diese Elemente eigentlich nicht nur Bestandteile seiner Identität sind, sondern
die Identität selber.
Nach ungefähr fünf Minuten kommt Moshe Ballhorn wieder auf das Erlebnis
der existenziellen und kulturellen Verankerung seiner Familie in Deutschland
zu sprechen:
(2) Gespräch Anne Betten mit Moshe Max Ballhorn (1 h 32 min 53 s – 1 h 36
min 49 s)
AB: Herr Ballhorn, Sie ha/ ich hatte Sie zuletzt gefragt, wie sich in
Ihrem Leben diese Anteile, ein Viertel Preuße
MB: Ja, Preuße ja ja, |sagen Sie ruhig Preuße|
AB: |in Preußen |, ob Sie ein Viertel Preuße
5 sind, Sie sind vielleicht dreiviertel Preuße, ich weiß es nicht –
MB: Ja, ich weiß es nicht (LACHT)
AB: Ein Viertel in Preußen, drei Viertel in Israel, wie mischt sich das
insgesamt jetzt, |wie viel –? |
MB: |Also passen| Se auf da, vielleicht bin ich eine Ausnahme ja,
10 vielleicht bin ich eine Ausnahme, ich glaube sogar, dass ich eine
Ausnahme bin, denn wahrscheinlich dadurch, dass ich, das ist
mein historischer Kopf und das ist mein, vor allen Dingen meine
Herkunft, meine Schulzeit, dadurch dass ich nicht in der
86Leonardi: Metaphern und Identität in biographischen Interviews
Metropolis aufgewachsen bin in Berlin, sondern ich habe etwas,
15 sowa/ etwas gekannt wie Heimat, die man eigentlich nur
hauptsächlich hat, wenn man aufm Lande aufwächst. Vietz war ein
kleiner Ort, Vietz hatte fünftausend Einwohner, ein Marktflecken,
wie man sagt, und ich bin völlig aufgegangen in diesem Ort in
meiner Schule, in den Wäldern in den in Preußen imim im Herzen
20 Brandenburgs, ich hab die Lieder, die Gedichte etc., ist mir heute
noch alle ein Teil von mir und das geht nicht weg, ich werde nie,
was man nennt, ein richtiger Israeli sein und ich habe mich damit
abgefunden, ich bin nicht unglücklich darüber, ich weiß, dass meine
Nachkommen Israelis sind und was kann man noch mehr
25 verlangen (LACHT). Nein, wir sind nicht mehr lange da (LACHT),
wie jeder andere Mensch hat ne bestimmte Zeit und ich kann mich
nicht mehr ändern, ich will mich auch nicht ändern, sehn Sie, aber
ich geh jetzt nicht hier rum undundundund singe, „ich
bin ein Preuße, kennt ihr meine Farben“ 14 oderoderoder singe,
30 „Deutschland, Deutschland über alles“15, singe ich noch manchmal
für mich selber, das muss ich sagen, aber das hört kein Mensch,
sehn Sie und ich weiß, dass ich ein eineinein ich glaube, ich bin ein
Phänomen, sehn Sie. Man kann auch sagen, ein alter Idiot, wie Sie
wollen. Ich weiß, ich werde nie ein Israeli sein, mein Sohn, meine
35 Töchter, meine Enkel, das sind Israelis, die kennen nichts anderes,
aber ich kenne, was anderes, sehn Sie, das ist (LACHT), das klebt
an mir und ich kann es nicht abstreifen, ich kann nicht sagen, ich
lebe zwei Drittel siebzig Jahre in Israel und zwanzig Jahre in
Deutschland, die zwanzig Jahre in Deutschland sind entscheidend
40 für mein ganzes Leben, sie können auch in Honolulu gewesen sein,
sehn Sie. Aber wo ich geboren bin, wo ich meine Erziehung habe, wo
ich meine ersten Eindrücke empfangen habe, wo ich sprechen gelernt
habe, die deutsche Sprache ist mir immer noch lieb, sehn Sie. Ich
14 Erster Vers aus dem von Bernhard Thiersch geschriebenen preußischen Nationallied von
1830; zur Rolle des Liedes im Rahmen des preußischen Patriotismus s. Michels (1913: 160),
nach dem das Preußenlied „d[ie]] preußische[ ] Marseillaise” sei.
15 Bekanntlich erster Vers aus dem Deutschland-Lied (bzw. Lied der Deutschen) August Hein-
rich Hoffmann von Fallerslebens, das 1922 zur Nationalhymne der Weimarer Republik be-
stimmt wurde (s. dazu Sendel 1988).
87metaphorik.de 29/2019
liebe die deutsche Sprache, was meinen Sie, es war nicht so leicht in
45 der, als ich hier eingewandert bin und hab Deutsch gesprochen,
wenn man aus Tel Aviv rauskam, man konnte nicht Deutsch
sprechen, da haben die Leute geschrieen, haben geschrieen und ich
hab immer betont Deutsch gesprochen (wissen Sie) – und heute
noch, ich ichich natürlich gehe (nicht rauf und rum) in Tiberias und
50 spreche Deutsch, das ist ja Quatsch, aber ich ich rede Hebräisch, ich
rede Ara/ je nachdem wies verlangt wird, aber deutsche Sprache ist
mein persönliches Eigentum, die kein Hitler mir wegnehmen konnte
mit . Er kann mir das nicht wegnehmen, dadurch dass er sagt,
55 die Juden sind, ich weiß, was sie sind, ein Dreck oder was, d/d, er
is’n Dreck, sehn Sie. Die Geschichte hat’s bewiesen und ich und das
das ist ein Teil von mir und das ist geblieben, ich hab’s nicht
abgeschr abgestreift und bin heute noch, äh ich bin heute noch
deutscher Patriot und ich ärger mich immer über Deutsche unter
60 meinen Touristen, wenn die mit mir Englisch reden und ich rede
mit ihnen Deutsch.
Die Interviewerin Anne Betten fragt nach der Zusammensetzung der ver-
schiedenen Bestandteile seines Ichs mit Bezug auf die Jahre, die er jeweils in
Deutschland und in Palästina/Israel verbracht hat: ein Viertel seines Lebens
habe er in Deutschland verbracht, drei Viertel in Palästina/Israel (die Jahre in
Israel wurden mehr und mehr, Moshe Max Ballhorn ist an seinem 104. Ge-
burtstag im Dezember 2017 gestorben). Er antwortet, indem er seine
„Herkunft“ erwähnt, seine Kindheit in Vietz. Den Prozess des Heranwachsens
drückt die metaphorische Formulierung „ich bin völlig aufgegangen in diesem
Ort [...]“ (2/18) aus, der die Konzeptualisierung HERANWACHSEN IST OR-
GANISCHES PFLANZENWACHSTUM zugrunde liegt. Daraus ergibt sich, dass, was
für eine Pflanze der Boden ist, in dem sie aufgehen kann, für Ballhorn der Ort
war, an dem er aufgewachsen ist („in meiner Schule, in den Wäldern in den in
Preußen imim im Herzen Brandenburgs“ 2/18–19). Es folgt ein neuer Satz, in
dem er wieder als ich auftritt, ein abgebrochener Satz (2/20–21). Es ist jedoch
klar, dass die materiellen und räumlichen Elemente der vorangehenden Äuße-
rung („diesem Ort [...] Schule, [...] Wäldern [...] Preußen [...] Brandenburg[ ]“)
88Leonardi: Metaphern und Identität in biographischen Interviews
um kulturelle Komponenten („Lieder [...] Gedichte“) ergänzt werden. In der
Folge präzisiert Ballhorn die Eigenschaften dieser Elemente und dabei greift er
Konzeptualisierungen auf, die er schon vorher im Gespräch (s. Bsp. 1, 26–28)
benutzt hatte: „ist mir heute noch alle ein Teil von mir und das geht nicht
weg“ (2/20–21). Mit diesen zwei lexikalisierten Metaphern weist er zum einen
darauf hin, dass diese Elemente heute noch ein Bestandteil von ihm sind, zum
anderen, dass sie es immer sein werden, das gilt auch für die Zukunft,
deswegen sieht er sich nicht als „richtiger Israeli“ (wie seine Kinder und
Enkelkinder es sind). Dies stellt einen Zusatz zu der in Bsp. 1 formulierten
Theorie des Patriotismus dar: wenn er auch ohne Deutschland ein Deutscher
bleibt, wird er nicht zu einem Israeli. Da aber seine Theorie nicht auf Rasse,
sondern auf Umwelt bzw. Kultur gründet, sind seine in Palästina/Israel ge-
borenen Kinder „richtige[ ] Israeli“.
In der Folge betont Ballhorn diesen Punkt, indem er die metaphorischen For-
mulierungen wiederaufnimmt und sie variiert: „das klebt an mir und ich kann
es nicht abstreifen, ich kann nicht sagen, ich lebe zwei Drittel siebzig Jahre in
Israel und zwanzig Jahre in Deutschland“ (2/36–39): das „geht nicht weg“ von
der ersten Erwähnung (2/21) wird jetzt intensiviert durch das Bild des
„Klebens“, durch die er eine objektive Eigenschaft dieser „deutschen“ Be-
standteile zum Ausdruck bringt. Durch „und ich kann es nicht abstreifen“, wo
er als absichtlich handelndes Agens auftritt, verbalisiert er seine eigene Po-
sition zu dieser Eigenschaft, die eine Variation – und somit ein Echo – der
agentiven Formulierung in 1/28 darstellt.
Im Laufe seiner Argumentation bringt Ballhorn verschiedene Beispiele der
Elemente an, aus denen seine Identität besteht (2/41–44), und kommt schließ-
lich auf die deutsche Sprache zu sprechen – dabei bekennt er ausdrücklich
seine emotionale Verbundenheit zum Deutschen: „die deutsche Sprache ist
mir immer noch lieb“ (2/43). Daraufhin versucht er, seine Beziehung zur
deutschen Sprache auf verschiedene Weise zu veranschaulichen: Zuerst gibt er
Beispiele ihrer Verwendung und berichtet, wie er in Israel immer darauf
bestanden habe, die deutsche Sprache zu verwenden (wenn die Situation es
erlaubte, „je nachdem wie’s verlangt wird“, 2/51), obwohl das bedeutete, der
öffentlichen und weit verbreiteten Ächtung des Deutschen entgegen zu treten
89metaphorik.de 29/2019 (2/45–48).16 Dann greift er auf metaphorische Formulierungen zurück: „[die] deutsche Sprache ist mein persönliches Eigentum, die kein Hitler mir weg- nehmen konnte“ (2/51–52). Damit drückt er aus, dass die deutsche Sprache nicht nur ein Bestandteil von ihm, von seiner Identität ist, sie ist auch unan- tastbar, so stark mit ihm verwachsen, dass sie unangreifbar ist. Es handelt sich hier um eine Konzeptualisierung der SPRACHE ALS (UNANTASTBARES) EIGENTUM, das diejenige der Deutsch-Identität als Besitz (1/27–28) weiter- führt. Am Ende dieses Gesprächsausschnitts greift Ballhorn die vorher (2/36–37) benutzten Bildspender wieder auf und verwendet sie, um Eigenschaften dieses spezifischen Bestandteils von ihm, der deutschen Sprache, hervor- zuheben: „das ist ein Teil von mir und das ist geblieben, ich hab’s nicht abgeschr abgestreift“ (2/57–58). Die Formulierung wird aber etwas variiert, denn mit Bezug auf die Sprache sagt er nicht „ich kann es nicht abstreifen“ (2/37), sondern „ich hab’s nicht abgeschr abgestreift“, d.h. indem er den Umstand als vergangen darstellt, tritt er hier als absichtlich handelndes Agens auf, das willentlich verweigert hat, die deutsche Sprache aufzugeben. Obwohl die zugrundeliegende Konzeptualisierung dieselbe wie in (2/37) ist, wird hier die Intentionalitäts-Dimension der Agentivität hervorgehoben. Abschließend sei darauf hingewiesen, dass Ballhorn auf die nächste Frage von Anne Betten („Wann waren Sie das erste Mal wieder in Deutschland?“) antwortet: „also passen Sie auf, ich habe keine Nostalgie und ich werde nicht mehr, wir haben ja schon davon gesprochen, dass ich nicht mehr in Deutsch- land wohnen werde“ (97 min 42 s).17 Das verdeutlicht, dass seine Einstellung zu Deutschland und der deutschen Sprache keine nostalgische ist; sie hängt viel mehr mit seiner Patriotismus-Theorie zusammen (s.o.), nach der er Deutschland nicht braucht, um Deutscher zu sein. 16 Zur Situation der deutschen Sprache in Israel s. Du-nour (2000: 210-211) und Betten (2013b: 168-170); s. auch Deutsch-Israelische Gesellschaft (2016): „Februar 1983: Der Bann der deutschen Sprache wird in den staatlichen Medien aufgehoben. Das Fernsehen strahlt Feuchtwangers ‚Geschwister Oppermann‘ in Originalfassung aus. Richard Wagner und Richard Strauß bleiben tabu.“ 17 Für eine genauere Analyse des auch diese Stelle enthaltenden Gesprächsausschnitts s. Betten (2013: 216-217). Auch im Fragebogen (S. 3) hatte Ballhorn die Frage „Zunächst Bereitschaft zur Rückkehr?“ mit „nein“ beantwortet. 90
Leonardi: Metaphern und Identität in biographischen Interviews
4. Felix Wahle und die Wüstengeneration
Felix Wahle18 wurde 1910 in Prag geboren, wo er an der Handelsakademie
und anschließend Jura studierte; später absolvierte er eine kaufmännische
Lehre in Frankreich und war anschließend dort beruflich tätig. Danach ar-
beitete er in der Papierbranche in Prag und Zagreb. Nach Palästina emigrierte
er mit seiner Frau 1940 aus Zagreb (jugoslawische Quote). In Palästina und
dann in Israel war er zunächst wieder in der Papierbranche tätig, dann
arbeitete er im israelischen Handels- und Wirtschaftsministerium; war
schließlich Sekretär der Handelskammer. Obwohl Wahle derselben Genera-
tion wie Ballhorn angehört (Wahle ist nur drei Jahre älter) – sind die beiden
Biographien jedoch in mancherlei Hinsicht sehr unterschiedlich. Als Wahle
geboren wurde, gehörte z.B. Prag noch dem Habsburgerreich an. Das Ende
des Ersten Weltkriegs bedeutete für die Habsburger-Anhänger einen ersten
großen „Umbruch“, wie Wahle selbst erzählt:
Also 1918 war der Umbruch, und wir lebten, ohne uns einen Meter
zu rühren, plötzlich in einem anderen Staat, waren Tschechos-
lowaken. Mein Vater hat sich bis zu seinem Lebensende 1936 nicht
daran gewöhnt und war bis zum Ende ein großer Österreicher (48
min 4 s – 48 min 26 s).19
Als in den dreißiger Jahren die politische Lage in der Tschechoslowakei
schwierig wurde („damals waren schon starke Gewitterwolken am Horizont,
politische Gewitterwolken am Horizont“ 9 min 12 s – 9 min 20 s), entschied er
sich zunächst für die Emigration nach Frankreich; wie bereits oben erwähnt,
nach Palästina wanderte er erst spät aus (1940), als er bereits verheiratet war.
Man kann aber gewisse Gemeinsamkeiten erkennen, denn auch Wahles fami-
liäre Umgebung war sehr patriotisch – in seinem Fall richtete sich der fami-
liäre Patriotismus natürlich auf das Haus Habsburg,: „Nun will ich bemerken,
geboren bin ich, mein Vater, meine Eltern als Österreicher sch/ äh r/rechtlich
staatsbürgerlich, mein Vater war ein großer Habsburger“ (47 min 2 s – 47 min
18S. dgd.ids-mannheim.de > Korpus IS > Ereignis IS_E_00133 (PID = http://
hdl.handle.net/10932/00-0332-C402-8CFB-A701-2). Direkter Link zur Aufname: http://
hdl.handle.net/10932/00-0332-C402-5B4B-A601-4.
19 Für diesen Ausschnitt in einem breiteren Kontext s. Betten (2011: 212).
91metaphorik.de 29/2019
18 s).20 Ähnlich wie Ballhorn drückt auch er eine starke Bindung an die Orte,
wo er aufgewachsen ist, aus: „Das Ausschlaggebende ist, dass man sich dort
zu Hause fühlt, wo man g/geboren und groß geworden ist und wo worauf
man eine mehr oder weniger schöne Erinnerung hat“. 21 Am Anfang des
Interviews fragt Anne Betten nach den Zusammenhängen in Wahles Leben:
(3) Gespräch Anne Betten (AB) mit Felix Chaim Wahle (FW) (geb. in Prag am
15.8.1910, Emigration nach Palästina 1940), Tel Aviv, 1.7.1990 (IS_E_00133, 4
min 9 s – 5 min 26 s; Gesamtlänge: 1 h 32 min 45 s)
AB: Herr Wahle, erzählen Sie vielleicht ein bisschen über Ihre
Hintergrund i/den ersten großen Abschnitt Ihres Lebens vor der
Emigration in Prag über das Elternhaus usw., damit man sieht, wie
kamen Sie nach Palästina und in kein anderes Land und wie äh
5 sind die Zusammenhänge zwischen diesen zwei so verschiedenen
Lebensabschnitten.
FW: Die Zusammenhänge, ich fange von rückwärts an [...], die
Zusammenhänge bestehen nur in meiner Person, sind gar keine
Zusammenhänge, es sind überhaupt keine gemeinsamen ** Belange
10 da. Mei/mei/mei meine Person
AB: Zwei verschiedene Leben durch
die sie gegangen sind
FW: Ich hab das f/ ich habe das frühere Leben gelebt | **| es wurde
abgeschnitten
15 AB: |ja |
FW: ich hab das neue Leben gelebt, aber die Zusammenhänge also
waren in meiner Person und in der Tatsache, dass ich jüdischer Ab-
stammung bin, sonst wär ich f/ gewiss nicht hierher gekommen,
aber ein ideologischer oder oder sonstiger Zusammenhang besteht
20 in meinem Falle nicht. In vielen anderen Fällen ja, aber in meinem
Falle bestimmt nicht **.
20 Zum Interview mit Wahle im Rahmen der Akkulturationsproblematik der Jeckes s. Betten
(2011: 211–213), wo auch einen längeren Gesprächsausschnitt, aus der sowohl diese Stelle als
auch Bsp. (3) stammen, analysiert wird. Zu Wahle s. auch Majer (2012: 257-273).
21 49 min 2 s – 49 min 14 s; s. auch Betten (2011: 212).
92Leonardi: Metaphern und Identität in biographischen Interviews
Wahle bestreitet dezidiert jeglichen Zusammenhang zwischen dem Leben vor
und nach der Emigration (3/7–10). Dem Kommentar der Interviewerin, es
seien also „zwei verschiedene Leben“ (3/11) fügt er hinzu, das „frühere
Leben“ sei „abgeschnitten“ worden (3/13–14). Er benutzt dabei die lexika-
lisierte „Schnitt“-Metapher 22 , deren Ursprungsbereich auf eine mechanisch
verursachte Trennung hinweist, wobei bei der vom Sprecher verwendeten
Passivkonstruktion („es wurde abgeschnitten“, 3/13–14) ohne Nennung eines
Agens die Ursache implizit bleibt. Die lexikalische Wahl ist hierbei das prä-
figierte Verb abschneiden, wo die Partikel nicht nur die Aktionsart explizit als
egressiv bezeichnet (d.h. der Zustand wird beendet), sondern sie impliziert
auch das Verhindern eines Durchgangs zwischen den beiden resultierenden
Teilen (zur Semantik der Verbpartikel ab in diesem Zusammenhang s. Kliche
2008, v.a. 71–73 u. 79–82). Dementsprechend sei das Leben nach der
Emigration „neu[ ]“ (3/16); daraufhin betont Wahle wieder, dass die Zu-
sammenhänge zwischen dem Leben vor und nach der Emigration nur in
seiner „Person und in der Tatsache, dass [er] jüdischer Abstammung“ sei,
bestehe (3/17–18).
Nach ungefähr dreißig Minuten bittet Anne Betten ihren Interviewpartner,
„von Ihrer Ankunft hier und von den ersten Eindrücken und dann vielleicht
etwas zusammenfassend von Ihrem weiteren Werdegang hier“ zu erzählen
(36 min 11 s – 36 min 28 s). Wahle antwortet wie folgt:
(4) Gespräch Anne Betten mit Felix Chaim Wahle (36 min 35 s – 37 min 48 s)
FW: Ja (6.0) ich äh nehme mir bei meinem Berichte heute [...] kein Blatt
vor den Mund und ich rede wie es mir wie es mir kommt, wie ich
in meinem Innersten fühle und äh lege mir keinen Zwang an, äh
patriot/ besonders patriotisch ääh zu sein. Ich weiß, ich gehöre, wie
5 man es hier nennt, zur sogenannten Wüstengeneration an, das ist
die Generation, die vierzig Jahre lang in der Wüste herumirrte, aber
der es versagt war, ins Heilige Land selbst zu kommen. Äh ich lebe
zwar im Heiligen Land, aber ideologisch bin ich noch immer in der
Wüste, ich gehöre nicht mehr hin, aber ich gehöre noch immer nicht
hierher.
22 Zur „Schnitt“-Metapher in weiteren Interviews des Israelkorpus s. Thüne/Leonardi
(2011); diese Stelle aus dem Interview mit Wahle wurde in Majer (2012: 259-260) aufgeführt
und kommentiert, allerdings ohne Hinweise auf die metaphorische Komponente.
93metaphorik.de 29/2019
10 Ich bin wahrscheinlich einer der wenigen, wenn nicht der einzige
Ihrer Ihrer Gesprächspartner, der sich so ausdrückt. Die meisten
sind wahrscheinlich mit vollem Herzen gehören sie hierher und
fühlen sich hierher gehörig oder wenn sie es nicht tun, bilden sie
sichs ein.
Seine Gefühle im Hinblick auf seine Zugehörigkeit drückt Wahle durch das
Bild der „Wüstengeneration“ (4/5) aus. Die Metapher ist zwar biblischen Ur-
sprungs (Num 23 14:18), sie ist aber auch kulturell verankert in der tradi-
tionellen jüdischen Auslegung dieser Stelle. Dazu schreibt David Grossman
(2010: ebook, Herv. i. O.):
In The Book of Numbers (14:18 ff), God decrees that the entire
generation of those who fled Egypt – a defiant generation that
consistently refused to believe in God wholeheartdly and with
complete faith – will be destroyed in the desert and not brought into
the promised land. Yet the Zohar calls this generation the ,generation
of knowledge’, some envy its having witnessed God’s wondrous
acts during the exodus from Egypt, and its presence at the giving the
law on Mount Sinai. Nevertheless, throughout their history the
Jewish people have conceived of the ,desert generation’ as a lost,
transitional generation, rootless and lacking identity and faith, a
generation tossed in the ‚chasm‘ between past and future, consumed
by anxiety regarding its destiny.
Mit dem Hinweis auf die „Wüstengeneration“ deutet Wahle wohl auf die im
jüdischen kulturellen Gedächtnis verankerte Konzeptualisierung hin, die in
David Grossmans Worten „lost, transitional generation, rootless and lacking
identity and faith“ zusammengefasst ist. Das Bild entwickelt Wahle im Zuge
einer Argumentation, die mit seinem Geständnis mangelnder patriotischer
Gefühle Israel gegenüber anfängt („ich […] fühle und äh lege mir keinen
Zwang an [...] besonders patriotisch […] zu sein“, 4/3–4). Eine ähnliche
Position vertritt Ballhorn, als er darauf hinweist, dass er „nie, was man nennt,
ein richtiger Israeli sein“ wird (2/21–22). Während Ballhorn aber in seiner
Identitätsdarstellung (s.o., Bsp. 1 u. 2) die deutschen Komponenten betont und
damit die Kontinuität zwischen dem Leben vor und nach der Immigration,
23 Die hebräische Originalbezeichnung des Buchs lautet Bamidbar (‚in der Wüste‘).
94Leonardi: Metaphern und Identität in biographischen Interviews
fokussiert Wahle auf das Gefühl mangelnder Zugehörigkeit, was mit dem
kulturellen Bild der „Wüstengeneration“ eingeblendet wird.
5. Josef/Helmut Stern
Im Gegensatz zu Ballhorn und Wahle, die als erwachsene (junge) Männer emi-
grierten, ist Josef Stern24 zum Zeitpunkt seiner Auswanderung 1936 noch ein
Jugendlicher, der das Realgymnasium in Gießen hat abbrechen müssen und
danach ein Semester lang eine Jeschiwa, eine jüdische Hochschule, besuchte.
Nach Palästina kommt er ohne Familie, dank der Jugendalija25; er lebt zu-
nächst im Kibbuz (arbeitet u.a. auf einer Orangenplantage), dann ist er beim
Telegrafenamt tätig und Berufssoldat; schließlich ist er Bibliothekar an der
Universität. Der Vater, dessen zweite Frau (Josef Sterns Mutter starb, als er
zwei Jahre alt war) und deren gemeinsame Tochter (Josef Sterns Halb-
schwester) wurden in der Shoah ermordet (vgl. 5/14).26 Ganz am Anfang ihres
Interviews mit Stern fragt Anne Betten, in welche Phasen er sein Leben
einteilen würde (5/1–3):
(5) Gespräch Anne Betten (AB) mit Josef Stern (JS) (geb. als Helmut Stern in
Gießen am 15.6.1921, Emigration nach Palästina 1936), Haifa, 2.5.1991
(IS_E_00124, 36 s – 1 min 56 s; Gesamtdauer: 1 h 19 min 9 s)
AB: Haifa und Gießen, wenn du jetzt einfach mal assoziierst, sind das
für dich in deinem Leben zwei Welten oder würdest du dein Leben
heute noch in mehr Perioden teilen?
JS: Sicher in mehr Perioden, das ist, damals war’s ’ne ganz andere
5 Welt, damals hieß ich Helmut und das hat schon etwas für sich. Ich
hab’s in meinem Buch beschrieben in ein/ in einem Kapitel. Äh der
äh die Flucht, die Auswanderung war ein Ab/ ein Abschluss eines
24 S. dgd.ids-mannheim.de > Korpus IS > Ereignis IS_E_00124 (PID: http://
hdl.handle.net/10932/00-0332-C3FB-6E6B-9401-E). Persistenter Link für die Aufnahme:
http://hdl.handle.net/10932/00-0332-C3FB-3BDB-9301-D.
25 Jugendalija bezeichnet die Emigration jüdischer Jugendlicher aus Nazi-Deutschland und
annektierten Gebieten ins britische Mandatsgebiet Palästina. Die gleichnamige Organisation
bereitete die Auswanderung aus Europa, die Überfahrt und die Unterbringung in
Wohnheimen in Palästina vor, denn die Jugendlichen emigrierten ohne Eltern, für die die
britischen Behörden keine Visa ausstellten.
26 S.a. das von Josef Stern an Yad Vashem eingereichte Gedenkblatt an den Vater Julius
https://yvng.yadvashem.org/nameDetails.html?language=de&itemId=1035736&ind=74.
95metaphorik.de 29/2019
ganz großen Kapitels und ich hab alles von Neuem angefangen.
Ähm selbst die momentan im Gang befindlichen ähm Versöhnungs-
10 bestrebungen können das nicht überbrüggen/ überbrücken, was
damals abgeschlossen wurde. Äh Wenn ich da noch meine Familie
und meine Kinder mit hinein beziehe, ist dieser Abschluss der
damaligen Periode vollkommen. Denn meine Kinder haben/ und
auch die Enkel haben kaum Beziehungen zu ihrer umgekommenen
15 Familie und in dem Land in dem jene aufgewachsen sind.
Stern greift die von Anne Betten vorgeschlagene lexikalisierte Metapher der
„Welt“ als die mit einer Identitätsfacette verbundene Umgebung auf und
projiziert die mit seiner Geburtsstadt (Gießen) gekoppelte Welt in die Ver-
gangenheit (damals, 5/4); damit distanziert er sein heutiges Ich dezidiert von
der Lebensphase vor der Immigration („ganz andere Welt“, wo ganz als
Intensivierung dient, 5/4). Den Bruch mit der ‚Gießen-Welt‘ veranschaulicht
er, indem er darauf hinweist, dass sein damaliges Ich einen anderen Namen
trug: „damals hieß ich Helmut“ (5/5). Die Hebraisierung der Namen mit der
Alija gehörte zur zionistischen Ideologie27 und war deswegen üblich, umso
mehr im Rahmen der Jugendalija, denn die Jugendlichen hätten sich schwer-
lich dagegen wehren können. Stern nennt hier offenbar die Namensänderung
als Inbegriff seines erzwungenen Schnitts mit der Vergangenheit. Den ur-
sprünglichen Namen setzt er mit seinem früheren Ich in Verbindung und hebt
die Bedeutung der Namensänderung hervor: „das hat schon etwas für sich“
(5/5).
Mit Bezug auf die Gliederung seines Lebens, das er in seiner (auf deutsch
veröffentlichten) Autobiografie (= „mein[ ] Buch“, 5/6; Stark wie ein Spiegel,
1989) vorgenommen hat, betont Stern, dass „die Flucht, die Auswanderung“
„ein Ab/ Abschluss eines ganz großen Kapitels“ (5/7–8) war. Während in
dieser ersten Formulierung unklar bleibt, ob Stern hier wortwörtlich das
27 S. Hoba (2017: 101): „Gemäß der zionistischen Ideologie sollten die ‚Neuen Hebräer‘ ihre
alten familiären Bindungen hinter sich lassen und den neuen Zugehörigkeitskriterien an-
passen. Beispielgebend hatte die zionistische Führung mit David Ben Gurion an der Spitze
ihre Namen längst hebraisiert“; ein weiteres Beispiel aus dem Israelkorpus (ISW), in dem die
Sprecherin, Shoshana Beer, geb. Renée Rothfeld, die Namensänderung thematisiert und
diese in Verbindung mit ihrem Identitätsbruch verbindet, wird in Leonardi (2013: 117)
analysiert.
96Leonardi: Metaphern und Identität in biographischen Interviews
Kapitel des Buchs meint oder metaphorisch den in diesem Kapitel erzählten
Lebensabschnitt, ist die folgende variierende Ergänzung „können das nicht
überbrüggen/ überbrücken, was damals abgeschlossen wurde“ (5/10–11)
eindeutig auf die „ganze andere Welt“ bezogen. Das Lexem Abschluss nimmt
Stern in der Folge wieder auf (5/12), indem er seine (heutige) Familie und
seine Kinder „mit hinein bezieh[t]“ (5/12). Die variierende Wiederholung
eigener Äußerungselemente (Abschluss, 5/7 – abgeschlossen, 5/11 – Abschluss,
5/12) dient zur Intensivierung (Schwitalla 2012: 179–180), in diesem Fall des
fehlenden Zusammenhangs zwischen den verschiedenen Stufen seines Ichs.
Wie schon oben bei abgeschnitten im Interview mit Felix Wahle (3/14) ver-
mittelt auch in diesen drei vom Verb abschließen abgeleiteten Wörtern das
Element ab- das „Verhindern eines Durchgangs“ (Kliche 2008: 103, zum Verb
abschließen). Bei der letzten Wiederaufnahme wird Abschluss zudem durch
vollkommen (5/13) verstärkt: Dadurch wird die Möglichkeit eines Durchgangs
komplett ausgeschlossen.
6. Elsa Belah Sternberg und ihr erfüllter Traum
Eine andere Einstellung zum Judentum und zum Altneuland Eretz Israel lässt
sich im Interview mit Elsa Belah Sternberg28 sehen, die als Else Rosenblüth
1899 in Messingwerk bei Eberswalde in einer frommen jüdischen Familie
geboren wurde. Sie absolvierte in Berlin eine Ausbildung zur Kindergärtnerin
bei Siegfried Lehmann, dem späteren Gründer des Kinderdorfes Ben Schemen
in Palästina, der für eine moderne sozialistisch-zionistische Ausrichtung
sorgte. 1933 (d.h. mit 34 Jahren) wandert sie mit Familie (Mann und vier Kin-
dern) nach Palästina aus, wohin ihre Geschwister schon 1921/22 emigriert
waren.
Im Gespräch zwischen Anne Betten und Else Sternberg kommt das Bild des
Traums, des verwirklichten/erfüllten Traums in Verbindung mit Palästina/
Israel wiederholt vor:
28S. dgd.ids-mannheim.de > Korpus IS > Ereignis IS_E_00126. Persistenter Link für die
Aufnahme: http://hdl.handle.net/10932/00-0332-C3FC-C36B-9701-F.
97Sie können auch lesen