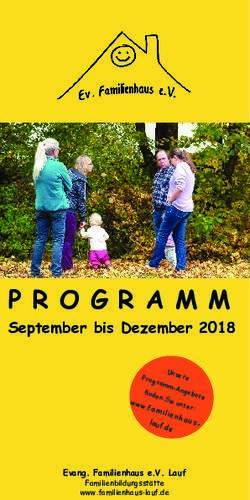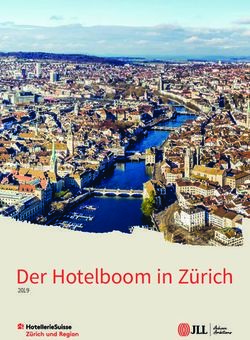Neue Visionen für Reckenfeld - Kinder, Jugend und ihre Treffpunkte - Stadt Greven
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Ein Blick auf das Ganze Landschafts- und Siedlungsstruktur Die Kernfrage Ehemaliges Hauptschulgelände Kinder, Jugend und ihre Treffpunkte Erholung in der Nähe Zukunft mit Rücksicht
Impressum Auftraggeber: Stadt Greven Fachdienst Stadtentwicklung und Umwelt Rathausstr. 6 48268 Greven Ansprechpartner: Dipl.-Ing. Christian Jakop M. Sc. Moritz Pohlmann Bearbeiter: Hochschule Osnabrück Fakultät Agrarwissenschaften und Landschaftsarchitektur Am Krümpel 33 49090 Osnabrück 1. Semester Master Landschaftsarchitektur und Regionalentwicklung Integratives Eingangsprojekt Wintersemester 2013/14 B. Eng. Fenna van Lessen B. Eng. Hendrik Stroth B. Eng. Kristina Zocholl Betreuer: Prof. Dipl.-Ing. Verone Stillger Prof. Dipl.-Ing. Dirk Junker
Inhalt
1 Motivation 6 4 Leitbilder 35
1.1 Jugend und Freiraum 6 4.1 Integrieren 35
1.2 Workshop in Reckenfeld 7 4.2 Aktivieren 35
2 Recherche 8 5 Konzept 36
2.1 Befragung vor Ort 8
2.2 Reckenfeld 2020 10 6 Handlungsempfehlungen 39
2.3 Integriertes Handlungskonzept 11 6.1 Gruppe: Die Kernfrage 39
2.4 Kinder- und Jugendförderplan 12 6.2 Gruppe: Ehemaliges Hauptschulgelände 41
2.5 Fachliteratur zum Thema „Jugend“ 14 6.3 Gruppe Naherholung 43
2.5.1 Bedürfnisse Jugendlicher 14
2.5.2 Fun- und Trendsportarten 15 7 Entwurf 45
2.5.3 Neue Medien in der Stadt 18 7.1 Skatepark im Industriegebiet 45
7.2 Dirtbahn an der Kanalstraße 46
3 Analyse 20 7.3 Grillplatz am Wittlerdamm 48
3.1 Vorgehen 20
3.2 Freizeitangebote und Sportstätten 20 8 Finanzierungsmöglichkeiten 52
3.3 Spielplätze 25 8.1 Spenden und Sponsoren 52
3.4 Bolzplätze 27 8.2 Jugendliche im Stadtquartier, ExWoSt 52
3.5 Offizielle Jugendtreffs 29 8.3 Kinder- und Jugendförderplan 55
3.6 Inoffizielle Treffpunkte 31
3.7 Fazit und Planungshinweise 33 9 Quellenverzeichnis 56
9.1 Abbildungen 58Kinder, Jugend und ihre Treffpunkte
1 Motivation
1.1 Jugend und Freiraum
Bei der Stadt- und Freiraumplanung sind jeder Generation, wie selbstverständlich, bestimmte
Flächen zugeordnet. Sowohl die Bedürfnisse von Kindern, sowie die Bedürfnisse von Erwachse-
nen und Senioren, sind ausführlich erforscht und werden bei Planungen in den Bereichen der
Naherholung oder des Wohnumfelds berücksichtigt (vgl. APPEL; WIENER 2013).
Nur die Generation der Jugendlichen blieb bislang meistens unberücksichtigt. Lediglich Bolz-
plätze werden als Flächen für diese Generation ausgewiesen. Doch Jugendliche brauchen weit
mehr als einen Bolzplatz, um sich selbst zu entfalten und zu erfahren.
Die Zahl der Trendsportarten und sonstigen Aktivitäten von Jugendlichen steigt stetig. Dabei
spielt vor allem der Freiraum eine zentrale Rolle. Durch bewegungsintensive Aktivitäten eignen
sich Jugendlich auch öffentliche Räume in den Ortszentren an.
Abb. 1. Aneignung urbaner Räume
Zu Konflikten mit anderen Generationen kommt es nur dann, wenn die Jugendlichen von den
übrigen Generationen nicht akzeptiert werden und zu wenige Flächen für die Jugendlichen vor-
handen sind. Jugendliche sollten dabei nicht als lästiges Übel angesehen werden, sondern als
eine willkommene Generation, welche die Stadt beleben und bereichern kann (vgl. APPEL; WIE-
NER 2013).
Jugendliche sind innovativ, kreativ und motiviert. Sie wollen sich an Planungen beteiligen und
sind bereit, aktiv an der Umsetzung mitzuarbeiten, weshalb Projekte mit vergleichsweise gerin-
gen finanziellen Mitteln umgesetzt werden können. Voraussetzung dabei ist immer, dass ihre
Wünsche und Bedürfnisse ernstgenommen werden und sie in der Gesellschaft akzeptiert wer-
den (vgl. BMVBS 2013).
„Eine jugendfreundliche Stadt ist eine Stadt mit Zukunft“. (nach APPEL, WIENER 2013)
6Kinder, Jugend und ihre Treffpunkte
1.2 Workshop in Reckenfeld
Vom 9. Oktober bis zum 11. Oktober 2013 fand ein Workshop unter dem Motto „Neue Visionen
für Reckenfeld“ statt. Er war der Auftakt für das Modul „Integratives Eingangsprojekt“ des ers-
ten Semesters des Masterstudeingangs „Landschaftsarchitektur und Regionalentwicklung“ der
Hochschule Osnabrück. Ziel des Workshops war es Defizite und Potenziale in Reckenfeld zu er-
kennen und daraus Arbeitsgruppen und Themen zu formulieren.
Zu Beginn wurden wir in der Grevener Kulturschmiede begrüßt. Direkt im Anschluss fand ein
Rundgang durch Reckenfeld statt.
Per Zufallsverfahren wurden wir in Gruppen eingeteilt und von verschiedenen Bewohnern der
Stadt durch den Ort geführt wurden. Unsere Gruppe begleitete Jessica Bellmann, einer Mitar-
beiterin der Jugendarbeit in Reckenfeld. Während des Rundgangs legten wir unser Augenmerk
besonders auf Spielplätze für Kinder und Treffpunkte für Jugendliche. Wir stellten schon früh
fest, dass es besonders im Bereich der Treffpunkte für Jugendliche Entwicklungsbedarf gibt.
Es sind viele, neue Spielplätze für Kinder und gut erhaltene Bolzplätze für Jugendliche vorhan-
den. Allerdings fehlt es vor allem für Jugendliche an Räumen für andere Nutzungen. Insbeson-
dere überdachte Flächen bestehen nur unzureichend.
Zurück in der Kulturschmiede in Greven wurden alle Eindrücke des Rundgangs gesammelt. Die-
se diskutierten und sortierten wir, so dass sich sieben Themenfelder ergaben, die während des
folgenden Wintersemesters bearbeitet werden sollten. Wir entschieden uns dazu, in der Kons-
tellation des Rundgangs, das Themenfeld: „Kinder, Jugend und ihre Treffpunkte“ zu behandeln,
bei dem ein Schwerpunkt auf das Auswerten und Entwickeln von Freiräumen für Jugendliche
gelegt werden sollte.
Abb. 2. Rundgang mit Mitarbeitern der Jugendarbeit Abb. 3. Zusammenstellen der ersten Ergebnisse
7Kinder, Jugend und ihre Treffpunkte
2 Recherche
2.1 Befragung vor Ort
Eine erste spontane Befragung der Jugendlichen erfolgte bereits direkt an den Tagen des Work-
shops. Von Frau Bellmann erfuhren wir einige Orte, an denen sich die Jugendlichen gerne auf-
halten. So konnten wir einige Jugendliche dort antreffen und direkt einige Fragen stellen und
einen ersten Überblick erhalten, wie die Jugendlichen die Situation vor Ort selber einschätzen
und welche Wünsche und Ideen sie haben.
Mit einer eigens angefertigten Umfrage befragten wird die Jugendlichen einige Tage später
erneut. Durch die gleichen Fragen, die jeder Jugendliche erhielt, entstand ein repräsentatives
Ergebnis.
Der erste Fragenblock umfasste die Fragen nach dem Alter, Geschlecht und dem genauen Wohn-
ort in Reckenfeld. Hierbei ergab sich das Bild, dass sich in den Nachmittagsstunden überwie-
gend Jugendliche im Alter von 12-16 an den entsprechenden Orten versammeln, während diese
in den Abendstunden überwiegend von bereits Volljährigen – oder kurz davor befindlichen jun-
gen Menschen – genutzt werden. In der Übergangszeit vermischt sich das Bild, wodurch viele
Altersstrukturen gleichzeitig vertreten sind. Was sich auch ganz deutlich zeigte, ist, dass sich
die Jugendlichen nicht unbedingt in ihren Blöcken aufhalten, sie treffen sich übergreifend dort,
wo gerade die bevorzugte Nutzungsart am passendsten erscheint. Hauptsächlich angetroffen
wurden bei der Befragung männliche Jugendliche.
Im nächsten Bereich ging es um die Treffpunkte der Jugendlichen. Die Orte, die wir dabei ge-
nannt bekamen bzw. wo wir sie antrafen, sind unter den Punkten 3.3 – 3.6 im weiteren Verlauf
dieser Ausarbeitung beschrieben. Wichtig war bei der Umfrage der Punkt, wie oft sie sich dort
treffen und wie lange sie sich dort aufhalten. Die erste Frage war relativ einfach zu beantworten,
bei gutem Wetter treffen sie sich täglich an ihren Treffpunkten, wobei diese dann auch unter den
Gruppen variieren.
Die Angaben zur Dauer schwankten sehr stark von 15 Minuten bis zu „den ganzen Tag“. Im Mittel
ergab sich ein interpolierter Wert von einer halben bis zu drei Stunden. Aufgrund der Aussagen
von Frau Bellmann, dass in der Vergangenheit häufiger Probleme mit Anwohnern oder anderen
Erwachsenen aufgetreten sind – was auch zur Vertreibung der Jugendlichen von einigen Orten
führte – befragten wir sie auch zu dieser Problematik.
Es zeigte sich, dass derzeit scheinbar keine großen Probleme in dieser Richtung vorherrschen.
Es gab nur vereinzelte Stimmen, dass es Diskussionen mit Erwachsenen oder auch anderen Ju-
8Kinder, Jugend und ihre Treffpunkte
gendgruppen gäbe. Diese entwickeln sich meist aufgrund des von Anwohnern als zu laut emp-
fundenen Lärmpegels.
Ein weiteres Konfliktpotential entstehe durch zurückgelassen Müll, wobei die meisten angetrof-
fen Gruppen sagten, dass sie ihren Müll in den Abfallbehältern entsorgen. Allerdings werden
auch einige ehemalige Treffpunkte aus Angst vor einer Konfrontation überhaupt nicht mehr
aufgesucht.
Die Fragen, die wir den Jugendlichen zu ihrer Mobilität stellten, ergaben ein einfaches und un-
problematisches Bild. Innerhalb Reckenfelds nutzen sie überwiegend das Fahrrad oder Skate-
board bzw. gehen bei kürzeren Wegen der Einfachheit halber zu Fuß.
Die öffentlichen Verkehrsmittel werden im Ort selber kaum genutzt, nur bei Fahrten in anderen
Ortschaften sind diese das häufigste Fortbewegungsmittel. Durch diese Mobilität sind die Ju-
gendlichen auch bereit, jeden Ort innerhalb Reckenfelds aufzusuchen, wenn sich ihnen dort ein
ansprechendes Angebot bietet.
Die offiziellen Jugendtreffs der katholischen und evangelischen Kirche werden von ca. einem
Drittel der Jugendlichen genutzt. Dieses aber eher in unregelmäßigen Abständen. Einige ge-
hen dort so alle 2-3 Wochen hin, einige nur zweimal im Jahr, wenn etwas Besonderes geboten
wird. Die Hausaufgabenhilfe wird dort aber von einigen regelmäßig in Anspruch genommen.
Gewünscht werden hier aber mehr Möglichkeiten, sich unabhängiger von organisierten Spiel-
und Freizeitangeboten im Innenbereich treffen und betätigen zu können.
Bei den Fragen bezüglich der Wünsche ergab sich ein recht einheitliches Bild. Zunächst kamen
von vielen einige nicht erfüllbare Wünsche, wie die eines Kinos, oder Schwimmbades im Ort. Un-
ter Berücksichtigung der finanziellen Möglichkeiten standen bewegungsorientierte Treffpunkte
und solche zum „Abhängen“ und „Chillen“ an erster Stelle. Um sich sportlich zu betätigen, kam
zum einen sehr häufig der Wunsch nach einer Möglichkeit zum Skateboard fahren mit diversen
Kickern und anderen Trick-Objekten.
Derzeit nutzen die Jugendlichen dazu einige Bereiche, die dafür nicht gedacht sind. Und in etwa
genauso häufig wird eine BMX-Bahn und ein Dirt-Park genannt. Auf die Frage, ob sie denn auch
bereit wären an der Gestaltung und Umsetzung dieser Sport-Areale mitzuwirken, bekamen wir
einstimmig positive Antworten. So würden die Jugendlichen die Anlagen selber entwerfen und
auch bauen, nur finanzielle Unterstützung würden sie benötigen. Beinahe ebenso wichtig er-
schien es ihnen, dass es ein oder mehrere Orte geben würde, an denen sie sich einfach nur tref-
fen könnten, um dort zu entspannen oder zu kommunizieren.
Hier ist auch der Kontakt mit anderen Cliquen und verschiedenen Altersgruppen erwünscht.
Als besonders wichtig nannten sie an diesen Orten die Möglichkeit, sich auch bei schlechtem
Wetter dort aufhalten zu können, also ein Unterstand oder etwas Ähnliches sei wünschenswert.
9Kinder, Jugend und ihre Treffpunkte
Alles in allem zeigte sich, dass die Jugendlichen gerne Orte nur für sich hätten, an denen sie sich
sportlich betätigen oder in Gruppen aufhalten können und dass sie durchaus bereit sind, an der
Umsetung mitzuarbeiten.
2.2 Reckenfeld 2020
Die Jugend betreffende Informationen aus der Abschluss Dokumentation des Projekts „Recken-
feld 2020“ (vgl. STADT GREVEN (b) 2013):
Das Projekt „Reckenfeld 2020“ startete im Jahr 2009. Ziel war es das vorhandene bürgerliche
Engagement zu fördern und zu unterstützen und weitere, noch nicht aktive Bürger, in die Pla-
nungsprozesse zu integrieren. Daraus soll ein harmonisches Zusammenleben aller Generatio-
nen wachsen.
Während einer ersten Bestandsaufnahme fiel die gute Betreuungssituation für Kinder auf, aber
auch ein mangelndes Freizeitangebot für Kinder und Jugendliche. So wurde als Projektziel der
ersten Priorität die Entwicklung von Beteiligungsformen für ältere Kinder und Jugendliche an-
geregt.
Bei der Auftaktveranstaltung am 16. Januar 2012 kam dementsprechend der Vorschlag zur Er-
richtung einer Skateanlage für Jugendliche. Dieser Vorschlag wurde zwar an die Jugendarbeit
in Reckenfeld weitergeleitet, eine Arbeitsgruppe bildete sich daraus jedoch nicht, so dass keine
Umsetzung dieses Wunsches in die Realität erfolgte.
Im Oktober 2012 wurden die ersten Ergebnisse und Meinungen zum Projektablauf zusammen-
getragen. An der Veranstaltung nahmen ca. 25 Bürger teil. Es ist hierbei die produktive Mitarbeit
der Jugendlichen an der Planungswerkstatt zum Integrierten Handlungskonzept Ortsmitte Re-
ckenfeld erwähnt worden. Trotzdem musste abschließend festgehalten werden, dass es weiter-
hin starke Defizite im Bereich der Freizeitangebote für Jugendliche gibt und in diesem Bereich
keine positive Entwicklung stattfand.
Folglich konnte auch das ursprüngliche Ziel einer Beteiligung von Kindern und Jugendlichen
nicht erreicht werden. Punktuell haben sich zwar einige Jugendliche beteiligt, aber ein Konzept
für die Kinder- und Jugendbeteiligung konnte nicht erstellt werden. Als Gründe wurden hier die
mangelnden Personalkapazitäten und die eingeschränkten finanziellen Mittel genannt.
10Kinder, Jugend und ihre Treffpunkte
2.3 Integriertes Handlungskonzept
Die Jugend betreffende Informationen aus dem Integriertem Handlungskonzept zur Ortsmitte
Reckenfeld (vgl. STADT GREVEN (a) 2013):
Im Verlauf des Projektes „Reckenfeld 2020“ wurde die Erstellung eines Integrierten Handlungs-
konzepts für die Ortsmitte in Reckenfeld angeregt. Dieses wurde im Sommer 2013 fertiggestellt.
Das IHK enthält eine umfassende Analyse und zeigt sowohl Stärken als auch Schwächen der
Ortmitte auf. Basierend auf diesen Ergebnissen wurden einzelne Maßnahmen benannt, die die
Qualität der Ortsmitte verbessern sollen.
In Reckenfeld leben ca. 22% der Gesamteinwohnerzahl von Greven. Dabei liegt der durchschnitt-
liche Altersdurchschnitt der Reckenfelder Bevölkerung leicht unter dem Grevener Durchschnitt.
20,8 % der Reckenfelder sind unter 18 Jahren.
Es wird festgehalten, dass in der Ortsmitte nur sehr eingeschränkte Spiel- und Aufenthaltsbe-
reiche für Kinder und Jugendliche zur Verfügung stehen. Die Anordnung der Spielgeräte auf
dem Marktplatz wird als mangelhaft beschrieben. Sie behindert die Interaktion der spielenden
Kinder. Zudem richten sie sich in ihrer Nutzung nur an Kinder unter sechs Jahren.
In der Ortsmitte sind zu wenig Flächen für Kinder und Jugendliche ausgewiesen. Dies führt
dazu, dass sie sich andere Flächen aneignen, was wiederum zu Nutzungskonflikten mit anderen
Altersgruppen führt. Es wird daher die Errichtung eines Mehrgenerationen-Parks angeregt, in
dem auch Angebote für Kinder und Jugendliche integriert werden sollen.
Die von den Jugendlichen gewünschte BMX-Strecke oder der Skatepark sollen hingegen, auf-
grund der Lärmbelästigung für Anwohner, am Stadtrand realisiert werden. Diesen Wunsch
äußerten die Jugendlichen während der Planungswerkstatt im Zuge des Projekts „Reckenfeld
2020“. Des Weiteren bemängelten sie die kleinen Räumlichkeiten im Pfarrheim St. Franziskus
und den Wegfall des Tanzraums im alten Hauptschulgebäude.
Weitere Wünsche waren Aufenthaltsbereiche in der Ortsmitte und eine Wand zum legalen
Sprayen.
11Kinder, Jugend und ihre Treffpunkte
2.4 Kinder- und Jugendförderplan Greven 2010-2014
Informationen aus dem Kinder- und Jugendförderplan der Stadt Greven (vgl. STADT GREVEN
2010):
Der kommunale Kinder- und Jugendförderplan wird jeweils für die Dauer einer Ratsperiode
durch den Jugendhilfeausschuss bewilligt. Hiermit werden inhaltliche Schwerpunkte und eine
verlässliche Finanzierung geregelt, die auf den Bedarf von Kindern und Jugendlichen ausgerich-
tet ist. In erster Linie werden Maßnahmen und Angebote für Kinder und Jugendliche zwischen
6 und 21 Jahren entwickelt.
Dem Förderplan liegen eine ausführliche Analyse und ein Fragebogen der Kinder und Jugend-
lichen zugrunde, aus denen die Maßnahmen und Angebote, angepasst an die Bedürfnisse der
Jugendlichen, hervorgehen.
Für die weitere Herangehensweise an unser Thema „Kinder, Jugend und ihre Treffpunkte“ haben
wir die für uns relevanten Informationen hieraus zusammengefasst.
Laut dem Stand vom 01.01.2008 leben In Reckenfeld 2.294 Kinder und Jugendliche im Alter von
6 – 27 Jahren. Die Altersstruktur in Greven setzt sich wie folgt zusammen:
Abb. 4. Altersgruppen
Die vorhandenen Räumlichkeiten für die Jugendlichen werden als ausreichend und adäquat
ausgestattet beschrieben, jedoch mangelt es insgesamt an der Anzahl. Weiterhin wird ange-
führt, dass meist eine strenge Raumordnung herrscht, dass Veranstaltungsräume sowie Lager-
flächen fehlen und die Bestandstreffpunkte sich oftmals in einem sanierungsbedürftigen Zu-
stand befinden.
Aus der nachfolgenden Tabelle lässt sich ableiten, dass das Interesse der Kinder und Jugendli-
chen an der geleiteten Kinder- und Jugendarbeit mit dem Älterwerden stetig abnimmt.
Abb. 5. Altersgruppen in der
Kinder- und Jugendarbeit
12Kinder, Jugend und ihre Treffpunkte
Besonders aktiv im Stadtteil ist die „Kinder- und Jugendarbeit Reckenfeld“, die nicht nur jun-
ge Leute im Allgemeinen, sondern auch viele sozial benachteiligte Kinder bzw. über 40 % der
Kinder mit Migrationshintergrund erreicht. Die Jugendarbeit bietet offene wöchentliche Spiel-
platzangebote für Kinder und weitere erlebnispädagogische Angebote für alle Altergruppen.
Zusätzlich versucht sie durch ihre mobile Jugendarbeit (Streetwork, Beteiligungsprojekte und
Jugendkultur) ebenso die Jugendlichen vor Ort an ihren Treffpunkten zu erreichen.
Im Förderplan werden einige der dringendsten Probleme wie folgt beschrieben: Aufgrund von
Nachbarschaftsproblemen sind einige Treffpunkte nur noch eingeschränkt nutzbar, Jugendliche
haben keine hohe Bindungsidentifikation an Vereine, darum müssen auch an den Wochenen-
den mehr unabhängige Angebote bereitgestellt werden.
Damit auch die Meinungen und Wünsche der Kinder und Jugendlichen im Förderplan vertre-
ten sind, wurde im Jahr 2008 eine Umfrage mit ihnen in Gesamt-Greven durchgeführt. Von ins-
gesamt 2.193 Fragebögen wurden 54,4 % beantwortet. Von den Antwortbögen kamen 22 %
aus Reckenfeld. Betrachtet man, dass der Reckenfelder Bevölkerungsanteil 23 % beträgt, ist der
Beteiligungsgrad der Reckenfelder Jugend beachtlich. Die Fragen bezogen sich auf den Wohn-
ort, das Freizeitverhalten und ihre Interessen und Wünsche. Das Ergebnis zeigte, dass sich das
Freizeitverhalten der Kinder und Jugendlichen überwiegend im privaten Bereich abspielt und
für einige Aktivitäten in Gruppen öffentliche Bereiche aufgesucht werden. Nach eigener Ein-
schätzung verfügen die Jugendlichen über ausreichend Zeit, die sie frei nutzen können. Die Be-
urteilung des Freizeitangebotes fiel sehr unterschiedlich aus. Ausgewertet worden sind die drei
Altersgruppen von 11-18. Es zeigte sich, dass mit steigendem Alter der Befragten, das Angebot
schlechter wahrgenommen wurde.
61 % der Befragten gaben an, dass sie in einem Verein, Verband oder Kirchengemeinde tätig
sind. Bei den Verbesserungswünschen stehen größere Projekte wie ein Kino oder Einkaufszen-
tren an vorderster Stelle. Auf Aussagen wie „keine Ahnung“ oder „alles fehlt“ geht der Jugend-
förderplan leider nicht weiter ein, sondern interpretiert solche Aussagen völlig falsch dahinge-
hend, dass die Jugend keine Wünsche hätte, die über das bestehende Angebot hinausgehen.
Eine geringe Zahl nannte auch einen Park zum Chillen und Spazierengehen, diese Zahl erscheint
relativ niedrig, aber Plätze zum Chillen erwarten die Jugendlichen ohnehin und nicht unbedingt
als angelegtes Gelände. Bei der Abschlussfrage, ob sie noch etwas loswerden möchten, stand
der Wunsch nach mehr Treffpunkten plötzlich schon an dritter Stelle, nach Kino und diversen
Freizeitangeboten.
Die künftigen Förderschwerpunkte der Stadt Greven unterliegen den verfügbaren Haushalts-
mitteln und beziehen sich schwerpunktmäßig auf die Angebote der offenen Kinder- und Ju-
gendarbeit, den Betriebskosten und der Jugendverbandsarbeit. Zudem sollen künftig Beteili-
gungsprojekte, stadtteilorientierte Projekte und Kooperationsprojekte von Jugendarbeit und
Schulen ausgebaut werden. Die Jugendarbeit Reckenfeld erhält dazu 105.000 €.
13Kinder, Jugend und ihre Treffpunkte
2.5 Fachliteratur zum Thema „Jugend“
2.5.1 Bedürfnisse Jugendlicher
Jugend – das ist die Generation zwischen dem 13. und dem 25. Lebensjahr. Sie sind weder Kin-
der noch sind sie erwachsen. Sie befinden sich in einer komplexen Selbstfindungsphase und
vollziehen gerade den Prozess des „Erwachsenwerdens“ (vgl. BMVBS 2013).
Bisher wurden ihre Bedürfnisse und Wünsche in Planungen oft unberücksichtigt gelassen. Dabei
hat gerade die Jugend eine Vielzahl an unterschiedlichen Ansprüchen an ihre Treffpunkte.
Ein erster wichtiger Punkt ist, dass diese Treffpunkte keine Einschränkungen in ihrer Nutzung
haben dürfen. Sie müssen gut erreichbar sein, da die Jugendlichen zumeist nur auf öffentli-
che Verkehrsmittel und das Fahrrad zurückgreifen können. Zudem haben Jugendliche nur ein
begrenztes finanzielles Budget, weswegen die Nutzung dieser Orte nach Möglichkeiten keine
Kosten verursachen darf. Aufgrund der Aktivitäten in der Schule und ihrer Hobbys sind Jugend-
liche einem vorgegebenen Zeitplan unterworfen, weswegen sie es in ihrer Freizeit vorziehen,
sich spontan und zu selbstbestimmten Zeiten zu treffen. Daher ist das Schaffen von Räumen die
nicht durch Öffnungszeiten begrenzt sind wichtig (vgl. PETER 2013).
In diesem Zusammenhang treten besonders die öffentlichen Freiräume in den Vordergrund. Da-
bei soll ein Angebot von verschiedenen Flächen mit unterschiedlichen Aktivitäten und Möglich-
keiten bereitgestellt werden, um Nutzungskonflikte zu vermeiden.
Die drei Hauptnutzungen von Jugendlichen sind die kommunikationsbetonte, die ruhebetonte
und die bewegungsbetonte Nutzung. In Räumen der kommunikationsbetonten Nutzung ist das
Miteinanderunterhalten die vorherrschende Aktivität der Jugendlichen. Ruhebetonte Räume
dienen allein der Erholung. Hier spielen vor allem Kommunikationsmedien, wie das Smartpho-
ne eine große Rolle. Räume mit bewegungsbetonter Nutzung dienen wiederum dem Sport und
Spiel und der Ausübung von Trendsportarten. Dabei ist zu beobachten, je älter die Jugendlichen
werden, desto eher nutzen sie Räume für kommunikations- und ruhebetonte Nutzungen, statt
der Räume für bewegungsbetonte Nutzungen (vgl. HERLYN U.A. 2003) .
Hinzu kommt, dass Jugendliche zum einen Räume zur Selbsterfahrung und Selbstentfaltung be-
nötigen, in denen sie unter sich sind und nicht der Kontrolle von Erwachsenen unterstehen, aber
zum anderen auch aktiv Räume im Ortszentrum aufsuchen. Diese öffentlichen Räume, meist in
den Zentren, dienen der Repräsentation und Darstellung, dem „Sehen und Gesehen“ werden.
Um den Identitätsfindungsprozess der Jugend zu unterstützen, brauchen sie den Kontakt zu
anderen Altersgruppen, insbesondere den Erwachsenen. Sie müssen sich intensiv mit der Welt
der Erwachsenen beschäftigen, um die Entwicklung vom Jugendalter zum Erwachsensein zu
vollziehen (vgl. HERLYN U.A. 2003).
14Kinder, Jugend und ihre Treffpunkte
2.5.2 Relevante Fun- und Trendsportarten für Jugendliche in der Stadt
Fun- und Trendsportarten spielen seit jeher eine bedeutende Rolle für Jugendliche, wenn auch
die Begriffe eher neu sind. Sie bieten den Jugendlichen eine Möglichkeit zur körperlichen Be-
tätigung abseits der konventionellen Sportarten, welche die meisten Vereine bieten und lassen
den Spaßfaktor nicht außen vor.
Laut dem Duden lassen sich die Begriffe des Fun- und Trendsports wie folgt definieren. Der
Funsport wird als ein „unkonventioneller Sport, bei dem das Vergnügen im Vordergrund steht“
(DUDEN.de 2013, a) angesehen und steht damit dem eher leistungs- und ergebnisorientierten
Vereinssport gegenüber. Der Trendsport wird als eine „neue, noch nicht etablierte und zuneh-
mend beliebte Sportart“ (DUDEN.de 2013, b) bezeichnet. Daraus lässt sich ableiten, dass diese
beiden Begriffe eng miteinander verknüpft sind und aus einer Trendsportart bei steigendem
Interesse eine Funsportart wird.
Die Liste der Fun- und Trendsportarten ist lang und es kommen laufend neue Ideen auf den
Markt. Doch nicht alle Sportarten eignen sich auch zur Ausübung in der Stadt. Hier wird eine
Auswahl an möglichen Sportarten aufgezählt, die von Jugendlichen – ohne Beeinträchtigung
anderer – auch problemlos in einer Stadt ausgeübt werden können.
Le Parkour – ist seit einigen Jahren auch in Deutschland ein zur Mode gewordener Trendsport,
der ohne zusätzliche Hilfsmittel ausgeübt wird. Die Suche nach dem Ursprung dieses Trends
führt einen zurück in die frühen 80er Jahre Frankreichs, wo er durch den Franzosen David Belle
geprägt wurde. Hierbei bewegen sich die Akteure zu Fuß durch den urbanen oder natürlichen
Raum auf der Suche nach Hindernissen, die es zu überwinden gilt. Als Hindernisse dienen Mau-
ern, Treppen, Zäune und vieles mehr, eben alles was sich dem Parkourläufer, auch Traceur ge-
nannt, in den Weg stellt. Jedes Hindernis wird dabei durch Klettern, Springen oder Balancieren
mittels der eigenen Muskelkraft bewältigt. Für Jugendliche bietet dieser Trend eine willkomme-
ne Herausforderung sich in Geschick, Körperbeherrschung und Selbsteinschätzung zu beweisen
und gleichzeitig ihren Körper zu trainieren und zu präsentieren. (vgl. PARKOUR GERMANY 2009)
Slacklining – hierbei dient eine Art Spanngurt - die sogenannte Slackline - welche zwischen
zwei Befestigungspunkten gespannt wird, als Balancierseil, auf der Tricks ausgeführt werden.
Das Wort Slackline stammt aus dem Englischen und bedeutet soviel wie lockere Leine (vgl. DU-
DEN 2013, c). Als Befestigungspunkte werden meist zwei Bäume genutzt, die idealerweise mit
Manschetten vor Schäden und Verletzungen geschützt werden. Ziel dieser Sportart ist es zum
einen, den Gleichgewichtssinn zu schärfen. Zu Beginn fällt es sehr schwer, den schwingenden
Gurt ruhig zu halten. Zum anderen geht es aber auch darum, verschiedene Figuren und Tricks
auf dem Seil und von ihm herab auszuführen. Dazu gehört das Laufen, Drehen, Springen, Surfen
und Sitzen, um nur einige zu nennen. (vgl. SLACKLINER-BERLIN.de o.J.)
15Kinder, Jugend und ihre Treffpunkte
Skaten – das Skaten dient einigen Sportarten als Begriff, hier geht es um das Skateboardfahren.
Dieses ist sicherlich schon lange keine Trendsportart mehr, wurde es doch auch bereits Ende der
1950er erfunden. Spätestens seit es auch hier um Erfolge und viel Geld geht, hat sich das Skaten
als Sportart etabliert. Es hat sich aber dennoch immer auch seinen Fun-Faktor erhalten und ge-
hört darum nach wie vor in diesen Bereich.
Das Beherrschen des Skateboards – in Perfektion die Ausübung vieler verschiedener und mög-
lichst schwieriger Tricks – ist dabei die große Herausforderung. Die Präsentation dieser Tricks er-
folgt am liebsten dort, wo die Aktiven auch beobachtet werden können. Sie selber nennen diese
Orte „Spots“. Das können Orte im öffentlichen Raum oder Skate-Hallen bzw. Skate-Parks sein.
Ganz wichtig beim Skaten ist auch der zugehörige Lifestyle, der sich durch bestimmte Kleidung
und Musik ausdrückt. Ein besonderer Reiz ist die Aneignung urbaner Räume, das Präsentieren
gehört für die Skater einfach dazu. (vgl. JUGENDSZENEN.com o.J.)
Abb. 6. Le Parkour Abb. 7. Slackline Abb. 8. Skateboard
BMX – bedeutet Bicycle Moto Cross. Auch wenn der Name anderes vermuten lässt, kommt hier-
bei kein Motor zum Einsatz. Entstanden ist die Sportart einhergehend mit der Erfindung des
passenden Fahrrades – das BMX Rad. Es fällt durch seinen niedrigen Rahmen und seine kleinen,
grobstolligen Reifen auf. Genutzt wird das BMX Rad für zwei grundverschiedene Disziplinen.
Bei der ersten werden verschiedene Tricks und Stunts ausgeführt, dieses häufig in langsamer
und eleganter Form. Die Räder, die hierfür genutzt werden, fallen durch ihre Fußrasten an den
beiden Naben auf.
Die zweite Disziplin, die dem Rad ihren Namen gab ähnelt den Motocross-Rennen mit Motorrä-
dern, daher auch der Name Bicycle Moto Cross. Auf einem Sandkurs mit Sprüngen und Steilkur-
ven treten mehrere Fahrer gegeneinander an um als erster das Ziel zu erreichen. Körperkontakt
ist bei den Rennen durchaus üblich und erlaubt. Diese Disziplin ist mittlerweile sogar olympisch,
gilt aber dennoch weiterhin als „cool“ – auch unter den Jugendlichen. (vgl. BIERSCHWALE 2012)
Dirt-Bike – steht für das elegante und trickreiche Überwinden von Hindernissen. Das Dirt-Bike
siedelt sich von seinem Aufbau und der Größe zwischen dem BMX Rad und dem Mountainbike
an. Im Gegensatz zu den beiden anderen Rädern ist es aber ein reines „Trick-Fahrrad“. Auch hier
gibt es wieder zwei verschiedene Disziplinen. Bei der älteren Disziplin ist ein Hindernisparcours
16Kinder, Jugend und ihre Treffpunkte
zu bewältigen, dabei wird dem Fahrer insbesondere ein hohes Gleichgewichtsvermögen ab-
verlangt, da jedes Absetzen eines Fußes Strafpunkte nach sich zieht. Bei der jüngeren Disziplin,
welche auch im Verlauf dieser Ausarbeitung weiterverfolgt wird, stehen spektakuläre Tricks und
artistische Sprünge im Vordergrund. Absolviert werden diese in einem sogenannten Dirt-Park.
In diesem stehen verschieden große Rampen, durch die Fahrer sich in die Luft katapultieren und
anschließend einen Trick vorführen. (vgl. wikipedia.org 2014)
Discgolf – wie der Name schon verrät, bildet dieser Sport eine Kombination aus Frisbee- und
Golfspielen. Der Sport entstand während der 1970er Jahre in den USA und kam Ende des glei-
chen Jahrzehnts auch nach Deutschland.
Ziel des Spiels ist es mit möglichst wenigen Würfen eine Frisbeescheibe in einen Fangkorb zu
befördern. Die Regeln sind hierbei ähnlich denen des klassischen Golfspiels, auch wird oftmals
ein Kurs von 18 Bahnen gespielt. Um diesen Sport ausüben zu können, bedarf es aber nicht un-
bedingt eines fest installierten Rundkurses, es lässt sich auch mit nur wenigen Anschaffungen
und etwas Improvisation ein interessantes Spiel gestalten. Eine Grundausstattung mit den drei
unterschiedlichen Wurfscheiben, Driver als Weitwurfscheibe, Midrage als Annäherungsscheibe
und Putter für den Zielwurf, lassen sich schon kostengünstig erwerben. Diese Sportart ist für
alle Altersgruppe geeignet und lässt sich prinzipiell im Freien überall dort, wo es keine anderen
Personen gefährdet, spielen. (vgl. DISCGOLF.de 2014, PRODUKTORAMA.de 2014)
Abb. 9. BMX Fahrer Abb. 10. Dirtpark Abb. 11. Discgolf
17Kinder, Jugend und ihre Treffpunkte
2.5.3 Neue Medien in der Stadt
Neue Medien in der Stadt – was bedeutet das eigentlich? Internet, Handy, Smartphone, W-Lan,
Hot-Spot, QR-Code sind nur einige der Begriffe, die in diesem Zusammenhang immer wieder
auftauchen. Die neuen Medien sind größtenteils eigentlich gar nicht neu und werden auch von
einem Großteil der Bevölkerung jeder Altersstruktur mehr oder minder genutzt. So besitzen
mehr als ein Drittel der deutschen Bundesbürger zwei oder mehr Mobilfunk Anschlüsse und
insgesamt gab es Ende 2011 mehr als 112 Millionen Anschlüsse (vgl. AFP 2012) .Dabei steigt
die Verbreitung der Smartphones, ebenso rasant an, wie die der Tablet-PCs, die dazu konzipiert
sind, in der einen Hand gehalten und mit der anderen Hand bedient zu werden.
Dies führt auch in der Stadtplanung gleich zu zwei wesentlichen Umständen, die immer stärker
beachtet werden müssen. Zum einen sind diese Gerätekategorien so angelegt, dass ein ständig
vorhandener Internetdienst benötigt wird. Das bedeutet, dass der Ausbau der Netztstruktur und
die Zugriffsmöglichkeiten für jeden Menschen immer weiter vorangetrieben werden und die
städtebaulichen Möglichkeiten dafür geschaffen werden müssen. Zum anderen führt es aber
auch dazu, dass der Mensch immer unaufmerksamer durch die Stadt läuft und daher einige
Punkte beachtetet werden müssen, um einerseits seine Aufmerksamkeit für die Gegebenheiten
vor Ort wieder zu erlangen und andererseits seine Gesundheit zu schützen, damit die Unauf-
merksamkeit nicht zu Verletzungen führt. Dieser Punkt der städtebaulichen Planung soll aber in
dieser Ausarbeitung nicht weiter vertieft werden, da ja vornehmlich die Treffpunkte der Jugend-
lichen im Vordergrund stehen.
Die räumlichen Wirkungen dieser ständigen Verfügbarkeit der digitalen Welt führen zu einer
veränderten Wahrnehmung. „Entfernungen verlieren an Bedeutung und nahe Orte erscheinen
häufig weiter entfernt als fern gelegene“ (FLOETING 2002). So kommunizieren speziell Jugend-
liche häufig virtuell miteinander, obwohl sie sich am selben Ort – teilweise nur wenige Meter
voneinander entfernt – befinden. Andererseits bietet der Raum im Internet die Möglichkeit, mit
anderen in Kontakt zu treten, die sich weiter von einem weg befinden. Diese beiden Punkte kön-
nen dazu genutzt werden, Orte zu schaffen, die auch für Jugendliche attraktiv sind oder dazu,
diese attraktiver zu gestalten.
Das Thema Hot-Spot oder flächendeckendes W-LAN ist fast schon ein alter Hut, setzt sich in
Deutschland aber nicht durch. Orte, an denen es ein freies W-LAN gibt, sind noch nicht sehr
verbreitet. Dabei bietet sich durch die Bereitstellung eines solchen Zugangs auch im Freien die
Möglichkeit, einen Treffpunkt zu schaffen, der alleine schon aufgrund dieses technischen Hilfs-
mittels angenommen wird. Im weiteren Verlauf dieser Ausarbeitung werden Plätze und Orte
vorgestellt, an denen sich eine Aufwertung für Jugendliche lohnt. An diesen Orten würde es sich
auch anbieten, ein W-LAN zur Verfügung zu stellen, wie z.B. der unter Punkt 7.3 umgestaltete
Grillplatz am Wittlerdamm.
18Kinder, Jugend und ihre Treffpunkte
Ein weiteres Element der digitalen Vernetzung, welches in jüngster Vergangenheit zunehmend
an Bedeutung gewinnt, sind die sogenannten QR-Codes. QR steht hierbei für quick response =
schnelle Antwort. Die QR-Codes sind kleine schwarz-weiße Bilder, auf denen nur ein scheinbar
sinnloses Muster zu erkennen ist. Aber in ihnen steckt weit mehr, als es zunächst den Anschein
hat. Mit einem Smartphone können der Code abfotografiert und die gespeicherten Informatio-
nen aufgerufen, abgespeichert und weiterverarbeitet werden. (vgl. WILKOHARTZ.de 2013) Die
QR-Codes müssen nicht größer als eine Briefmarke sein, können so also auch vielerorts ange-
bracht werden, ohne dass sie besonders störend wirken. Die Einsatzmöglichkeiten sind wieder-
rum alles andere als unscheinbar und gering.
So bietet sich die Möglichkeit, einfache Information über den Standort zu erhalten, oder auch
weitergehende Informationen wie Öffnungszeiten, Marktzeiten, Baustellen usw. Weiter bietet
sich in Verbindung mit den Jugendlichen an, dass die Jugendclubs und auch die Vereine in stän-
dig aktualisierter Form ihre Angebote und besondere Veranstaltungen öffentlich machen. Auch
kann den Jugendlichen so überhaupt erstmal der Zugang zu und die Kenntnis über die Treff-
punkte und Sportmöglichkeiten gegeben werden. Über verschiedene kleine Programme, die
sogenannten Apps, bietet sich auch die Möglichkeit, dass sich die einzelnen Gruppen vernetzen
und so immer darüber informiert sind, wo sich ihre Freunde aufhalten – sofern diese das wün-
schen.
Diese beiden Elemente der neuen Medien erfordern keinen besonders hohen Aufwand und
auch keine hohen Finanzmittel. Das Ergebnis wäre aber hilfreich für die Jugendlichen und auch
der Umgang mit Ihnen bzw. die Kommunikation wäre einfacher und verständlicher, ihre Welt ist
bereits sehr digital organisiert.
Abb. 12. Wi-Fi Zone Abb. 13. QR-Code
19Kinder, Jugend und ihre Treffpunkte
3 Analyse
3.1 Vorgehen
Die Analyse soll Auskunft über die derzeitige Situation von Kinder- und Jugendtreffpunkten in
Reckenfeld geben. In einem ersten Kapitel wird ein Überblick über die offiziellen Sportstätten
und die in Reckenfeld ansässigen Vereine gegeben.
Des Weiteren sind alle Spiel- und Bolzplätze verortet und bewertet.
Zusätzlich werden die verschiedenen Treffpunkte der Jugendlichen dargestellt. Diese werden
unterschieden nach offiziellen Treffpunkten und inoffiziellen Treffpunkten. Offizielle Treffpunk-
te sind in diesem Zusammenhang die Orte, die speziell für den Aufenthalt von Jugendlichen
ausgewiesen sind, während inoffizielle Treffpunkte die Orte sind, an denen sich die Jugendli-
chen sonst aufhalten, ohne dass diese als Flächen für die Jugend gekennzeichnet sind.
Aus den daraus resultierenden Ergebnissen wird ein Leitbild entwickelt, welches als Grundlage
für die weiteren Planungen dient.
3.2 Freizeitangebote und Sportstätten
Im Verhältnis zu der Einwohnerzahl von ca. 8.000 gibt es in Reckenfeld ein umfangreiches Ange-
bot an Vereinen. Auffällig ist, dass sich viele Angebote an ältere Erwachsene und Senioren rich-
ten. Blasorchester, Chöre und Spielmannszüge werden eher selten von Jugendlichen präferiert,
diese bevorzugen eher bewegungsbetonte Freizeitaktivitäten (vgl. STADT GREVEN 2004).
Hier sind der SC Reckenfeld und der Tennisclub Grün-Weiß Reckenfeld besonders zu erwähnen.
Der SC Reckenfeld bietet ein umfassendes Sportangebot an, zu dem zum Beispiel Badminton,
Fußball, Handball, Volleyball und Turnen gehört. Der Jahresbeitrag für Jugendliche variiert da-
bei je nach Sportart zwischen 60 und 66 Euro.
Der Tennisclub Grün-Weiß Reckenfeld bietet Tennis an und verlangt einen Jahresbeitrag von 36
Euro für Jugendliche. Der finanzielle Aufwand für Jugendliche pro Monat beträgt, vorausgesetzt
sie üben nur eine Sportart aus, zwischen 3 und 5,50 Euro, welches ein angemessener Preis ist.
Allerdings haben Vereine zumeist vorgegebene Trainingszeiten, welche sie für manche Jugend-
liche wiederum unattraktiv machen und nicht den selbstbestimmten Aufenthalt im Freiraum
ersetzen können.
20Kinder, Jugend und ihre Treffpunkte
Kultur
Reckenfelder Karnevalsgesellschaft e.V.
Karnevalsgesellschaft Ka-Ki V
Münsterländische Freilichtbühne Greven-Reckenfeld e.V.
Amateur Blasorchester 1986
Reckenfelder Blasorchester e.V.
Posauenenchor Reckenfeld
RBO-Kids
Schützenbruderschaft St. Hubertus Reckenfeld 1951 e.V.
Spielmannszug Eintracht Reckenfeld 1928 e.V.
Mädchen- und Frauenchor Reckenfeld
Männerchor Liedertafel Reckenfeld
Ev. Kirchenchor Reckenfeld
Kath. Kirchenchor Reckenfeld
ARGE, Kultur- und Sporttreibende Vereine Reckenfeld
Reckenfelder Treff
Kath. Bildungswerk Reckenfeld
Abb. 14. Blaskapelle Abb. 15. Chor Abb. 16. Indiaca-Mannschaft
Sport
Spielvereinigung Rot-Weiß Reckenfeld e.V.
Tennisclub Grün-Weiß Reckenfeld e.V. 1971
Schachfreunde Reckenfeld
Behindertensportgemeinschaft Reckenfeld
SC Reckenfeld
Sonstiges
Verein für Deutsche Schäferhunde e.V. Greven-Reckenfeld
Freiw. Feuerwehr, Löschzug Reckenfeld
21Kinder, Jugend und ihre Treffpunkte
Verortung der Sportstätten
1.
Block A 2b.
2a.
Ortsmitte
Block B
1. Tennisanlage
- Tennisfelder 3.
- Einfeldhalle 4.
2. Sportanlage an der Hauptschule Block C
2a. - 1-fach-Sporthalle
2b. - Rasensportplatz
- Tennensportplatz
3. Sportanlage am Wittlerdamm Block D
- Rasensportplatz
- Funsportmöglichkeiten
4. Sportanlage an der Grundschule
- 2-fach-Sporthalle Abb. 17. Luftbild – Sportanlagen
22Kinder, Jugend und ihre Treffpunkte
Sportstätten
Der Tennisclub Grün-Weiß Reckenfeld e.V. 1971 trainiert auf der Tennisanlage im Norden der
Stadt, in der Nähe der Freiluftbühne. Hier gibt es mehrere Tennisplätze im Außenbereich, sowie
einen Platz im Innenbereich. Die Plätze können auch von privaten Personen angemietet und
genutzt werden.
Des Weiteren gibt es in der Mitte der Stadt, an der Hauptschule, eine 1-fach Sporthalle, einen
Rasensportplatz und einen Tennenplatz. Dieser Bereich ist nicht freizugänglich und wird haupt-
sächlich vom SC Reckenfeld genutzt.
Ob und inwieweit diese Sportanlage, im Zuge neuer Planungen, erhalten bleibt, ist noch nicht
endgültig geklärt.
Am Wittlerdamm, an der Grundschule, befindet sich eine 2-fach Sporthalle, in der zum einen der
Schulsport stattfindet, zum anderen aber auch Sportclubs ihr Programm anbieten.
Ebenfalls am Wittlerdamm befindet sich ein neu angelegter Rasensportplatz mit Funsportmög-
lichkeiten zum beispielsweise Beachvolleyball oder Indiaca spielen. Auch dieser Bereich ist, wie
die Sportanlage an der Hauptschule, eingezäunt und nicht jederzeit nutzbar (vgl. STADT GRE-
VEN 2004).
Abb. 18. Tennisanlage Abb. 19. Sportplatz am Wittlerdamm Abb. 20. 2-fach-Sporthalle an der Grundschule
Abb. 21. Sportplatz an der Hauptschule Abb. 22. 1-fach-Sporthalle an der Hauptschule
23Kinder, Jugend und ihre Treffpunkte
Verortung der Spielplätze
3. 6.
Block A
2. 4.
1.
5.
Ortsmitte
Block B
7.
8.
Block C
9.
1. Birkenweg
2. Goethestraße
3. Lothar-Fabian-Weg
4. Emsdettener Landstraße Block D
5. Pfarrer-Müller-Straße
6. Schienenweg
7. Schwester-Dora-Straße
8. Elbestraße
9. Kanalstraße Abb. 23. Luftbild – Spielplätze
24Kinder, Jugend und ihre Treffpunkte
3.3 Spielplätze
In Reckenfeld gibt es derzeit neun Spielplätze, die hauptsächlich an den Bewegungsdrang der
6-14 Jahre alten Schulkinder angepasst sind, aber auch einzelne Angebote für Kleinkinder unter
6 Jahren bieten. Folglich haben diese auch eine Altersbeschränkung bis 14 Jahren.
Die Spielplätze sind in einem guten bis sehr guten Zustand und werden regelmäßig gepflegt.
Alle Spielplätze liegen in Wohngebieten und sind nahezu gefahrenfrei von den Kindern zu er-
reichen.
Lediglich der Spielplatz an der Kanalstraße weißt mit seiner abgeschieden Lage und der direkt
angrenzenden, für den Durchgangsverkehr genutzten Straße, ein Risiko für Kinder auf. Hier ist
es in jedem Fall nötig, dass die Kinder von älteren Begleitpersonen hingebracht und beaufsich-
tigt werden.
Auch der Spielplatz an der Hauptschule birgt ein Gefahrenpotential mit seiner Lage an der
Emsdettener Landstraße. Beide Spielplätze sind jedoch eingezäunt und mindern so die Gefahr.
In Block D ist bisher kein Kinderspielplatz vorhanden. Kinder in diesem Wohngebiet sind ge-
zwungen das Wohngebiet zu verlassen, um einen Spielplatz nutzen zu können.
Der in Block C an der Elbestraße gelegene Spielplatz ist mit seinen ca. 1500 m² einer der größ-
ten Spielplätze in Reckenfeld. Jedoch wird er aufgrund seiner „unfreundlichen“ Gestaltung nicht
häufig besucht. Auf Grund sehr hoher Zäune und massiver Ziegelwände entsteht der Eindruck
eines abgeschlossenen, nicht für die Öffentlichkeit zugänglichen Bereiches.
Abb. 24. Spielplatz in Block B Abb. 25. Spielplatz an der Kanalstraße Abb. 26. Spielplatz in Block C
25Kinder, Jugend und ihre Treffpunkte
Verortung der Bolzplätze
Block A
Ortsmitte
Block B 1. 2.
3.
Block C
4.
Block D
1. Steinfurter Straße
2. Kirchweg
3. Wittlerdamm
4. Kanalstraße Abb. 27. Luftbild – Bolzplätze
26Kinder, Jugend und ihre Treffpunkte
3.4 Bolzplätze
Abb. 28. Schild am Bolzplatz Abb. 29. Bolzplatz am Wittlerdamm Abb. 30. Bolzplatz bei Block B
Sind Spielplätze hauptsächlich für Kinder bis 14 Jahren, so richten sich Bolzplätze vor allem an
die Jugendlichen. Reckenfeld bietet ihnen vier Bolzplätze. Dabei handelt es sich um Rasenbolz-
plätze, die in einem guten Zustand sind und sich über den gesamten Stadtteil verteilen.
Lediglich im Nord-Osten befindet sich kein Bolzplatz, so dass die Jugendlichen aus diesem Be-
reich keinen fußläufig zu erreichenden Platz in direkter Umgebung haben. Zusätzlich gibt es an
einigen Bolzplätzen einen Basketballkorb.
Die vorhandenen Bolzplätze sind am Rande der Wohnbebauung gelegen und haben einen
Lärmschutz durch die umgebende Bepflanzung. Sie stellen somit keine Lärmbelästigung für die
Anwohner in der Umgebung dar. Zwar befinden sich alle an stärker befahrenen Straßen, jedoch
sind sie umzäunt, so dass keine Gefahr für die Jugendlichen und für den Verkehr besteht.
Auffallend ist, dass die Bolzplätze, obwohl sie nicht in direkter Nähe zur Wohnbebauung liegen,
eingeschränkte Nutzungszeiten haben. So ist das Spielen und „Bolzen“ in den Mittagsstunden
und am Abend bzw. in der Nacht untersagt. Auch ist die Nutzung auf Kinder und Jugendliche
bis 18 Jahren beschränkt.
Jugendliche im Alter von 18 bis 25 Jahren dürfen sich hier offiziell nicht aufhalten. Somit gibt es
für diese Altersgruppen keine Aufenthaltsflächen in Reckenfeld.
27Kinder, Jugend und ihre Treffpunkte
Verortung der Jugendtreffs
Block A
1.
Ortsmitte
Block B
2.
Block C
Block D
1. Katholischer Jugendtreff der Pfarr-
gemeinde Reckenfeld
2. Evangelischer Jugendtreff der Kir-
chengemeinde Greven-Reckenfeld Abb. 31. Luftbild – Jugendtreffs
28Kinder, Jugend und ihre Treffpunkte
3.5 Offizielle Jugendtreffs
Die einzigen offiziellen Treffpunkte für Jugendliche in Reckenfeld sind zwei Jugendtreffs. Einmal
der Jugendtreff der Katholischen Pfarrgemeinde Reckenfeld am Kirchplatz und der Jugendtreff
der Evangelischen Kirchengemeinde Greven-Reckenfeld am Moorweg.
Beide Jugendtreffs bieten den Jugendlichen Aufenthaltsräume im Innenbereich sowie Flächen
für bewegungsbetonte Nutzungen im Außenbereich. Wobei sich das Außenangebot des katho-
lischen Jugendtreffs in der Stadtmitte eher an Kinder bis 14 Jahren richtet.
Der evangelische Jugendtreff hingegen bietet im Außenbereich ein breitgefächertes Sportan-
gebot an. So können die Kinder und Jugendlichen zum Beispiel am Kirchturm klettern oder
Bogenschießen.
Abb. 32. Innenbreich evangelischer Jugendtreff Abb. 33. Außenbereich evangelischer Jugendtreff Abb. 34. Katholischer Jugendtreff
In den Herbst- und Wintermonaten werden überwiegend Angebote im Innenbereich der Treffs
angeboten. Hierbei sind die begrenzten Räumlichkeiten ein großes Problem. Nur selten hält
sich mehr als eine „Clique“ im Jugendtreff auf. Zudem sind die Räumlichkeiten nur während der
regulären Öffnungszeiten für die Jugendlichen zugänglich.
Im Sommer werden die Angebote für die Kinder und Jugendlichen soweit es geht in den Außen-
bereich verlegt. Aber auch hier gibt es Probleme durch mangelnde Akzeptanz einiger Anwohner
und das gekürzte Budget für die Kinder- und Jugendarbeit.
So fehlt es zurzeit an geeigneten Standorten für Bauwagen mit Spielgeräten, die früher tem-
porär auf dem Hauptschulgelände Platz fanden. Auch das Tanzen in der Aula der Hauptschule
kann aufgrund fehlender finanzieller Mittel nicht mehr angeboten werden.
29Kinder, Jugend und ihre Treffpunkte
Verortung der inoffiziellen Treffpunkte
1.
Block A
2.
Ortsmitte
Block B
3.
7.
5. 6.
Block C
4.
1. Rampe im Industriegebiet
2. Mauer am Kirchplatz
3. Regenrückhaltebecken/Ententeich Block D
4. Spielplatz an der Kanalstraße
5. Laderampe LIDL
6. Parkplatz am Wittlerdamm
7. Grillplatz am Wittlerdamm
Abb. 35. Luftbild – Treffpunkte
30Kinder, Jugend und ihre Treffpunkte
3.6 Inoffizielle Treffpunkte
Aufgrund weniger offizieller Treffpunkte gibt es eine Vielzahl an inoffiziellen Treffpunkten an
denen sich die Jugendlichen treffen. Dabei handelt es sich hauptsächlich um Freiräume.
1. Rampe im Industriegebiet
Die Rampe im Industriegebiet dient dem Be- und Entladen von LKWs. Jedoch wird sie zusätzlich
von Jugendlichen als Skateanlage in Anspruch genommen. Die plane Betonoberfläche und die
isolierte Lage eignen sich hierzu sehr gut. Nutzungskonflikte sind nicht bekannt.
2. Mauer am Kirchplatz
Auf dem Vorplatz der katholischen Kirche in der Ortsmitte befindet sich eine Ziegelmauer. Auf
dieser sitzen die Jugendlichen und kommunizieren bzw. suchen den Kontakt zu anderen Alters-
gruppen. Hier kommt es oft zu Konflikten mit den Bürgern aufgrund mangelnder Akzeptanz und
Integration der Jugendlichen
3. Regenrückhaltebecken/Ententeich
Dieser Bereich dient den Bürgern überwiegend der Naherholung, so auch den Jugendlichen. Sie
treffen sich hier, auch in den Abend- und Nachtstunden und kommunizieren oder suchen nach
Entspannung. Die übrigen Nutzer bemängeln dabei den zurückgelassenen Müll, insbesondere
leere Alkoholflaschen.
4. Spielplatz an der Kanalstraße
Der Spielplatz ist offiziell nur für Kinder bis 14 Jahren erlaubt. Durch die abgelegene Lage, den
anschließenden Bolzplatz und den Basketballkorb richtet er sich mit seinen Angeboten jedoch
auch an Jugendliche zwischen 13 und 25 Jahren, so dass diese sich dort auch aufhalten. Auf-
grund unterschiedlicher Aufenthaltszeiten von Kindern (mittags/nachmittags) und Jugendli-
chen (abends) kommt es bisher nicht zu Konflikten. Allerdings ist der zurückgelassene Müll ein
Problem.
Abb. 36. Rampe im Industriegebiet Abb. 37. Mauer am Kirchplatz Abb. 38. Ententeich Abb. 39. Spielplatz Kanalstraße
31Kinder, Jugend und ihre Treffpunkte
5. Laderampe LIDL
Die Laderampe beim LIDL ist überdacht und wird daher von den Jugendlichen vor allem bei
schlechten Witterungsverhältnissen aufgesucht und als Unterstand, sowie als Skate- und BMX-
Bahn genutzt. Da die Jugendlichen vom LIDL-Betreiber ausdrücklich akzeptiert sind und sich
dort aufhalten dürfen, kommt es zu keinen Konflikten.
6. Parkplatz am Wittlerdamm
Der Parkplatz gegenüber der Grundschule am Wittlerdamm wird ebenfalls als Treffpunkt ge-
nutzt. Vorwiegend ältere Jugendliche mit ihren Autos treffen sich dort. Auf Grund der abgelege-
nen Lage kommt es nicht zu Nutzungskonflikten.
7. Grillplatz am Wittlerdamm
Hier befindet sich, trotz geringer Aufenthaltsqualität, ein bevorzugter Treffpunkt der Jugendli-
chen aus dem Ort. Der Platz bietet Sitzmöglichkeiten und liegt am Stadtrand, weshalb die Ju-
gendlichen sich unbeobachtet fühlen und sich frei bewegen können. Auch ein Bolzplatz befin-
det sich in direkter Nähe. Der zurückgelassene Müll stellt zwar für viele Bürger ein Problem dar,
allerdings ist im Bereich des Grillplatzes kein Mülleimer vorhanden.
Abb. 40. Laderampe LIDL Abb. 41. Parkplatz am Wittlerdamm Abb. 42. Grillplatz am Wittlerdamm
32Kinder, Jugend und ihre Treffpunkte
3.7 Fazit und Planungshinweise
Freizeitangebote und Sportstätten:
Positiv: + breites Angebot
+ kostengünstig
Negativ: - wenig Trendsportarten
- wenig Kulturangebote für Jugendliche
Planungshinweise:
Trendsportarten und Kulturangebote die sich an Jugendliche richten, in Absprache mit diesen,
anbieten.
Spielplätze:
Positiv: + hohe Anzahl
+ guter Zustand
+ unterschiedliche Spielgeräte
+ sichere Lage
Negativ: - fehlender Spielplatz in Block D
- starkbefahrene Straßen an der Hauptschule und an der Kanalstraße
- geringe Aufenthaltsqualität des Spielplatzes in Block C
Planungshinweise:
Spielplatz in Block D nach Möglichkeiten ergänzen.
Emsdettener Landstraße und Kanalstraße auf Höhe der Spielplätze entschleunigen.
Aufenthaltsqualität des Spielplatzes in Block C durch gestalterische Maßnahmen erhöhen.
Bolzplätze:
Positiv: + hohe Anzahl
+ gute Zustand
+ keine Lärmbelästigung
Negativ: - fehlender Bolzplatz im Nord-Osten der Stadt
- eingeschränkte Nutzungszeiten
- Altersbegrenzung
Planungshinweise:
Bolzplatz im Nord-Osten der Stadt ergänzen.
Nutzungszeiten erweitern.
Bolzplätze für alle Altersgruppen freigeben.
33Kinder, Jugend und ihre Treffpunkte
Offizielle Jugendtreffs
Positiv: + engagierte Mitarbeiter
+ großes Freizeitangebot
Negativ: - kleine Räumlichkeiten
- begrenztes finanzielles Budget
- keine Alternative für Standort „Hauptschulgelände“
Planungshinweise:
Weitere Räumlichkeiten im Innenbereich, vor allem für Jugendliche, schaffen.
Fördermöglichkeiten prüfen und nach Möglichkeit das Budget für die Jugendarbeit erhöhen.
Nutzung des Hauptschulgeländes prüfen und ggfs. alternative Flächen und Räume zuweisen.
Inoffizielle Treffpunkte
Positiv: + Aneignung von Räumen durch Jugendliche
+ Akzeptanz Jugendlicher (Beispiel: LIDL)
Negativ: - fehlende Akzeptanz
- mangelnde Integration
- keine festen Flächen
- keine Unterstellmöglichkeiten
- keine Räume im Innenbereich
- geringe Aufenthaltsqualität der Treffpunkte
Planungshinweise:
Akzeptanz und Integration der Jugendlichen fördern.
Feste Flächen für Jugendliche ausweisen.
Unterstellmöglichkeiten im Außenbereich schaffen.
Geeignete Räume im Innenbereich, in Absprache mit den Jugendlichen suchen.
Aufenthaltsqualität der Treffpunkte durch gestalterische Maßsnahmen erhöhen.
34Sie können auch lesen