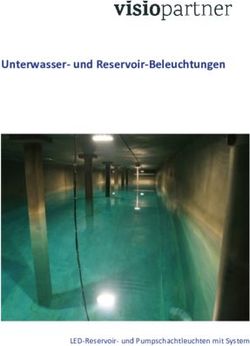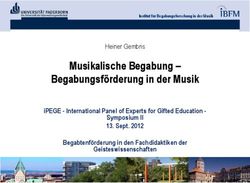Problemzone Schulter Acht verschiedene Diagnosen - MVZ am Nordbad
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
1
Acht verschiedene Diagnosen
Problemzone Schulter
Ebenso wie das Knie ist die Schulter ein hochkomplexes Gelenk des menschlichen Körpers.
Wenn ein Patient unter Schmerzen im Schulterbereich leidet, bedarf es großer Erfahrung,
um herauszufinden, was diese Beschwerden auslöst. An der Schulter treten viele
verschiedene Verletzungsmuster auf. Der behandelnde Arzt muss die Rotatorenmanschette
ebenso in seine Untersuchung mit einbeziehen wie die lange Bizeps-Sehne oder zum
Beispiel das Schulter-Eckgelenk. Grundsätzliches Problem der Schulter: Eine relativ kleine
Pfanne soll einem im Verhältnis viel zu großen Gelenkkopf Halt geben. Die Schulter wird
durch sehr viele Weichteile und dynamische Strukturen stabilisiert. Die Vielzahl dieser
Regelkreise macht eine Diagnose schwierig, wenn in diesen Regelkreisen ein
Ungleichgewicht entstanden ist. Die Orthopädie unterscheidet nicht weniger als acht
mögliche Haupt-Diagnosen bei Schulterproblemen.
Von Dr. Andreas Kugler
Gerade bei Problemen mit der Schulter ist für eine richtige Diagnose
ganz entscheidend, dass sich der Orthopäde und Sportmediziner zu
Beginn der Behandlung durch eine ausführliche Anamnese – das ist die
Befragung des Patienten –, eine sorgfältige Klinische Untersuchung,
durch Röntgenbilder und Sonographie sowie falls nötig durch
Aufnahmen per Kernspintomographie ein möglichst detailliertes Bild von
der Verletzung und den möglichen Ursachen der Beschwerden macht. Er
muss bereits vor Beginn einer etwaigen Operation sehr genau wissen,
wo das Problem liegt, denn gerade die Komplexität des Schultergelenks
macht eine weitere Ursachenanalyse während einer Operation kaum
möglich. Grundsätzlich bestehen folgende acht Diagnosemöglichkeiten
für eine Schulterverletzung beziehungsweise bei Beschwerden mit der
Schulter – in der Praxis sind Kombinationen der einzelnen Punkte
möglich, weshalb der behandelnde Arzt immer die Begleit-Pathologie im
Blick haben muss:
ACHT URSACHEN FÜR SCHULTERPROBLEME
1) Instabiltät der Schulter
2) Ruptur (Riß) der Rotatorenmanschette Eine sorgfältige Anamnese
3) Impingement-Syndrom ist für Dr. Andreas Kugler
und seine Kollegen vom
4) Verletzung des Schulter-Eckgelenks (AC-Gelenk) MVZ München die erste
Grundlage für eine korrekte
5) Verletzung der langen Bizeps-Sehne Diagnose bei Verletzungen
6) Arthrose im Schultergelenk im Schulterbereich.
7) Zysten im Schultergelenk
8) Frakturen (Brüche) im Schulterbereich
Um die Ursache von Schmerzen, Verletzungen oder Bewegungseinschränkungen diagnostizieren und
richtig einschätzen zu können, ist es für den Orthopäden hilfreich, den Hergang eines etwaigen Unfalls
genau zu kennen sowie den (sportlichen) Hintergrund des Patienten. Bei ambitionierten Freizeitsportlern
etwa entstehen viele Probleme durch schlechte Technik. Eklatant sind hier beispielsweise die
Unterschiede zwischen professionellen Baseballspielern und Freizeit-Baseballern, ebenso die zwischen
Tennisprofis und Hobbyspielern. Grundsätzlich gilt: Gute Technik reduziert Probleme.2 1) Instabilität der Schulter Die häufigste Diagnose bei Schulterbeschwerden, insbesondere im jugendlichen Alter, ist die Instabilität der Schulter. Die Ursache kann ein Unfall sein, also eine traumatische Verletzung, oder aber die Instabilität tritt willkürlich ein, also ohne auslösendes Unfallereignis. Die Schulter luxiert in über 90 Prozent der Fälle nach vorne unten. Typische Ursachen für traumatische Verletzungen sind beim Wintersport Snowboard-Fahrer, die sich mit der Hand aufstützen oder Skifahrer, die auf den gestreckten Arm fallen. Auch Handballer, denen in den Wurfarm gegriffen wird, sind extrem gefährdet. Durch die Luxation wird die Gelenklippe, das sogenannte Labrum, verletzt, es wird ein- oder abgerissen. im gesunden Zustand positioniert das Labrum den Oberarmkopf korrekt in der Schulterpfanne und verhindert, dass die Schulter luxiert. Nach einer Luxation sollte die Schulter so schnell wie möglich reponiert, also wieder an die vorgesehene Stelle gebracht werden. Dies vermindert die Schädigung von Bändern, Muskeln und Sehnen und kann grundsätzlich mit oder ohne Narkose geschehen. Ein luxiertes Schultergelenk aber beispielsweise gleich auf der Skipiste wieder einzurenken, ist aus rechtlicher Sicht nicht unproblematisch. Im Zweifelsfall ist also immer ein Transport des Verletzten ins Krankenhaus oder in eine Arztpraxis angebracht, wo zunächst genauere Untersuchungen und ein Röntgenbild angefertigt werden können. Nach einer ersten Schulterluxation stellt sich die Frage, ob die Schulter operiert werden muss, oder nicht. Das Reluxationsrisiko, also Wahrscheinlichkeit, dass nach einer ersten Luxation eine zweite folgt, liegt bei 20-jährigen Männern bei 80 Prozent, wenn nicht operiert wird. Mit zunehmendem Alter nimmt die Wahrscheinlichkeit ab. Ob direkt nach einer ersten Luxation operiert werden sollte, oder ob der Patient zunächst eine mögliche zweite Luxation abwartet, hängt ganz wesentlich davon ab, wie dringend er auf die Funktionalität seiner Schulter angewiesen ist. Freeclimber oder Kajakfahrer, deren Leben unter Umständen von der Funktionalität ihres Armes abhängt, werden sich bereits nach der ersten Luxation operieren lassen. Wessen Leben nicht unbedingt von einer stabilen Schulter abhängt, der wird gewöhnlich abwarten, ob die Schulter erneut luxiert. Wird die Erstluxation nicht operiert, erhält der Patient für sechs Wochen einen Verband, der die Schulter ruhig stellt, die Außenrotation verhindert und der Gelenklippe die Möglichkeit gibt, wieder anzuwachsen. Ist eine Operation angezeigt, hat der Operateur die Möglichkeit, offen oder arthroskopisch zu agieren. Nach der Erst-Luxation ist meist ein arthroskopischer, also minimal-invasiver Eingriff angezeigt. Per Arthroskopie kann die abgerissene Gelenklippe wieder angenäht werden. Dabei kommen resorbierbare Dübel zum Einsatz, mit denen die Gelenklippe wieder am ursprünglichen Ort befestigt wird. Wenn die Schulter bereits öfter luxiert war, ist meist nur noch eine offene Operation sinnvoll, bei der beispielsweise die Gelenkkapsel gerafft werden kann, was der Schulter wieder mehr Stabilität verschafft. Nach der Operation trägt der Patient den Arm drei Wochen lang tags und nachts in einer Schlinge, die ihn am Körper fixiert. Weitere drei Wochen muss die Schlinge auch nachts getragen werden, denn insgesamt sechs Wochen sollte mit dem Arm keinerlei Außenrotation erfolgen. Drei bis vier Monate dauert es, bis der Patient wieder Sport treiben kann. Die einzig mögliche Prävention, also die einzige Möglichkeit, sich vor einer Schulterluxation zu schützen, ist, die Gefahr zu erahnen und zu vermeiden. Als Handballer nicht durchziehen, wenn der Gegner in den Wurfarm zu greifen droht, als Snowboarder nicht auf der Piste abstützen. Muskel-Aufbau bringt nichts: Es gibt keine Muskulatur, die den Oberarmkopf in der Schulterpfanne halten kann. Habituelle Schulterluxationen, also solche ohne traumatisches Ereignis, sollten nach Möglichkeit nicht operiert werden. Kinder, die „Kuck’ mal, was ich kann!“ bewusst ihre Schulter luxieren und dann den Arm beängstigend kreiseln lassen können, sollten durch einen Physiotherapeuten erklärt bekommen, weshalb das ungesund ist, und wie sie vermeiden können, dass die Schulter „heraus springt“. Als semi-operative Methode kommt hier bei extremen Fällen der Einsatz einer Thermo-Sonde in Betracht, welche die Kapsel schrumpfen lässt.
3 Die Diagnostik der instabilen Schulter erfolgt durch Anamnese, Klinische Untersuchung, ein Röntgenbild sowie bei nicht akuten Verletzungen durch eine Kernspin-Aufnahme. 2) Ruptur (Riß) der Rotatorenmanschette Rotatorenmanschette heißt die Muskelgruppe, die den Arm hebt und für die Außenrotation zuständig ist. Sie besteht aus drei Außenrotatoren (Musculus supraspinatus, Musculus infraspinatus, Musculus teres minor) und einem Innenrotator (Musculus subscapularis). Ein Riß der Rotatorenmanschette ist meist degenerativ, also durch Verschleiß bedingt, und tritt gewöhnlich erst ab dem 50 Lebensjahr auf. Der Muskel scheuert dabei anlagebedingt durch – rund 80 Prozent der 80-Jährigen leiden unter dieser Verletzung. Bei Verletzungen der Rotatorenmanschette sind oft die Lange Bizeps-Sehne und das Schulter- Eckgelenk (AC-Gelenk) in Mitleidenschaft gezogen. Dies berücksichtigt der erfahrene Orthopäde bei seiner Diagnose. Rund 60 Prozent der Schulter-Operationen bei Menschen über 50 Jahre betreffen die Rotatorenmanschette. Ist der Schaden groß, leidet der Patient unter dem Drop-Arm-Syndrom – er kann den Arm nicht mehr oben halten. Sind nur kleine Risse in der Manschette entstanden, schmerzt die Muskulatur. Ob und wie die Ruptur therapiert, operiert oder überhaupt behandelt werden muss, hängt wesentlich von den Erwartungen des Patienten ab. Ist ein Loch in der Muskulatur vorhanden, das aber keine Beschwerden verursacht, erfolgt keine Behandlung. Bei erheblichen Beschwerden, oder falls die Ruptur durch einen Unfall verursacht wurde, wird das Loch vor allem bei jüngeren Patienten operativ geschlossen. Ältere Menschen schließlich, die wenig aktiv sind, können die Schulter durch Krankengymnastik stabilisieren. Tritt binnen drei Monaten keine Besserung ein, kann auch hier operiert werden. Der sogenannte Gold-Standard ist dabei die offene Operation, bei der die Rotatorenmanschette mit einer Knochennut wieder am Knochen fixiert wird. Bei dieser Methode wächst sie mit Abstand am besten ein. Arthroskopische Techniken basieren auf Ankern, die gesetzt werden, um daran die Rotatorenmanschette zu befestigen. Je nach Art und Größe der Ruptur findet diese Technik Anwendung. Die Diagnostik ergibt sich aus Anamnese, Klinischer Untersuchung, Sonografie, Röntgenaufnahme und Kernspintomographie. 3) Impingement-Syndrom Als Impingement-Syndrom bezeichnet die Medizin die eingeschränkte Beweglichkeit eines Gelenks. Meist wird der Begriff im Zusammenhang mit der Schulter verwendet, wenn es zu Schmerzen unter dem Schulterdach kommt, die durch ein Einklemmen von Gewebe zwischen Oberarmkopf und Schulterdach verursacht werden. Das Impingement selbst ist dabei nur ein klinisches Zeichen und sagt nichts über die Ursache des Einklemmens beziehungsweise der Bewegungseinschränkung aus. Es ist ein Symptom wie es Zahnschmerzen sind, gibt aber keine Auskunft darüber, was den Schmerz verursacht. Bei Jugendlichen ist die häufigste Ursache für ein Impingement die Instabilität der Schulter. Und es gilt der Grundsatz: Bei jedem jugendlichen Sportler mit einem Impingement, gilt als Ursache des Impingements so lange eine Instabilität der Schulter, bis bewiesen ist, dass keine Instabilität vorliegt. Eine weitere Ursache kann eine gerissene Rotatorenmanschette sein. Problem beim Impingement: Jeder Orthopäde kann sehr leicht feststellen, ob ein Impingement vorliegt. Herauszufinden, was genau das Impingement verursacht, dafür bedarf es sehr großer Sorgfalt und Erfahrung – hier kommt es immer wieder zu Fehldiagnosen. Fallen Instabilität und eine gerissene Rotatorenmanschette als Ursachen aus, liegt ein sogenanntes echtes Impingement vor; echte Impingements sind meist anlagebedingt. Ursachen können ein zu kleines Loch des Knochensporns am Schulterdach oder ein zu geringer Abstand zwischen Schulterdach und Oberarmkopf sein. Beides bezeichnet man als Outlet-Impingement. Im Gegensatz dazu ist beim Non-
4 Outlet-Impingement der Knochenabstand normal, dafür aber sind die Rotatorenmanschette oder der Schleimbeutel falsch positioniert – sie werden eingeklemmt und schmerzen. Wenn keine Instabilität der Schulter oder gerissene Rotatorenmanschette vorliegt, sie also nicht die Ursache des Impingements sind, sondern ein echtes Impingement-Syndrom vorliegt, entfernt der Operateur arthroskopisch den Schleimbeutel und falls nötig eine kleine Scheibe des Schulterdaches, um Platz zu schaffen. Bevor jedoch eine Operation in Betracht gezogen wird, deren Nachbehandlung mit zumindest zwei Monaten sehr langwierig ist und nach der der Patient zwei Monate lang keine Überkopf-Tätigkeiten ausführen darf, müssen alle konservativen Behandlungsmöglichkeiten ausgeschöpft sein. Heißt: Eine Therapie mit Spritzen, Krankengymnastik, mit Haltungsschule und nicht zuletzt eine Anpassung des Lebenswandels. Denn auf diese Weise sind 60 Prozent aller Impingements heilbar! 4) Verletzung des Schulter-Eckgelenks (AC-Gelenk) Beim Verbindungsgelenk zwischen Schlüsselbein und Schulterdach, dem Schulter-Eckgelenk, auch AC- Gelenk genannt, tritt mit zunehmendem Alter Verschleiß auf. Wenn das AC-Gelenk alleine betroffen ist, zum Beispiel nach einem Unfall, dann macht es bei der horizontalen Abduktion, also dem Körper- Übergreifen, Beschwerden. Dauert dieser Zustand längere Zeit an, bildet das Gelenk eine Nase aus, der Raum zum Schulterdach verkleinert sich – die Folge ist ein Impingement. Ein Impingement kann also auch durch eine Knochennase am Schulter-Eckgelenk bedingt sein. Diese Knochennase kann arthroskopisch, aber auch in einer offenen Operation entfernt werden. Traumatisch ist die sogenannte Sprengung des Gelenks. Die riskiert, wer beispielsweise beim Snowboardfahren oder Mountainbiken auf den angelegten Arm stürzt. Die Verbindung zwischen Schlüsselbein und Schulderdach reißt – es kommt zu einem Schlüsselbein-Hochstand. Die Begriffe „Tossy“ und „Rockwood“ zeigen den Grad des Hochstands an. Beide Verletzungen werden je nach Ausmaß operativ versorgt. Schmerzen kann auch Arthrose im Schulter-Eckgelenk verursachen. Bei fast jedem Menschen ist ab ca. dem 50. Lebensjahr Arthrose im Schulter-Eckgelenk feststellbar. Wenn die Schmerzen durch Injektionen nicht in den Griff zu bekommen sind, wird das äußere Ende des Schlüsselbeins entfernt. Dieser Eingriff kann offen oder arthroskopisch erfolgen. 5) Verletzung der langen Bizeps-Sehne Die lange Bizeps-Sehne ist ein Schulter-Depressor. Wer sie anspannt, drückt seinen Oberarmkopf nach unten. Die Sehne ist nicht so sehr entscheidend für die Beugung des Ellbogengelenks, sehr wohl aber für die Drehung. Wenn sie reißt, ist meist Verschleiß die Ursache. Der Kraftverlust fürs Drehen liegt ohne die Sehne bei 10 bis 15 Prozent. Die lange Bizeps-Sehne kann scheuern, aus ihrer Führung herausspringen (luxieren) und auf diese Weise Schmerzen verursachen. Der Operateur kann die Sehne mit einem Dübel wieder refixieren oder auch ganz entfernen – dann mit der Folge des Kraftverlusts beim Drehen. 6) Arthrose im Schultergelenk Weil man auf der Schulter nicht läuft und damit keine Dauerbelastung unter hohem Gewicht im Alltag vorliegt, macht Arthrose im Schultergelenk vergleichsweise spät Beschwerden. Zum Vergleich: Arthrose im Knie oder in der Hüfte schmerzt bei jedem Schritt! Arthrose in der Schulter wird gewöhnlich konservativ behandelt, heißt mit Spritzen und Krankengym- nastik. Nur wenn die Schmerzen unerträglich werden, kommt eine Schulterprothese in Betracht. Meist
5 wird dann nur ein künstlicher Oberarmkopf gesetzt, aber auch die Pfanne kann man ersetzen. Die Funktion der Schulter lässt sich durch diese Operation kaum verbessern, und niemand wird mit einer künstlichen Schulter je wieder Tennis spielen. Aber die Schmerzen sind weg. Das Ziel einer Operation ist hier schmerzfreies Bewegen. Diese Operation betrifft gewöhnlich Menschen, die 70 Jahre und älter sind. 7) Zysten im Schultergelenk Im Schultergelenk gibt es Zysten, die auf einen Nerv (Nervus suprascapularis) drücken und zu einer Atrophie, also einer Verkleinerung des Musculus supraspinatus oder des Musculus infraspinatus führen können. Diese Zysten sind tückisch, denn sie verursachen Schulterschmerzen und sind für den Orthopäden nicht leicht zu erkennen. Nur in den Aufnahmen der Kernspintomographie sind sie sichtbar. Sie finden sich auch am Nervus supra scapularis, der durch ein dünnes Loch am Schulterblatt führt. Versursacht werden diese Beschwerden durch Überbelastung – gerade bei Gerade bei Volleyballern treten diese Zysten vermehrt auf. Sie treten aus dem Engpass am Schulterblatt aus. Unklare Scherzen im Schulterbereich können durch Zysten ausgelöst werden. 8) Frakturen (Brüche) im Schulterbereich Zu einer Glenoidfraktur, einem Bruch der Schulterpfanne, kann es kommen, wenn die Schulter nach vorne luxiert und gleichzeitig eine Stauchung eintritt. Im Grunde handelt es sich um eine knöcherne Schulterluxation, die etwa zehnmal seltener vorkommt als eine gewöhnliche Luxation. Eine Operation ist angezeigt, wenn ca. 30 Prozent oder mehr der Gelenkfläche abgebrochen sind. Entscheidend ist die Lage des Fragments; um diese zu bestimmen, wird ein Aufnahme per Dünnschicht-Computertomographie angefertigt. Alle anderen Knochenbrüche der Schulter betreffen den Oberarmkopf. Hier kann es zu Brüchen mit einem bis vier Fragmenten kommen sowie zu einem Sub-Kapital-Bruch, also dem Abbrechen des gesamten Oberarmkopfes. Letzteres ist vor allem bei älteren Menschen zu beobachten, bei denen der Kopf selbst ganz bleibt, der Oberarmknochen aber unmittelbar darunter abbricht. Hier führt die konservative Behandlung meist zu guter Heilung, vorausgesetzt die Fragmente sind geeignet positioniert. Andernfalls sind eine Operation und die Fixierung mit winkelstabilen Platten angezeigt. Der Oberarmkopf wird von zwei Knochenvorsprüngen flankiert, dem Tuberculum majus und dem Tuberculum minus. Am Tuberculum majus ist die Rotatorenmanschette befestigt, und an dieser Befestigungsstelle kann das Tuberculum majus brechen. Solche Brüche sind meist durch Stürze bedingt, beispielsweise beim Skifahren auf harter Piste. Dann rutscht das abgebrochene Fragment nach oben und verursacht zwei Probleme: Die Rotatorenmanschette verliert an Spannung, die Schulter verliert an Kraft. Zugleich wird es unter dem Schulterdach zu eng – es kommt zu einem Impingement. Deshalb muss das abgebrochene Stück Knochen mit der daran befestigten Rotatorenmanschette wieder am ursprünglichen Ort fixiert werden. Falls das Fragment sich nur wenig verschoben hat, kann die Behandlung konservativ, also mit einer Armschlinge erfolgen. Andernfalls kommen bei einer Operation winkelstabile Platten oder Schrauben zum Einsatz. Brüche im Schulterbereich sind oft mit Komplikationen verbunden, die Rehabilitationszeit liegt bei zumindest drei Monaten. Brüche des Schulterdachs sind sehr selten, die des Schlüsselbeins (Clavikula) häufiger. Text, Foto, Copyright: MVZ am Nordbad, München 2011 / www.sport-ortho.de
Sie können auch lesen