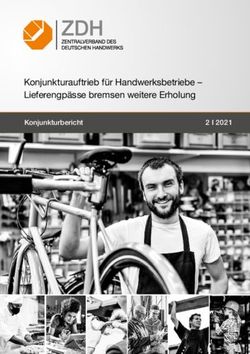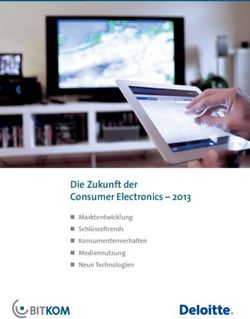Restaurator im Handwerk 4 2018 - Restaurator im Handwerk e.V
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Restaurator im Handwerk
DIE FACHZEITSCHRIFT FÜR RESTAURIERUNGSPRAXIS
4 2018
10. JAHRGANG
Restaurator im Handwerk • Ausgabe 4/2018 • ISSN 1869-7119
Schwerpunktthema
Deutschland
und die europäische Baukultur Teil 2
Deutschland
9,– €
Wieviel Europa steckt in der deutschen Baukultur ?
Mit Beiträgen über:
Tondachziegel | Gotik | La brique de verre Falconnier | Arbeitsmigranten der
Neuzeit | Chlorociboria-Holz und Späne-Marmorierung | Schloss Freienwalde –
Kleinod altpreußischer Landbaukunst | Broderie | Die lippischen Wanderziegler
u. v. m.Editorial
Europa
… ein weites Feld
Ja, Europa ist ein weites Feld und auch der
Bereich, den wir in der letzten Ausgabe ver-
sucht haben etwas zu umreißen, die europä-
ischen Einflüsse auf die in Deutschland vor-
handene Baukultur.
Viele Anregungen, Hinweise und Beiträge
haben uns erreicht, so dass wir auch diese
Ausgabe, entgegen unserer ursprünglichen
Planung, nochmals diesem interessanten
Thema widmen.
Auch hierzu müssen wir die Aussage vor-
an schicken: Nicht alle Einflüsse auf unsere
Baukultur haben wir darstellen, nicht alle
Akteure vorstellen und nicht alle Materiali-
en benennen können, die unsere Architektur
und unsere Art zu bauen beeinflusst haben.
Aber eins ist uns durch eigene Recherchen
und die unserer Autoren, zur Überraschung
aller, bewusst geworden: Es gibt zu dieser
Thematik, die Einflüsse Europas auf unse-
re Baukultur zu benennen und darzulegen,
offensichtlich keine umfassende Veröffentli-
chung.
Wohl gibt es Publikationen, die europäi-
sche Einflüsse auf das Bauen in einigen Regi-
onen beschreiben, und umfangreiche Biogra-
fien über „Botschafter“, wie wir sie nennen,
die Pate standen bei den Übernahmen von
auswärtiger Architektur in den deutschspra-
chigen Kulturkreis und den folgenden An-
verwandlungen, aber eine Publikation, die
all diese Einflüsse und ihre (Aus-)Wirkungen
erschöpfend zusammenfasst und behandelt,
haben wir nicht entdecken können.
So haben uns deshalb vorgenommen, die
Fachaufsätze der beiden Ausgaben in einem
Buch zu vereinigen, um damit zur Schlie-
ßung dieser Lücke etwas beizutragen. Ein-
zelne Beiträge werden dafür noch einmal
überarbeitet, einige Rubriken ergänzt und
erweitert werden.
Im ersten Halbjahr 2019 hoffen wir dann,
diesen Band zu den europäischen Einflüs-
sen auf die Baukultur in Deutschland Ihnen
vorlegen zu können – natürlich auch wieder
nicht zu allen Einflüssen, aber doch zu einer Carl Gehrts, Die neue Zeit, 1896, Bonn, aus der Sammlung der Dr. Axe-Stiftung
wichtigen Reihe von ihnen. Dieses Bild, in dem der Düsseldorfer Maler Carl Gehrts Karl Friedrich Schinkel, Bertel
Die europäische Baukultur und ihre wech- Thorvaldsen und Asmus Jacob Carstens als Repräsentanten der Architektur, Skulptur und
selseitige Beeinflussung und Befruchtung Malerei zu Füßen des dozierenden Johann Joachim Winkelmann vor der Kulisse Roms
bilden eben … ein weites Feld. dargestellt hat, ist eine Studie zu dem Freskenzyklus, den Gehrts von 1882 bis 1897 im
RWL. Treppenhaus der ehemaligen Düsseldorfer Kunsthalle ausgeführt hat.
Vgl. hierzu: Ausst.-Kat.: Carl Gehrts (1853-1898) und die Düsseldorfer Malerschule,
hrsg. von Ekkehard Mai, Kunstkabinett der Dr. Axe-Stiftung, Kronenburg/Eifel 2015.
Restaurator im Handwerk | 4/2018 | Deutschland und die europäische Baukultur – Teil 2 3Inhalt
Seite 6
Schwerpunktthema
6 Ein Europäer par Excellence –
der Tondachziegel
W i lli B en der
16 Gotik - dem Himmel näher
R ai n er W. L eon har dt
21 Der „Verein zur Beförderung des Gewerbe-
fleißes in Preußen“
R ai n er W. L eon har dt
26 Broderie – eine Herausforderung für die Gar-
tendenkmalpflege
C lem ens A le x an der W i m m er Seite 21
31 La brique de verre Falconnier –
eine Schweizer Erfindung erobert Europa
G ü nter K aesbach
38 Arbeitsmigranten der Neuzeit
I r a M a z zon i
Seite 38
43 Chlorociboria-Holz und Späne-Marmorierung
H ans M ichael sen
49 Reisebericht einer Auszubildenden
Austausch Berlin-Poissy Oktober 2018
Fan ny K loock e
50 Ebenisten-Ausbildung in Frankreich
52 Bildungsfahrt der Restauratoren des Bildungs-
und Technologiezentrum der HWK Berlin
53 Botschafter und Materialien europäischer
Baukultur
56 Die lippischen Wanderziegler Seite 43
R ai n er W. L eon har dt
61 Die Meisterschule für das Vergolderhandwerk
rekonstruiert italienische Wandmalerei
Thoma s N eger
62 Friedrich Wilhelm von Erdmannsdorff
R ai n er W. L eon har dt Seite 61
68 Wissensvermittlung in Europa durch Bau- und
Werkmeister im Mittelalter am Beispiel der
Ensinger, Roritzer und Böblinger
70 Literatur und Quellen zum Schwerpunktthema
4 Restaurator im Handwerk | 4/2018 | Deutschland und die europäische Baukultur – Teil 24 / 2018
Fachbeiträge
Seite 16 72 Die Haustür
C lem ens A le x an der W i m m er
74 Schloss Freienwalde –
Kleinod altpreußischer Landbaukunst
R ei n har d S ch mook , N i na N edelykov, P edro M or ei r a
Rubriken
3 Editorial
Seite 26
81 Kolumne
82 Vereinsmitteilungen
89 Kulturtipp
90 Buchbesprechungen
92 Vereine
93 Museen
Seite 31 94 Der literarische Text
96 Leserzuschriften
97 Fortbildungshinweise
Seite 56 98 Impressum
Seite 62
Seite 50
Seite 74
Restaurator im Handwerk | 4/2018 | Deutschland und die europäische Baukultur – Teil 2 5Deutschland und die europäische Baukultur Teil 2
Willi B ender
Ein Europäer par Excellence – der Tondachziegel
Ein uraltes Kulturgut, das in allen euro- Wanderwege des Dachziegels
Abb. 1
Dachlandschaft
päischen Ländern bis heute seinen festen und prägen- Die Wiege des Dachziegels stand in Griechenland. am Gardasee
den Platz hat, ist der Ziegel in Form des Mauerziegels Von hier aus trat er seinen Siegszug in den gesamten
und des Dachziegels. Der Mauerziegel prägt die Ar- Mittelmeerraum, Süd- und Mitteleuropa und Eng-
chitektur vieler herausragender Bauwerke, von Städ- land an.
ten, ja ganzen Epochen, wie die Backsteingotik zeigt, In Europa finden sich erste Spuren des Dachzie-
während der Dachziegel immer noch das Bild vieler gels in der vorgeschichtlichen Siedlung Lerna (heute
europäischen Dachlandschaften bestimmt. (Abb. 1) Myloi) bei Argos auf dem Peloponnes aus der Zeit des
Der Ziegel wirkt insofern auch als ein verbindendes Frühhelladikums um 2300 v. Chr. auf dem palastarti-
Element zwischen den verschiedenen länderspezifi- gen Herrenhaus, dem sogenannten „Haus der Ziegel“,
schen Baukulturen Europas. das mit rechteckigen gebrannten Ziegeln gedeckt war.
Doch während der Mauerziegel seinen Ur- Die eigentliche Zeit der Ziegeldeckung in Griechen-
sprung im Zweistromland Mesopotamien hat, wo ihn land beginnt jedoch im 8. Jahrhundert v. Chr. Nach
das Volk der Sumerer um 6000 v. Chr. entwickelte, ist einem Bericht des griechischen Dichters Pindar, der
der jüngere Dachziegel ein echter Europäer, der um im 5. Jahrhundert v. Chr. lebte, waren es die Korin-
2300 v. Chr. in Griechenland erfunden wurde. Ver- ther, die den Dachziegel erfunden haben.
schiedentlich werden auch die Chinesen als Erfinder Im Zuge der Kolonisation zwischen 760 und 550
des Dachziegels genannt. Richtig ist, dass die Chine- v. Chr. in Unteritalien und auf Sizilien brachten grie-
sen den Dachziegel selbständig und unabhängig ent- chische Siedler auch der Dachziegel mit. Sie trieben
wickelten, doch erst in der Zeit der Shang-Dynastie u.a. auch mit den Etruskern im nördlichen Mitte-
im Jahre 1600 v. Chr. Von China aus gelangte der litalien (ihre Kultur ist dort ab 800 v. Chr. nachweis-
Dachziegel auch nach Korea und Japan. Somit blei- bar) einen regen Tauschhandel mit ihren keramischen
ben die Griechen die Ersterfinder des Dachziegels, Produkte gegen deren Metallwaren.
der damit ein echt originäres europäisches Kultur- So kam der Dachziegel zu den Etruskern, die den
gut ist und zu unserem Kulturerbe gehört. Als solches Dachziegel fortan bei ihrem Tempel- und Hausbau
geniesst er allerdings hierzulande nicht die gleiche einsetzten. Mit der Eroberung durch die Römer zwi-
Wertschätzung wie z. B. in Korea, wo die historischen schen 300 und 90 v. Chr. gingen die Etrusker weit-
Dachziegel zum nationalen Kulturgut zählen. gehend in der Kultur des römischen Reichs auf. Die
Der folgende Beitrag befasst sich in erster Römer, die bis ins 3. Jahrhundert v. Chr. nur den Holz
Linie mit dem Ziegel in Form des Tondachziegels und und Lehmbau kannten, folgten den etruskischen
seiner Entwicklung und Verbreitung in Europa und Vorbildern und übernahmen auch den etruskischen
darüber hinaus.
6 Restaurator im Handwerk | 4/2018 | Deutschland und die europäische Baukultur – Teil 2Dachziegel. Die ersten gebrannten Römerziegel las- von Holz, vor allem der Konstruktionshölzer, mög-
sen sich ab 79 v. Chr. nachweisen. lich machten. Der Ständer- und der Blockhausbau
Mittels der Eroberungsfeldzüge, mit denen die entwickelten sich als Vorläufer des Fachwerkbaus.
Römer ihr Weltreich schufen, kamen auch der Dach- Als Dachdeckungsmaterial diente weiterhin organi-
ziegel und das Wissen um seine Herstellung in die be- sches Material wie Reet und Stroh, gespaltene dünne
setzen Provinzen und verbreiteten sich so im gesam- Baumstämme, Baumrinde, Grassoden und erste For-
ten Mittelmeerraum und in den Gebieten nördlich der men von Holzschindeln. Steine wurden für die Si-
Alpen. cherung der Dacheindeckung gegen Windeinflüsse
Speziell in Mitteleuropa hatten bis ca. 3000 v. verwendet.
Chr. die Menschen Unterkunft in Höhlen, Zelten in Diese Art von Bauwesen fanden die Römer bei
Kegelform und in mit Pflanzen oder Tierfellen abge- ihrer Eroberung Germaniens um 50 v. Chr. vor.
deckten Wohngruben gefunden. Mit Beginn der An- Der römische Historiker Tacitus (55-120) be-
lage von Feldern und der Domestizierung von Nutz- schrieb sie in seiner um 99 verfassten geographisch-
tieren mussten dauerhafte Wohnsitze geschaffen ethnographischen Studie „Germania“, ohne sich
werden, in denen Tiere, die Ernteerträge und auch selbst in Germanien aufgehalten zu haben. Er stützte
Werkstätten untergebracht werden konnten. sich dabei auf die Bereichte römischer Reisender und
Als Baumaterial standen nur die unmittelbar am Militärangehöriger sowie auf literarische Quellen.
Bauplatz vorhandenen Materialien zur Verfügung. Die Baukultur der Römer dagegen befand sich
Dies waren Holz in allen denkbaren Zuständen, von schon zur Zeit der Eroberung Germaniens auf einem
vollständigen Stamm bis hin zur Rinde, Pflanzen wie ganz anderen Niveau, sie kannten den Naturstein-
Schilf, Stroh, Reisig und Grassoden, Lehm und in ei- und Ziegelbau, und nicht zuletzt waren ihre Gebäu-
nigen Regionen unbearbeiteter Naturstein. An Werk- de mit Ziegeldächern eingedeckt. So sollte sich dann
zeugen gab es das Steinbeil und zu Messern gearbei- während der langen Besetzung Germaniens, sie dau-
tete Steinklingen. erte ca. 450 Jahre, auch hier das Bauniveau stetig wei-
Erste Formen von Hütten waren Pfostenkonst- ter verbessern.
ruktionen aus ganzen Baumstämmen und mit Flecht- Die Römer schufen in kurzer Zeit eine für die
werk verschlossenen nichttragenden Wänden, die mit Herstellung von Baumaterialien notwendige Infra-
Lehm verstrichen wurden. Die Dächer waren mit struktur durch die Anlage vor allem von Legionszie-
Reet oder Stroh gedeckt, die Böden mit gestampf- geleien, wie in der Nähe von Frankfurt, bei Mainz,
ten Lehm bedeckt. In stehenden Gewässern wurden Speyer, Worms oder Xanten. Aber auch viele römi-
Pfahlbauten errichtet, deren Baukörper auf einem sche Gutshöfe betrieben kleine Ziegelöfen, in denen
Pfahlrost ruhte. Für kleine Werkstätten wurden oft- Gefäßkeramik, aber auch Baukeramik hergestellt
mals Grubenhäuser genutzt, die von einem Spitz- wurde. Im Odenwald lassen sich heute noch Relikte
dach abgedeckt wurden - eine Vorstufe der späteren des Natursteinabbaues durch die Römer besichtigen.
Nurdachhäuser. Für den Transport wurden ein gut ausgebautes Stra-
Mit der Bronzezeit kamen verbesserte Werkzeuge ßennetz angelegt und vielfach Wasserwege genutzt.
auf, die eine bessere und differenziertere Bearbeitung Als die Römer sich um 400 n. Chr. aus Germa-
nien zurückzogen, hinterließen sie die größte Stadt
Abb. 2
Die traditionel- nördlich der Alpen, Köln. Sie hatte mehrere Zehn-
len Dachdeckun- tausend Einwohner, die in mehrstöckigen, aus Ziegel
gen in den ein- und Naturstein errichteten Häusern wohnten. Es gab
zelnen Regionen
Deutschlands,
ein Abwassersystem und eine Frischwasserversorgung
mit Hohlpfanne, mittels einer ca. 70 km langen Wasserleitung, beheiz-
Biberschwanz- bare Thermen und befestigte Straßen – ein Niveau der
ziegel, Kremp-
Wohn- und Stadtkultur, das erst ca. 1.450 Jahre spä-
ziegel und der
Priependeckung ter in Deutschland wieder erreicht wurde.
aus Nonnen, sind Nach dem Rückzug der Römer entwickelten sich
teilweise noch der Dachziegel und seine Verwendung in den einzel-
heute erkennbar.
Die Mönch- nen Ländern unterschiedlich, teils erst wieder nach
Nonne-Deckung einer gewissen Zeit des Stillstands. In den Ländern
war auf Kirchen, des Mittelmeerraums einschließlich Frankreichs bil-
Klöstern, Burgen
und sonstigen
dete das Hohlziegeldach die Normalform. In Eng-
hervorgehobe- land wurde der Flachziegel mit Geradschnitt, der
nen Bauten im daher auch englischer Schnitt genannt wird, vorherr-
ganzen Land
verbreitet.
schend. In Deutschland gilt der Krempziegel als die
erste eigenständische Modellentwicklung. Dabei gibt
es immer auch regionale Unterschiede, wie die Karte
von Deutschland mit den regionaltypischen Dachzie-
gelformen zeigt. (Abb. 2)
Restaurator im Handwerk | 4/2018 | Deutschland und die europäische Baukultur – Teil 2 7Kurze Entwicklungsgeschichte des Dachziegels Die klassischen Ziegeldachtypen der Antike bil-
Unverbindlichen Schätzungen zufolge sollen allein deten vier Ziegelformen, von den drei auf dem grie-
während der letzten 150 Jahre etwa 5.000 Dachzie- chischen Mutterland entstanden. (Abb. 4.1 bis 4.4)
gelmodelle entwickelt worden sein. Für eine kurze Bekannt waren die griechischen und etruskischen
Entwicklungsgeschichte genügt es allerdings, auf ei- Dächer auch durch ihre dekorative Ausgestaltung mit
nige wenige historische Modelle zurückzugreifen. Terrakotten, die später auch von den Römern über-
Die Dachdeckung mit Tondachziegeln hat sich nommen wurde. Neben dem ornamentalen Zweck
aus dem Holzbau entwickelt. Zur Deckung wurden sollten die Terrakottaverkleidungen u. a. als Giebel-
ursprünglich die segmentbogenförmigen Rindenstü- schmuck, Stirnziegel und Traufplatten das Holzwerk
cke, Splintbretter mit Baumrinde, Halbstämme, in gegen Witterungseinflüsse schützen.
China waren es halbierte Bambusrohre, und Holz-
bretter verwendet. Sie waren die Vorbilder für die Ur- Abb. 4.1
Als Urform gilt das Hohl-
formen der Dachziegel. (Abb. 3) ziegeldach mit konkav und
konvex verlegten Halb-
schalen. Dies ergab dann
später das heute noch im
mediterranen Raum übliche
Hohlziegeldach.
Abb. 4.2
Das „lakonische Dach“,
bestehend aus der flachen
Unterschale und dem halb-
Abb. 3 Urformen der Dachziegel runden Deckziegel.
A n zei g e
Abb. 4.3
Das „korinthische Dach“
bestand aus dem recht-
eckigen Leistenziegel und
einem schmalen, eckigen
Hohlziegel. Er wurde in der
Blütezeit Griechenlands
auch aus Marmor (woher
wohl auch die eckige Form
rührt) und vorzugsweise für
den Tempelbau hergestellt.
A nzeige
Abb. 4.4
Das „sizilische Dach“, die
Grundform des Leistenzie-
geldachs. Diese vierte Zie-
gelart entstand auf Sizilien
während der griechischen
Kolonisation etwa 750-
550 v. Chr. und wurde später
– via Etrusker – im römi-
schen Reich zur Normalform
und von den Römern in all
ihren Provinzen eingeführt.
8 Restaurator im Handwerk | 4/2018 | Deutschland und die europäische Baukultur – Teil 2Das Leistenziegeldach der Etrusker und Römer, In der spätrömischen Zeit bis ins Frühmittelalter
auch römisches Dach genannt, bestand aus dem verwendete man trapezförmige Leistenziegel, die auf
rechteckigen Leistenziegel, dem Tegula, und dem einer Zwischenlage aus gebrannten Tonplatten aufge-
halbrunden Deckziegel, dem Imbrex. (Abb. 5) Die legt wurden. Die einzelnen Leistenziegel wurden mit
Tegulae erreichten in Italien Breiten einem gewissen Abstand verlegt und berührten sich
von 40 bis 50 cm und Längen von nicht mehr. So entstand das spätrömische oder mit-
80 bis 110 cm, die in Germani- telalterliche Dach. Man kam hierbei noch ohne Auf-
en hergestellten dagegen nur hängenase aus; wegen der geringen Dachneigung ge-
eine Breite von 35 bis 40 nügte es, nur die unterste Reihe gegen Abrutschen
cm und Längen von 45 abzusichern.
bis 55 cm. Vermutlich Das spätrömische Dach wurde abgelöst vom
zwangen veränderte Hohlziegeldach zur besseren Anpassung des flach-
Rohstoffverhältnis- geneigten Dachs an die klimatischen Verhältnisse
se und klimatische im regenreichen Mitteleuropa, denn durch die Rin-
Bedingungen zu nenbildung wurde eine schnellere Wasserableitung
Abb. 5
Der römische dieser Formatände- gewährleistet. Ein weiterer Vorteil war die Anpas-
Leistenziegel, rung. Die Leisten- sungsfähigkeit an runde und geschweifte Dächer,
bestehend aus ziegel wurde dicht Turm- und Apsidendächer, da man Hohlziegel zu-
Tegula und
Imbrex an dicht direkt auf die Sparren aufgelegt .Die römi- sammenschieben und einzelne Reihen auslaufen las-
sche Dachziegeltechnologie war hoch entwickelt und sen konnte.
benutzte zahlreiche Zubehörziegel. (Abb. 6) Hieraus entstand dann im Laufe der Zeit die heu-
tige Mönch-Nonnen-Deckung.. Bei den ersten Hohl-
ziegeldächern waren die beiden Hohlziegel, d. h.
Ober- und Unterschale, auch Ober- und Unterdächler
genannt, noch identische Halbschalen ohne Nase. Sie
wurden angenagelt und vermörtelt. Beim sogenann-
ten Priepen- oder Nonnendach verwendete man nur
Abb. 6
Auswahl römischer Unterschalen, die an den Stoßfugen vermörtelt wur-
Zubehörziegel den. Diese Art der Deckung wurde auch „Arme-Leu-
te-Deckung“ genannt. (Abb. 7)
Abb. 7 Die Priependeckung
Im 11. Jahrhundert wurde die Aufhängenase er-
funden. Die Unterschale, die spätere Nonne, erhielt
eine Aufhängenase, den sogenannten Haken, und
damit auch den Namen Hakenziegel. Gleichfalls
wurde die Oberschale, auch Preis, später Mönch, ge-
nannt, mit einer Nase versehen, die aber nicht zum
Aufhängen, sondern zu Abstützung der darüber lie-
genden Oberschale diente. (Abb. 8)
Restaurator im Handwerk | 4/2018 | Deutschland und die europäische Baukultur – Teil 2 9Burgund Flachziegel mit seitlich versetzter Nase und
einem Loch zur Befestigung mit einem eisernen oder
hölzernen Nagel. Gegen Ende des 12. Jahrhunderts
entstanden die spitzbogigen Flachziegel mit zwei Na-
gellöchern. Als Übergang von der Nagelung zur Na-
senaufhängung betrachtet man französische Flach-
ziegel aus dem 12. Jahrhundert, die sowohl Nasen als
auch Löcher aufweisen. Die Schnittform des Ziegel-
fußes bildet das wichtigste Unterscheidungsmerkmal
der Biberschwanzziegelmodelle. (Abb. 10)
Abb. 8 Entwicklungsform der Mönch- und Nonnendeckung,
bei der Ober- und Unterschale noch Nasen aufweisen.
Im Mittelalter sprach man allgemein vom „Haken
und Preisen Dach“. Im 13. Jahrhundert kam dafür die
heutige Bezeichnung „Mönch-Nonnen-Dach“ auf, Abb. 10
wohl in Anspielung auf die damaligen Zustände in Schnittformen
des Biber-
den Klöstern. Im Laufe der Zeit erfuhren Mönch und Etwa 15 verschiedene Schnittformen sind be- schwanzziegels
Nonne verschiedene Änderungen, der Mönch wurde kannt, was nicht ausschließt, dass es noch weitere, un-
schmäler als die Nonnen und seine Nase entfiel. bekannte Formen gibt. Durch die Verwendung ver-
Um 1000 n. Chr entstand der Krempziegel, der schiedener Schnittformen in einer Dachfläche lassen
direkt abgeleitet ist vom Leistenziegel durch die Ver- sich interessante ornamentale Wirkungen erzielen.
einigung von Tegula und Imbrex zu einem Ziegel. Ende des 15. Jahrhunderts entwickelten die Hol-
Gelegentlich wird Bernward (960-1022 n. Chr), Bi- länder die Hohlpfanne, auch Holländische Pfanne ge-
schof von Hildesheim, als Erfinder des Krempziegel nannt, als Kombination der beiden Halbschalen des
genannt, weil man auf Ziegelscherben seinen Namen Hohlziegeldachs zu einer Einheit, mit dem Mönch als
gefunden hat. Bei den historischen Krempziegeln Krempe oder Deckwulst und der Nonne als Mulde
gibt es eine Form mit konisch verlaufender Krempe oder Pfanne, „der eine aneinander gewachsene zigel aus
und eine mit gestufter, d. h. eingeschnürter Krempe. platten und hol zigel “ war. Die französische Bezeich-
(Abb. 9) nung ist „tuile flamande“, also Flämischer Ziegel, die
englische „pan tile“, was unserem Wort Pfannenziegel
entspricht.
Wesentlich für den Erfolg dieser Pfanne war die
Kappung der rechten oberen und der linken unteren
Ecke, weil dadurch das Problem der Eindeckung des Abb. 11
sogenannten Vierziegelecks, d. h. der Stelle an der vier Holländische
Pfanne in der
Ziegel aufeinander treffen, gelöst wurde. Nach der
Ausführung als
Länge der Kappung unterscheidet man Kurzschnitt- Kurz- und Lang-
pfannen, welche die Aufschnittdeckung, und Lang- schnittpfanne
schnittpfannen, welche
die Vorschnittdeckung
ergeben, ihr Deckbild un-
terscheidet sich optisch.
(Abb. 11)
Abb. 9 Zwei Ausführungen des Krempziegels mit gerader
und gestufter Krempe Mit dem Rauten-
ziegel, später allgemein
Der Flachziegel, heute allgemein als Biber- Herzziegel genannt, der
schwanzziegel oder kurz Biber bezeichnet, entstand den Gebrüdern Gilar-
gegen Ende des 11. Jahrhunderts. Die ältesten Formen doni in Altkirch/Elsaß
waren gerade und hatten eine durchgehende Aufhän- 1841 patentiert wurde,
geleiste. Zu Beginn des 12. Jahrhunderts entstanden in entstand eine völlig neue
10 Restaurator im Handwerk | 4/2018 | Deutschland und die europäische Baukultur – Teil 2Abb. 12 Die drei ersten Falzziegelformen, von entscheidend für die Entwicklung der deutschen
oben: Rauten- oder Herzziegel, Pariser Falzziegel
und Elsässer Falzziegel Dachziegelindustrie. (Abb. 13)
Nachdem der Falzziegel eingeführt war und
Dachziegelart, die nicht mehr von Hand ge- die Vorteile der Verfalzung offensichtlich geworden
fertigt werden konnte. Dieses Falzziegelmo- waren, begann man auch die alten historischen Mo-
dell bildete mit dem später hinzugekommenen delle unter Wahrung ihres äußeren Erscheinungsbil-
Pariser Falzziegel und dem Elsässer Falzziegel des zu verfalzen. (Abb. 14)
die Basis für die Einführung und Weiterent-
wicklung des Falzziegels. (Abb. 12)
Mit dem Muldenfalzziegel Z1, der 1881
patentiert wurde, gelang Wilhelm Ludowici in
Jockgrim/Pfalz eine entscheidende Verbesse-
rung des Herzziegels. Durch den patentierten
Stufenfalz des Z1 entstand ein Verfalzungsla-
byrinth, das gegen Wasser, Staub und Schnee
dicht abschloss. Dieses Falzziegelmodell war
Abb. 13 Der Doppelmuldenfalzziegel Z1
Abb. 14 Die Verfalzung historischer Ziegelformen. In Klammern: Angabe der Urform
A n zei g e
Restaurator im Handwerk | 4/2018 | Deutschland und die europäische Baukultur – Teil 2 11In der Zeit des Historismus, der bis etwa bis 1910
dauerte, entstand etwa ab 1870 eine für die Architek-
tur der damaligen Zeit prägende Dachziegelform, der
Villenziegel oder Villenfalzziegel, der – wie der Name
schon sagt – vorwiegend für Villen und repräsentative
Bauten verwendet wurde. (Abb. 15)
Die meist gerundeten oder abgeschrägten Fußen-
den und die stark profilierten Oberflächen mit aufge-
pressten Zierprofilen in Kugel, Stern- oder Kreuzform
gaben dieser Dachziegelart ihr charakteristisches
Aussehen und weisen sie unverkennbar als Schmuck-
ziegel aus.
Dazu hatten die Bauherren eine reiche Auswahl
an Schmuck-Sonderziegeln für den schmückenden
Dekor, die sich in ihrer Ornamentik an der Antike
und vorausgegangenen Stilen ausrichteten. (Abb. 16)
Der große Erfolg der Falzziegel einerseits und ihre
schwierige und kostspielige Herstellung auf Revolver- Abb. 15
Auswahl von Villenziegeln aus Deutschland, Frankreich und Holland
pressen andererseits ließen die Idee entstehen, verfalz-
te Ziegel kostengünstiger auf Schneckenpressen her- besitzen Strangfalzziegel nur eine Seitenverfalzung
zustellen. Als erster entwickelte Jakob Schmidheiny und keine Kopfverfalzung. (Abb. 17)
1878 einen Strangfalzziegel, versäumte es aber, ihn Mit der Flachdachpfanne Z15a kam 1930 eine
patentieren zu lassen. Dies tat 1883 Johann Stadler völlig neue Dachziegelgeneration auf den Markt, die
mit seinem Modell, das dadurch auch als erstes all- bis 1954 den Stand der Verfalzungstechnik darstell-
gemein bekannt wurde. Bis 1895 entstanden zahl- te und mit einer Ringverfalzung erstmals eine regen-
reiche Strangfalzziegelmodelle. Herstellungsbedingt sichere Eindeckung flach geneigter Dächer bis etwa
Abb. 16
Auswahl von
Schmuckziegeln:
1. an der Traufe,
2. auf dem First,
3. am Firstende,
4. am Giebelort-
gang, 5. an den
Graten, 6. am
Anfallpunkt, 7. in
der Dachfläche,
8. für Türmchen
und Erker
RESTAURATOR IM HANDWERK JETZT AUCH ALS ePAPER ! !
Die Zeitschrift Restaurator im Handwerk ist auch als elektronische Ausgabe (ePaper im PDF-Format) erhältlich. Sie
können einzelne Ausgaben (auch die in der Print-Version bereits vergriffenen Hefte ! !) zum Preis von 6 Euro oder ein
Jahresabonnement zum Preis von 24 Euro für vier Ausgaben bestellen.
Einzelhefte oder auch ein Jahresabonnement bestellen Sie bitte per E-Mail bei:
redaktion@restaurator-im-handwerk.eu.
Sie erhalten nach Zahlungseingang die entsprechende Ausgabe als ePaper-Ausgabe (Dateigröße ca. 10 MB) per E-Mail.
Bei einem Jahres-Abonnement wird Ihnen die jeweils aktuelle Ausgabe automatisch zum Erscheinungstermin per E-Mail zugesandt.
12 Restaurator im Handwerk | 4/2018 | Deutschland und die europäische Baukultur – Teil 2Abb. 18
Flachdachpfanne
Z15
schen Bevölkerung nur der Ausdruck für Dachziegel
= tegula als Allgemeinbegriff (Lehnwort) in unsere
Sprache übernommen wurde. Da in Germanien wei-
terhin die Stroh- und Schindeldeckung üblich blieb,
wurde der Name tegula auch für den Mauerziegel (ei-
gentlich later) verwendet.
Von tegula entwickelten sich im rheinischen und
Abb. 17 15° ermöglichte. Ursächlich für die Entwicklung der südwestlichen Deutschland viele wechselnde Formen
Auswahl an Flachdachpfanne waren die Architekturströmun- wie zegal, zigal, zigil, zeagal, ziegal, ziogal. Mit dem
Strangfalzziegel-
modellen gen des Bauhauses Dessau, die das Flachdach propa- Ziegelbau verbreitete sich das Lehnwort auch nach
gierten und einen starken Trend zum flachgeneigten Norden und Osten mit Formen wie tieglo, tiegla, tigol,
Dach bewirkten. (Abb. 18) tigele, tigl. Hieraus kam es dann über niederdeutsch
tegel und althochdeutsch ziagala zu mittelhochdeutsch
Europäische Sprachverwandtschaft des Ziegel- und neuhochdeutsch ziegel.
namens Weil beim Gebrauch des Wortes für den Mauer-
Aus dem Lateinischen entstanden die romanischen ziegel das heimische stein vorschwebte, kam es auch
Sprachen Französisch, Italienisch, Spanisch, Portu- zu der Zusammensetzung ziagaslstein = Ziegelstein.
giesisch und Rumänisch. In den germanischen und Schließlich entstanden auch die Zusammensetzungen
slawischen Sprachen finden sich viele lateinische „Dachziegel“ und „Mauerziegel“.
Lehnwörter. So ist es nicht verwunderlich, dass auch
die Namen des Dachziegels in vielen europäischen A nzeige
Sprachen den gleichen Ursprung haben und so mitei-
nander verwandt sind.
Die Römer bezeichneten ihren Dachziegel mit
dem lateinischen Wort tegula (zu tegere = (be)decken).
Das war der römische Leistenziegel und der die Stoß-
fugen von zwei nebeneinander liegenden Flachzie-
geln überdeckende Hohlziegel, der Imbrex (lat. imber,
griech. ombros = Regen, d. h. Imbrex = Hohlziegel zur
Ableitung des Regenwassers).
Der Mauerziegel wurde als Later bezeichnet.
Die Römer wurden, soweit es das Abendland be-
trifft, zu Lehrmeistern in Sachen Ziegel, denn über-
all, wohin sie ihre Eroberungsfeldzüge hinführten,
brachten sie neben dem Wissen um den Ziegel und
seine Herstellung auch seinen Namen mit. Und so
kam auch der Name tegula in die besetzten Gebiete,
wo sich seine weitere Entwicklung ganz individuell
gestaltete.
In Germanien stellten die Römer sowohl Mauer-
als auch Dachziegel her, verwendeten aber den Mau-
erziegel weit weniger als den Dachziegel. Während
die Gebäude und Wachtürme der Kastelle meist aus
Holz errichtet wurden, verwendete man für die Dä-
cher vorzugsweise Dachziegel. Das hatte ganz prakti-
sche Gründe, da die hart gedeckten Dächer durch die
Brandpfeile der immer wieder anstürmenden Germa-
nen nicht entzündet werden konnten.
Die Dachziegelherstellung war also vorherr-
schend, und so kam es, dass innerhalb der germani-
Restaurator im Handwerk | 4/2018 | Deutschland und die europäische Baukultur – Teil 2 13Zur Herkunft der der beiden altgermanischen Die englische und die französische Bezeichnung
Wörter dach und mauer ist folgendes zu sagen: dach für den Mauerziegel, brick und brique, sind aus dem
liegt die indogermanische Wurzel teg = „decken“ zu- lateinischen imbrex abgeleitet (also auch einem Dach-
grunde, von der auch das lateinische tegere = „bede- ziegel), während aus dem lateinischen Mauerziegel
cken“ abstammt, und es bedeutet somit eigentlich later mit laterizo die italienische und mit ladrillo die
„das Deckende“, während mauer von dem lateinischen spanische Bezeichnung des Mauerziegels abgeleitet
Wort murus kommt, denn die Germanen lernten erst sind.
durch die Römer den Steinbau kennen. Das entspre- Ziegel bedeutet vom Ursprung her also den Dach-
chende alte deutsche Wort ist wand und stammt von ziegel, während man im allgemeinen Sprachgebrauch
der als Flechtwerk mit Lehmbewurf gewundenen heute sowohl den Mauerziegel als auch den Dachzie-
Wand, also von winden. gel versteht. Allerdings bestehen bzw. bestanden re-
Zu welchen Namen der Begriff Tegula in den ein- gionale Unterschiede: In Norddeutschland versteht
zelnen europäischen Ländern führte, zeigt die fol- man unter Ziegel gleichermaßen beide Produkte, in
gende Übersicht. Süddeutschland und vor allem in der Schweiz nur
den Dachziegel, während der Mauerziegel als Back-
Aus dem latei-
nischen Stamm- Tigele Altenglisch stein bezeichnet wird. Mit der zunehmenden Freizü-
wort „Tegula“ Roof tile Englisch gigkeit der Menschen haben sich diese sprachlichen
abgeleitete Tiili Finnisch Unterschiede (außer in der Schweiz) mehr und mehr
Dachziegelnamen
Tuile Französisch verwischt.
Tegola Italienisch
Tegel Niederländisch Ausblick
Telho Portugiesisch Der vor über zweitausend Jahren entstandene Dach-
Tigla Rumänisch ziegel, also lange bevor es die europäischen Staaten
Teja Spanisch in ihrer heutigen Form gab, ist immer noch hoch-
Dachziegel Deutsch aktuell. Dank seiner hervorragenden bauphysikali-
Ziegel Schweizer-Deutsch schen Eigenschaften trägt er - wie eh und je - als
Dachhaut des geneigten Daches zur Erfüllung eines
A nzeige
14 Restaurator im Handwerk | 4/2018 | Deutschland und die europäische Baukultur – Teil 2Literatur
Willi Bender: Along with them came civilization – Mit ihm
kam die Zivilisation, in: Brick/Ziegel – Yearbook/Jahrbuch
2016 Gütersloh, S. 58-81.
Willi Bender: Lexikon der Ziegel, Wiesbaden und Ber-
lin, 1995, vergriffen, aber im Internet im Dachziegelarchiv
(www.dachziegelarchiv.de) komplett einsehbar und wird
dort auch laufend ergänzt.
Willi Bender: Vom Leistenziegel zur Flachdachpfanne – die
Entwicklung des Tondachziegels in Deutschland von 43
n. Chr. bis 1930, in: Restaurator im Handwerk, Ausgabe
1/2011, S. 5.11
Willi Bender: Vom Ziegelgott zum Industrieelektroniker,
Bonn 2004
Willi Bender und Mila Schrader: Dachziegel als historisches
Baumaterial, Suderburg-Hösseringen 1999
Bildnachweis
Abb. 1: Dipl.-Ing. Anett Fischer, Gütersloh
Abb 2: Aus Willi Bender und Mila Schrader: Dachziegel
als historisches Baumaterial, Suderburg-Hösseringen 1999
Abb. 10, 14, 15, 16, 17, 19: Siegfried Müller, Buchholz
(Dachziegelarchiv)
Alle übrigen Abbildungen: Archiv des Verfassers
A nzeige
Abb. 19 Grundbedürfnisses des Menschen bei: dem Wohnen.
Die aktuelle
Ziegelmodell-
Seine Vielfalt an Formen und Farben bietet den Ar-
palette der chitekten eine unerschöpfliche Fülle von individuel-
deutschen len Gestaltungsmöglichkeiten, ganz im Gegensatz
Dachziegelin-
zu dem monotonen, dazu technisch noch problemati-
dustrie
schen Flachdach. Abb. 19 zeigt die 15 aktuellen Dach-
ziegelarten, die derzeit von der deutschen Dachziegel-
industrie angeboten werden. Fast alle Dachziegelarten
werden in verschiedenen firmenspezifischen Model-
len angeboten, dazu jeweils in den verschiedensten
Farben und Farbtönungen, naturrot, engobiert, gla-
siert und gedämpft. In ähnlicher Weise haben fast alle
europäischen Länder ihre eigene landestypische Mo-
dellpalette. Das bedeutet - der Dachziegel lebt und
wird auch in Zukunft das Gesicht unserer europäi-
schen Dachlandschaften mit prägen.
WILLI BENDER
war als Ziegelei-Ingenieur viele Jahre mit der Planung von
Ziegelei-Anlagen befasst. Er ist außerdem Autor zahlrei-
cher Publikationen zum Thema Ziegel.
Restaurator im Handwerk | 4/2018 | Deutschland und die europäische Baukultur – Teil 2 15Vereinsmitteilungen • Mitgliederservice • Nachrichten
Landesgruppe Nord
Treffen auf der Messe denkmal Leipzig natürlich auch die von den anderen Landes-
Unsere Landesgruppe hatte in Leipzig die gruppen. Auf unserem Stand war eine sehr
Verantwortung für die Aktionsfläche auf der gute Stimmung, alle haben Hand in Hand
Messe denkmal. Auf unserem mehr als 260 gearbeitet, und ich denke, wir konnten den
m² großen Gesamtstand der Restauratoren Besuchern ein gutes Bild von uns Restaura-
im Handwerk, ARGE, Fortbildungszent- toren mitgeben. Trotz der vielen Worte und
ren und unserer Zeitschrift hatten wir eine der zahlreichen Besucher hat es viel Spaß
etwa 40 m² große Fläche zu bespielen. Dirk gemacht und die Verbundenheit innerhalb
Zeyher als Schmied arbeitete an einer Kirch- der Landesgruppe gestärkt. Dazu trug auch
turmkugel, Astrid Boeck und Wolfgang Ner- der Abend der Restauratoren bei, an dem
ge als Raumausstatter hatten je einen histori- wir einen Tisch belegten und mit den Neu-
schen Polstersessel zum Bearbeiten, Stefanie mitgliedern warm wurden und sie in unsere
Schönlau als Kunstglaserin restaurierte eine Gemeinschaft aufnahmen. Von 5 diesjähri-
Bleiverglasung, Alex Kuhn als Tischler po- gen Neumitgliedern waren 4 auf der Messe,
lierte mit Schellack edle Holzkästchen, Irme- und 3 haben Standdienst gemacht. Nochmals
la Wrede und Marc Dettman als Tischler/in herzlich willkommen bei uns und ganz herz-
entlackten eine Zimmertür, und Klaus Struve lichen Dank an alle, die sich so sehr einge-
stellte Teile seiner Sammlung alter Lampen, bracht haben. Unser nächstes Treffen findet
Türdrücker und Thonetmöbel aus. Meistens am 16.2.2019 in Hannover statt.
war eine Traube von Messebesuchern um uns
herum, die uns über die Schulter guckten und Ansprechpartnerin:
viele, nein sehr viele Fragen stellten. Dafür Irmela Wrede
waren wir da, diesen Wissensdurst zu stillen. Tel./Fax: 05333 285; 05333 90814
Von den druckfrischen Mitgliederver- 0171 8024138
zeichnissen haben wir ungezählte verteilt, post@ebenholz-restaurierung.de
Landesgruppe Rheinland-Pfalz / Hessen / Saarland
Unser 3. Landesgruppentreffen in diesem verfassten Werke, entsprechend umgesetzt Baustelle ist. Hier konnten wir kurzen Ein-
Jahr fand am 13.10.2018 auf der Propstei werden können. blick in den Arbeitsbereich der Stuckateure
Johannesberg in Fulda statt. Es wurde zu- Die Initiative zur Gründung der Schulsied- bekommen, die im 1. OG eine prunkvolle
sammen mit der „Arbeitsgruppe der Restau- lung ging von den beiden Leiterinnen des Stuckdecke nach Originalvorlage rekonst-
ratoren im Handwerk“, geleitet von Gerwin „Seminars für klassische Gymnastik“ Hed- ruierten. Geschätzte 20.000 Arbeitsstunden
Stein, ausgerichtet. wig von Rohden und Louise Langgaard aus. sind allein für diese Arbeit nötig. Herzlichen
Nach der morgendlichen Sitzung fuhren Beide haben ihre letzte Ruhestätte auf dem Dank an dieser Stelle an Oliver Körner, dass
wir zum Gelände „Loheland“ bei Künzell Friedhof in Loheland. er sich für uns Zeit genommen hat!
und wurden dort von einer fachkundi- Besprechnungspunkte unserer morgendli- Im Anschluss gingen wir gemeinsam zum
gen Dame über das Gelände geführt. Die chen Sitzung waren unter anderem: Mittagessen, wo noch ein anregender Aus-
Loheland-Stiftung ist ein gemeinnütziger - Neues Mitgliederverzeichnis 2019 tausch untereinander stattfand. Bei einem
Bildungsträger mit Einrichtungen im schu- - Messestand „Denkmal“ in Leipzig „Eppler“ liessen wir den Tag ausklingen in
lischen, schulergänzenden und außerschu- - Vorschläge für LG-Treffen 2019 Vorfreude auf unser nächstes gemeinsames
lischen Bereich und mit einem besonderen Ich bedanke mich an dieser Stelle ganz Treffen 2019.
pädagogischen Profil. Sie umfasst einen Wal- herzlich bei Gerwin Stein für die tolle Or- Da sich das Jahr bereits den Ende neigt,
dorfkindergarten, eine Waldorfschule (Ru- ganisation! wünsche ich allen frohe Weihnachten und
dolf-Steiner-Schule) und eine Akademie für Am Samstag, den 3.11.2019, traffen wir einen guten Rutsch ins neue Jahr 2019! Ich
Aus-und Weiterbildung. Ein Tagungshotel uns in Frankfurt „Am Römer“, gemeinsam freue mich auf weiterhin tolle Treffen und
„Wiesenhaus“ mit Mensa und ein Laden mit mit der Landesgruppe Hessen des VDR. gute, erfolgreiche Zusammenarbeit
Café sind ebenfalls auf dem Gelände angesie- Wir freuten uns, die neue Leiterin Elisa-
delt. Die Produktion mit biologisch-dynami- beth Ursprung kennenlernen zu dürfen, die Ansprechpartnerin:
scher Landwirtschaft, Forstwirtschaft, eine Anne Harmssen Anfang des Jahres abge- Linda Wadewitz
Gärtnerei und eine Schreinerei integrieren löst hat. Unser Mitglied Oliver Körner, der Tel: 06734 5589025, 0157 37525149
das Handwerk, so dass die in der Verfassung auch auf der Baustelle Am Römer an und in l.wadewitz@restaurator-im-handwerk.de
formulierten Grundlagen der Arbeit der Stif- verschiedenen Gebäuden tätig war, erzählte
tung, nämlich die Schulung der Bewegung, zur Ergänzung der Führung noch diverse Die Landesgruppe goes Facebook:
elementare Erfahrungen in Handwerk und Einzelheiten und verschaffte uns noch Zu- www.facebook.com/restauratorimhandwerk.de
im Landbau sowie die von Rudolf Steiner gang zur „Goldenen Waage“, die derzeit noch
82 Restaurator im Handwerk | 4/2018 | Deutschland und die europäische Baukultur – Teil 2Vereinsmitteilungen • Mitgliederservice • Nachrichten
Landesgruppe Wir arbeiten gerade an … – aktuelle Projekte unserer Mitglieder
Bayern / Baden-Württemberg
Für 2019 folgende Aktivitäten in Planung:
• Diverse Messeauftritte;
• Exkursionen mit dem VdR.
Das nächste Landesgruppentreffen soll im
Februar oder März 2019 im Bauarchiv Thier-
haupten stattfinden.
Aufruf: Die Mitglieder werden gebeten,
Vorschläge für Referenten und Vorträge so- Rekonstruktion von Möbelgriffen
wie Arbeitsberichte an Günter Höck zu sen- Für Möbel im Sanatorium Dr. Barner in
den. Braunlage haben wir nach Vorlage der Ori-
ginale 2 mal 10 Möbelgriffe aus Horrn
rekonstruiert.
Ansprechpartner:
Ehemaliger Färberturm, Schäfflerbachstra-
Günter Höck Wolfgang Dambacher ße 26, Augsburg
Tel./Fax: 0821 402929/-404029 AMB Dambacher GmbH Der Augsburger Färberturm ist aus verschie-
bay-bw@restaurator-im-handwerk.de Werkstatt für Möbelrestaurierung und denen Gründen ein schützenswertes Denk-
Baudenkmalpflege mal. Er ist als gebaute Erinnerung an die
Landesgruppe Waldemar Str. 24, 10999 Berlin handwerkliche Tuchbearbeitung und natür-
030-614 70 18 liche Tuchtrocknung aus Zeiten des Booms
Berlin/Brandenburg
w.dambacher@freenet.de der Textilindustrie in Augsburg zu verste-
www.amb-werkstatt.de hen. Zu dieser Zeit gab es in Augsburg viele
Ansprechpartner: solcher Türme, jedoch ist der Färberturm
Sebastian Rost, Tel.: 030 4859528 auf dem ehemaligen Gelände der Augsbur-
mail@sebastian-rost.de ger Kammgarnspinnerei der einzig erhaltene
Johannes Schroeter-Behrens seiner Art in Augsburg.
schroeter-behrens@sebastian-rost.de Außerdem ist der 1760 errichtete Färber-
turm durch seine – trotz zahlreicher Um-
nutzungen in der zweiten Hälfte des 19.
Landesgruppe Sachsen Jahrhunderts – gut erhaltene Originalkons-
truktion und Substanz ein Zeugnis für eine
Ansprechpartner: noch vorindustrielle Technologie, von der es
Robert Bialek, Tel.: 0351 8382891 nicht mehr viele Beispiele gibt.
baugeschaeft_bialek@web.de Im Juli 2013 beschloss der Bauausschuss
Augsburg, den 17 m hohen Turm nach
einem Brand im Dachstuhl zu sanieren. Die
Landesgruppe Barockes Wohnhaus, Mauerstraße 17, Arbeiten wurden 2016 aufgenommen. Im
Nordrhein-Westfalen Beelitz Inneren sah die Sanierung eine Maßnah-
Das barocke Wohnhaus befindet sich im his- me nach dem „Haus-in-Haus-Konzept“ vor,
Ansprechpartner: torischen Altstadtkern auf dem Verlauf der wobei die äußere Hülle erhalten blieb, wäh-
ehemaligen Stadtbefestigung und gehört zur
Karl-Heinz Gradert rend innen ein separates, beheizbares Haus
ersten Stadterweiterung des 18. Jahrhun- entstand. Dadurch bekam die Bürgeraktion
05222 989323; 0172 5251400 derts auf den ehemaligen Wallanlagen. Die
fam.gradert@gmx.de Textilviertel eine Unterkunft, die das His-
Fenster und Eingangstür des 1751 errichte- torische mit dem Modernen verbindet. Die
ten verputzten Fachwerkhauses wurden vor Bürgeraktion sieht vor, hier einen Treffpunkt
Landesgruppe der Neufassung auf ihre historische Farbfas- für Handarbeit einzurichten, wo auch hand-
Thüringen / Sachsen-Anhalt sung untersucht. Die Eingangstür stammt arbeitliche Kurse gegeben werden. Weiter-
aus einem anderen Objekt und wurde ver- hin soll der Turm zum Bürgerhaus werden,
mutlich um 1800 eingebaut. Befundet wurde in dem Veranstaltungen wie Ausstellungen,
Ansprechpartnerinnen:
als Erstfassung ein naturbelassenes Holz mit Lesenachmittage oder Vorträge stattfinden.
Constance Schröder rötlich-braunem Lasuranstrich mit lackierter Der Färberturm hat von außen betrachtet
Tel.: 036783 70352, 0170 8015817 Oberfläche. In Abstimmung mit den Denk- einen rechteckig gemauerten Sockel mit den
Kirchenmalerin@yahoo.de malschutzbehörden wurde darauf auf bauend Maßen 10 x 7 m und einer Höhe von 2,5 m.
Julia Nagel, Tel.: 09543 418869 eine Fassung gewählt, die mit der ockerfar- Darauf sitzt ein zweigeschossiger Holzauf-
info@atelier-nagel.de benen Fassade ein stimmiges Ganzes ergibt. bau, der von einem weit ausladenden Walm-
dach gekrönt ist. Die Sanierung der Außen-
Jens Dornbusch bauteile ist derzeit in Arbeit.
Meister und Restaurator im Malerhandwerk
pigmentum – Malerei und Restaurierung Günter Höck, Stuckgeschäft, Werkstätte für
Edelstraße 3, 14547 Beelitz Restaurierungen
033204-383276, 0173-60 41 605 Meringer Straße 136, 86163 Augsburg
pigmentum@pigmentum-restaurierung.de Tel./Fax: 0821-40 29 29/-40 40 29
www.pigmentum-restaurierung.de info@stuck-hoeck.de, www.stuck-hoeck.de
Restaurator im Handwerk | 4/2018 | Deutschland und die europäische Baukultur – Teil 2 83Vereinsmitteilungen • Mitgliederservice • Nachrichten
Wir arbeiten gerade an … – aktuelle Projekte unserer Mitglieder
Evangelischer Jugendhof Sachsenhain, Die vorhandene Bleiverglasung ist zum Teil Metallrestaurierung und Neufassung der
Verden-Dauelsen nachzulöten, und gesprungene Scheiben sind Stahlfenster des Pferdestalls, Gebäudeen-
Die Evangelisch-lutherische Landeskirche zu ersetzen. Alle Fenster und Türen erhalten semble Gut Freiham
Hannovers beauftragte die Restaurierung einen neuen Anstrich. Im westlichen Münchner Stadtteil Aubing
von Fenstern in Gebäudeteilen aus dem Jahre liegt das unter Denkmalschutz stehende Gut
1934. Im Jahre 1934 wurde in Dauelsen der Tischlerarbeiten: Freiham. Als Gesamtensemble besteht das
Grundstein für den sogenannten „Sach- Tischlermeister Hans-Jörg Böde, Restaurator im Gut aus mehreren Gebäuden. Im zentralen
senhain“ gelegt, die nationalsozialistische Tischlerhandwerk, Springbarg 12, 29482 Küs- Bereich befindet sich der historische Pferde-
Reichsführung plante hier eine „Thing-Ge- ten, 05841-1866, h-jboede@web.de stall als Einzeldenkmal.
denkstätte“, Im Süden gibt es zwei Kanzeln, Im Zuge der gesamten denkmalgerech-
die auf eine große Wiese, den sogenannten Tischlermeisterin Irmela Wrede, Fa. „Eben- ten Sanierung des Gutes soll der Pferde-
Thingplatz, ausgerichtet sind. Einen wirk- holz“, Restauratorin im Tischlerhandwerk, stall wieder als solcher nutzbar gemacht und
lichen Thing hat es an dieser Stelle nie ge- Dorfstr. 2, 38173 Mönchevahlberg bei Wolfen- seine Fenster restauriert werden. Es han-
geben. Im Norden der Anlage wurden fünf büttel, 05333-285, www.ebenholz-restaurie- delt sich hierbei um 10 Stahlrahmenfenster
alte niedersächsische Fachwerkhäuser (dar- rung.de mit Klappflügel, Rundbogenabschluss und
unter der Zehnthof des Herzogs Christian Einscheibenverglasung.
von Wolfenbüttel), die nach ihrem Abbruch Glaserarbeiten: Der Leistungsumfang beinhaltet Entschich-
an anderen Orten restauriert worden waren, Kunstglasermeisterin Stefanie Schönlau, Fa. „ ten durch Partikelstrahlen, metallrestaurato-
wieder aufgebaut. glas in form“, Rampenstr. 16, 30449 Hanno- rische Maßnahmen, glaserhaltenden Ausbau
Nachdem in den Jahren nach dem 2. Welt- ver, 0511-2103637, www.glas.in-form.de und Wiedereinbau der historischen Glas-
krieg hier Vertriebene untergebracht waren, scheiben bzw. Neuverglasung mit Einfach-
nutzt seit 1950 die Landeskirche das Objekt Malerarbeiten: gläsern bei beschädigten Scheiben sowie die
als Tagungsstätte. Malermeister Thorsten Neidhardt, Restaurator Neubeschichtung nach Befund auf Leinöl-
Die Restaurierung in den Unterkunftsge- im Malerhandwerk, Allerkamp 10, 29556 Böd- basis inklusive Rostschutz.
bäuden an Fenstern und Türen umfasst die denstedt, www.maler-neidhardt.de
Sanierung der Blendrahmen, Flügel und RSP GmbH Restaurierung und Denkmalpflege
Glasscheiben. Um eine energetische Ver- Geschäftsführung: Hayo Ross/Michael Schmidt
besserung zu erreichen, sind Nuten in die St.-Georg-Straße 3, 85649 Kirchstockach
Blendrahmen zu fräsen und Schlauchdich- Tel./Fax: 08102-99489-10/99489-20
tungen einzuziehen. Zusätzlich werden von ross@kulturgut-restaurierung.de
innen 4 mm-Glasscheiben angebraucht. schmidt@kulturgut-restaurierung.de
www.kulturgut-restaurierung.de
RESTAURATOR IM HANDWERK JETZT AUCH ALS ePAPER ! !
Die Zeitschrift Restaurator im Handwerk ist auch als elektronische Ausgabe (ePaper im PDF-Format) erhältlich. Sie
können einzelne Ausgaben (auch die in der Print-Version bereits vergriffenen Hefte ! !) zum Preis von 6 Euro oder ein
Jahresabonnement zum Preis von 24 Euro für vier Ausgaben bestellen.
Einzelhefte oder auch ein Jahresabonnement bestellen Sie bitte per E-Mail bei:
redaktion@restaurator-im-handwerk.eu.
Sie erhalten nach Zahlungseingang die entsprechende Ausgabe als ePaper-Ausgabe (Dateigröße ca. 10 MB) per E-Mail.
Bei einem Jahres-Abonnement wird Ihnen die jeweils aktuelle Ausgabe automatisch zum Erscheinungstermin per E-Mail zugesandt.
84 Restaurator im Handwerk | 4/2018 | Deutschland und die europäische Baukultur – Teil 2Vereinsmitteilungen • Mitgliederservice • Nachrichten
Wir arbeiten gerade an … Verkaufen Gesucht
Großes
Bücherregal
Die Redaktion sucht ein großes Bücher-
regal für das Redaktionsbüro.
Länge maximal: 4,20 m
PROPOLIS Höhe maximal: 2,50 m
Wachse
Harze Angebote an:
Grund- und Realschule Grandlstraße, Mün- Öle
chen Obermenzing Pigmente Redaktion Restaurator im Handwerk
Im Zuge des Neubaus bzw. der Sanierung Lackrohstoffe uvm., Gierkeplatz 9 • 10585 Berlin
des gesamten Gebäudekomplexes erfolgt die
Tel.: 030 63963049 • Fax: 030 3482356
Überarbeitung der Bestandsfenster im Alt-
bau von 1911. Material für Handwerk, Kunst und redaktion@restaurator-im-handwerk.eu
Der Auftrag unterteilt sich in die holztech- Restaurierung, seit 1982 in
nische Instandsetzung der bestehenden Berlin-Kreuzberg, Oranienstr. 19a.,
Kastenfensteranlagen inklusive Beschlags-, Tel.: 030 6152464,
Maler- und Verglasungsarbeiten mit Ver- kontakt@propolis-farben.de,
besserung der Wärmedämmung und in den www.propolis-farben.de
Neu- und Einbau von Kastenfenster ana-
log dem historischen Bestand in Form und
Farbe. Marktplatz: Formate und Preise
Festpreis für das Anzeigenfeld (H 110 mm x B 58 mm): 50 Euro zzgl. Mwst. • Anzeigenvari-
anten: Text mit Foto (ca. 700 Zeichen bei Foto im Querformat (58 x 36 mm) oder ca. 500
RSP GmbH Restaurierung und Denkmalpflege Zeichen bei Foto im Hochformat (36 x 56 mm)) • Text ohne Foto: ca. 1000 Zeichen. • Für
Geschäftsführung: Hayo Ross/Michael Schmidt jede zusätzliche Zeilen erheben wir einen Preisaufschlag von 5% des Festpreises (eine Zeile
St.-Georg-Straße 3, 85649 Kirchstockach hat ca. 40 Zeichen).
Tel./Fax: 08102-99489-10/99489-20 Für Mitglieder der Bundesvereinigung Restaurator im Handwerk e. V. ist dieser Service
ross@kulturgut-restaurierung.de kostenlos !
schmidt@kulturgut-restaurierung.de
www.kulturgut-restaurierung.de
Aus der Redaktion A nzeige
Für die nächsten Ausgaben der Zeit- Wer zu den Themen etwas beitragen möch-
schrift sind folgende Schwerpunkte te und/oder dazu in der Praxis Erfahrungen
geplant: gemacht hat, wende sich bitte an die Redak-
tion.
• 1/2019 – Werkberichte
(verantwortlich JOM) Redaktion Restaurator im Handwerk
Redaktionsschluss: 28.1.2019 Gierkeplatz 9 • 10585 Berlin
Tel.: 030 63963049 • Fax: 030 3482356
• 2/2019 – Straßenmöbel redaktion@restaurator-im-handwerk.eu
(verantwortlich AR)
Redaktionsschluss: 29.4.2019
• 3/2019 – Fußböden
(verantwortlich WD)
Redaktionsschluss: 29.7.2019
•4/2019 – Raumausstattung
(verantwortlich JOM/WD)
Redaktionsschluss: 21.10.2019
Stand auf der denkmal2018
Restaurator im Handwerk | 4/2018 | Deutschland und die europäische Baukultur – Teil 2 85Vereinsmitteilungen • Mitgliederservice • Nachrichten
Neue Mitglieder stellen sich vor
Neue Mitglieder stellen sich vor
Es freut mich sehr, seit November dieses Jah- Der Schwerpunkt meinerTätigkeiten liegt aber
res in der Vereinigung Restaurator im Hand- nicht nur in der modernen Raumgestaltung, son-
werk e.V. Mitglied zu sein. dern auch in dem Erhalten alter Traditionen, wie
Vor über dreißig Jahren habe ich eine Aus- dem Restaurieren historischer Kunstverglasungen,
bildung zur Kunstglaserin und anschließend der Konservierung und der Rekonstruktion. Die
das Fachabitur für Gestaltung an der Glas- Sanierung der Kunstverglasungen und Glasgemäl-
fachschule Rheinbach absolviert. Während de erfolgt zudem unter dem Aspekt der heutigen
einer langjährigen Anstellung als Leite- technischen Anforderungen.
rin der Kunstglaserei eines Glasbetriebes in Meine Auftraggeber sind Privatpersonen sowie öf-
Hannover erlangte ich nebenberuflich den fentliche Institutionen.
Meistertitel. Im Jahr 2012 erhielt ich für die Tätigkeit an einem
Seit 1999 bin ich selbständig tätig mit eige- denkmalgeschützten Objekt den Bundespreis für
nem Atelier. das Handwerk in der Denkmalpflege.
Meine handwerkliche Arbeit beinhaltet die
verschiedensten Formen der Veredelung und
Bearbeitung von Flach- und Hohlglas. Sie
umfasst das breite Spektrum der Glasverede-
lungstechniken Bleiverglasung, Glasmalerei,
Mosaik, Glasverklebung, Glasverschmelzung
und Verformung (Fusing) sowie das Sand-
strahlen auf Glas.
Oft werden diese Techniken in einem Werk-
stück kombiniert, teilweise auch in Verbin-
dung mit anderen Werkstoffen. Die Ge-
staltung von Fenstern, Türen, Raumteilern,
Spiegeln, Fensterbildern, Wappenscheiben,
Glasobjekten, Kleinmöbeln und Wohnacces-
soires wird durch meine individuelle Kun-
denberatung und Entwurfsanfertigung der
Architektur und Inneneinrichtung angepasst.
86 Restaurator im Handwerk | 4/2018 | Deutschland und die europäische Baukultur – Teil 2Vereinsmitteilungen • Mitgliederservice • Nachrichten
Abschlussbericht: denkmal und MUTEC ernten enormen Zuspruch
Gestiegene Qualität, starke Impulse und Qualität und Internationalität zum Europäischen Kulturerbejahr – eine Zu-
Europäisches Kulturerbejahr: große Eupho- Von allen Beteiligten wurden die erneut sammenarbeit, von der beide Seiten profitier-
rie auf der europäischen Leitmesse denkmal gestiegene Qualität und Internationalität ten. Erfolgreiche Projekte wurden aus- und
Überaus erfolgreich und mit 14.200 Besu- gelobt. Branchenexperten aus ganz Europa vorgestellt und im SHARING HERITA-
chern endeten am 10. November 2018 die 13. kamen zusammen, um sich über die neuesten GE-Forum herrschte über die gesamte Mes-
Auflage der europäischen Leitmesse denkmal Entwicklungen zu informieren und auszutau- selaufzeit großer Besucherandrang.
und die parallel stattfindende internationale schen. Unternehmen nutzten die denkmal für „Auf der diesjährigen denkmal herrschte
Fachmesse MUTEC. „Mit einem enormen neue Geschäftskontakte und internationale eine überaus positive Stimmung und dynami-
Zuspruch von Ausstellern, Besuchern und Kooperationsanbahnungen. Handwerksbe- sche Atmosphäre, die sich durch die gesam-
Experten aus dem In- und Ausland konnte triebe und Institutionen der Denkmalpflege te Messe zog und über die gesamte Laufzeit
die denkmal ihre Stellung als europäische und Restaurierung stießen mit ihrem Fokus erstreckte. Die Messe ermöglichte nicht nur
Leitmesse in diesem Jahr weiter ausbauen. der Nachwuchsgewinnung auf fruchtbaren den fachlichen Austausch zwischen Exper-
Sie ist zweifellos der fachliche Dreh- und Boden. „Die denkmal genießt europaweit ten aus allen Bereichen des Denkmalschut-
Angelpunkt für den Erhalt des Kulturerbes ein extrem hohes Ansehen in der Branche. zes und ganz Europa, sondern bot auch den
in Europa und setzte in diesem Jahr starke Ihr gelingt es, die enorme Vielfalt der euro- perfekten Rahmen, um mit politischen Sta-
wirtschaftliche und politische Impulse“, er- paweiten Denkmalpflege und Restaurierung keholdern der Europäischen Union ins Ge-
klärt Markus Geisenberger, Geschäftsführer abzubilden. So konnten wir in diesem Jahr spräch zu kommen. Der Ansatz, die denkmal
der Leipziger Messe. „Gemeinsam mit der unter anderem Besucher aus Polen, Russland, 2018 zum offiziellen Höhepunkt im deut-
MUTEC, die sich als wichtiger Termin für Tschechien, der Schweiz, Österreich und schen Beitrag zum Europäischen Kulturerbe-
Betreiber von Museen und Kultureinrichtun- Belgien begrüßen“, so Mariella Riedel, Pro- jahr zu machen, ist voll aufgegangen“, erklärt
gen etabliert hat, bildet die denkmal einen jektdirektorin der denkmal und MUTEC. Dr. Uwe Koch, Leiter der Geschäftsstelle des
europaweit einzigartigen Messeverbund für Alle Beteiligten einte das große Interesse Deutschen Nationalkomitees für Denkmal-
Kulturerbe und Kulturgut.“ Der Messever- am Fachprogramm der denkmal, das in die- schutz (DNK).
bund verzeichnete in diesem Jahr eine Re- sem Jahr über 200 Veranstaltungen umfasste Gemeinsam mit den auf der denkmal ver-
kordbeteiligung mit über 550 Ausstellern aus und seinem Ruf als bedeutendste Fort- und tretenen Experten wurden Strategien erarbei-
20 Ländern. Weiterbildungsplattform der Branche er- tet, um den Erfolg der in diesem Jahr initiier-
Auf der denkmal präsentierten 448 Aus- neut mehr als gerecht wurde. „Die denkmal ten SHARING-HERITAGE-Projekte als
steller aus 19 Ländern ihre Produkte und ist nichts weniger als der Europa-Gipfel der Basis für die zukünftige europaweite Arbeit
Dienstleistungen aus allen Bereichen der fachlichen Expertise. Wer nicht hier war, zu nutzen. „Ich bin begeistert über die Eu-
Denkmalpflege und Restaurierung. Die be- hat einen Fehler gemacht“, sagt Dr. Markus phorie und Auf bruchsstimmung, die überall
teiligten Unternehmen und Institutionen Harzenetter, Vorsitzender der Vereinigung zu spüren war. Das Europäische Kulturer-
zogen ein überaus positives Fazit: „Die Mes- der Landesdenkmalpfleger in der Bundesre- bejahr SHARING HERITAGE offenbarte
se als langjähriger Partner hat für uns einen publik Deutschland. sich als großartige Aktion, insbesondere im
hohen Stellenwert. Wir sind sehr erfreut Im Rahmen der Messe wurden zahlreiche Sinne einer Stärkung des DNK als Anker
über die diesjährige denkmal. Unser Stand weitere begehrte Preise verliehen, allen vor- des deutschen Denkmalschutzes“, berichtet
ist überaus gut besucht. Kurz gesagt: Alles an die denkmal-Goldmedaille für herausra- Bernd Jäger, Vorsitzender des Restauratoren
passt für uns! Wir sind sehr zufrieden mit gende Leistungen in der Denkmalpflege in im Handwerk e.V.
dem diesjährigen Messegeschehen“, berich- Europa. Weitere Höhepunkte waren unter
tet Holger Schmidt, Leiter der Zimmerei bei anderem die Auszeichnung der Preisträger MUTEC verzeichnet wachsenden Zuspruch
Bennert. Auch Claudia Dahlmanns, Vergol- der 10. Messeakademie sowie die Verleihung Die internationale Fachmesse für Museums-
dermeisterin bei R.S.P., zeigt sich begeistert: des Bernhard-Remmers-Preises, des Bun- und Ausstellungstechnik MUTEC, die zum
„Mit der denkmal hatten wir eine Plattform deswettbewerbs „Europäische Stadt: Wandel zweiten Mal von der Leipziger Messe in Ei-
für zahlreiche schöne Gespräche und inter- und Werte“ und des Denkmalpflegepreises genregie veranstaltet wurde, verzeichnete
essante Kontakte. In Leipzig trifft man die der Handwerkskammer zu Leipzig. Erstmals ebenfalls einen wachsenden Zuspruch. 105
Kollegen, die Architekten, die Bauämter, die auf der denkmal wurde zudem der Peter Par- Aussteller aus zehn Ländern präsentierten
Ingenieure – das ist für uns das Hauptaufga- ler-Preis verliehen, der hochwertige Stein- Betreibern von Museen und Kultureinrich-
benfeld einer Messe. Die denkmal ist einfach metzkunst selbständiger Steinmetzmeister tungen aus dem In- und Ausland ihre Inno-
die größte Denkmalpflegemesse und daher und Steinbildhauer honoriert. vationen. Darüber hinaus war die MUTEC
sind wir hier!“ der Austragungsort verschiedener hochkarä-
Der Fachbesucheranteil lag bei rund 90 denkmal 2018 und SHARING HERITA- tiger Konferenzen und Tagungen.
Prozent und jeder sechste Besucher kam GE stellen die Weichen für zukünftige euro-
aus dem Ausland. Auch bei den Besuchern paweite Arbeit im Denkmalschutz Die nächste Auflage der denkmal und
herrschte eine hohe Zufriedenheit – 86 Pro- Die denkmal stand in diesem Jahr erneut MUTEC findet vom 5. bis 7. November
zent aller Besucher gaben an, ihre Messeziele unter der Schirmherrschaft der UNESCO. 2020 statt.
erreicht zu haben. Außerdem bildete sie den dritten und letzten
denkmal setzt Ausrufezeichen in puncto offiziellen Höhepunkt im deutschen Beitrag (Auszug aus der Pressemitteilung)
Restaurator im Handwerk | 4/2018 | Deutschland und die europäische Baukultur – Teil 2 87Sie können auch lesen