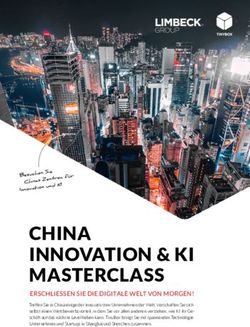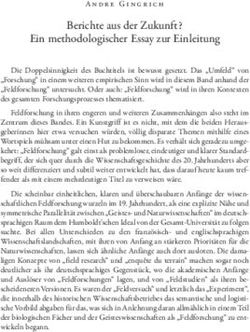Sammelrezension: Schule digital - Haymo Mitschian Repositorium für die Medienwissenschaft - media/rep
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Repositorium für die Medienwissenschaft Haymo Mitschian Sammelrezension: Schule digital 2020 https://doi.org/10.25969/mediarep/14938 Veröffentlichungsversion / published version Rezension / review Empfohlene Zitierung / Suggested Citation: Mitschian, Haymo: Sammelrezension: Schule digital. In: MEDIENwissenschaft: Rezensionen | Reviews, Jg. 38 (2020), Nr. 2-3, S. 313–316. DOI: https://doi.org/10.25969/mediarep/14938. Nutzungsbedingungen: Terms of use: Dieser Text wird unter einer Creative Commons - This document is made available under a creative commons - Namensnennung 3.0/ Lizenz zur Verfügung gestellt. Nähere Attribution 3.0/ License. For more information see: Auskünfte zu dieser Lizenz finden Sie hier: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Medien und Bildung 313 Sammelrezension: Schule digital Die Digitalisierung des Lernens und sprechend, einen Blick in die nähere Lehrens hat durch die Corona-Krise und fernere Zukunft. Deshalb finden enorm an Bedeutung und Zuspruch sich hier ganz konkrete und detaillierte gewonnen, weshalb die beiden Publi- Angaben zur Organisation digitaler kationen zu einem günstigen Zeitpunkt Lernformen, etwa zur Finanzierung, zur Verfügung stehen. Beide befassen zum Datenschutz oder zum tech- sich mit Fragen zur gegenwärtigen und nischen Support, aber auch zum Teil zukünftigen Nutzung digitaler Tech- stark appellative, unmittelbar aus den nik zur Unterstützung und Förderung eigenen Erfahrungen abgeleitete Vor- von Lehr-Lernvorgängen, der eine schläge zur künftigen Gestaltung von Band primär für Schulen (Steppuhn), Schule und Lernen. der andere für Hochschulen (Kergel/ Steppuhn zählt zu den Lehrenden, Heidkamp-Kergel), beide aber auch mit die sich neben der Didaktik tief in unterschiedlichen Blickrichtungen und die technologischen Grundlagen des Herangehensweisen. digitalen Lehrens und Lernens einar- Detlef Steppuhn stellt sich am beiten und deshalb auf beiden Gebie- Anfang seines Buchs ausführlich ten Kompetenzen aufweisen. So kann selbst vor, wie er auch insgesamt aus er detailliert über die technischen einer sehr persönlichen Perspektive Voraussetzungen, Optionen, aber auch schreibt. Seine Ausführungen basieren Stolperfallen berichten, die bei einer auf einer fast 30jährigen Lehrerfahrung grundlegenden Digitalisierung des am Erich-Gutenberg-Berufskolleg in Unterrichtens an einer Schule vorhan- Köln auf dem Posten als „Leiter Neue den sein können. Wegen der in einer Technologien und Medien“ (S.XIX). In Smart School zunehmenden Technolo- seinem Buch verarbeitet er zum einen gisierung des Unterrichts plädiert er die Erfahrungen an dieser in Sachen für die Einrichtung eines schulinter- Digitalisierung vielfach preisgekrönten nen Support-Teams, da „Einzelkämp- Schule, zum anderen wirft er auch, dem fer“ (S. 109) wie er die Anforderungen Untertitel Die Schule von morgen ent- der Zukunft nicht mehr bewältigen
314 MEDIENwissenschaft 02-03/2020 werden können. Darüber hinaus for- bei der Robotik aus, wonach in abseh- dert er aber auch umfassende bauliche barer Zeit Roboter Aufgaben bei der Veränderungen an den Schulen, deut- emotionalen Betreuung von Menschen, lich mehr Flexibilität und Offenheit auch von Lernenden, übernehmen und auf Seiten von Behörden, Schulträgern zum Beispiel im Fremdsprachenunter- und Lehrenden und natürlich für ein richt eingesetzt werden (S.56), wobei er viel stärkeres finanzielles Engagement dessen Weiterexistenz generell anzwei- der verantwortlichen Stellen. Ohne felt: „Simultanübersetzer wie bspw. grundlegende Veränderungen der Rah- [sic!] Skype werden das Erlernen einer menbedingungen laufen seiner Ansicht Fremdsprache obsolet machen“ (S.135). nach alle didaktischen Maßnahmen ins Gerade von der Wirklichkeit eingeholt Leere. wirken dagegen die Ausführungen zu Ganz konkret beschreibt er dagegen school@home, bei denen er sich zu sehr die Projekte, die in der Vergangen- auf eine Variante verlegt: Überzeugend heit an seiner Schule initiiert wurden, verweist er auf die Vorteile der Koo- und die er auch in hohem Maße für peration mit „Giganten“ (z. B. S.91f.) zukunftsrelevant hält. Grundlegend der Computer- beziehungsweise Inter- ist dabei das BYOD-Konzept (Bring nettechnologie und die Nachteile der Your Own Device), also die Nutzung Abhängigkeit von kleineren Firmen, der digitalen Geräte der Lernenden die schnell vom Markt verschwinden an Stelle von schulischen, mit entspre- können. Kein Geheimnis macht er chenden Einstellungsveränderungen dabei aus der Kooperation seiner Schule gegenüber Smartphones im Unterricht. mit Microsoft und Produkten aus diesem Als besonders zukunftsträchtig stuft Haus, in erster Linie mit Office 365. er die Robotik, virtual oder augmen- Insgesamt trägt das Buch von ted reality sowie eSports und gamifi ca- Steppuhn einen Doppelcharakter. tion ein. Da er dazu zunächst von den Einerseits berichtet und beschreibt Erfahrungen an seiner Schule berich- er sehr fundiert die Erfahrungen mit tet (S. 53-73), später dann beim ema digitalem Lehren und Lernen an seiner „Kompetenzerwerb durch Fortbil- Schule, wobei durch die Besonderheiten dungen“ (S.115-182) sowie im Kapitel einer Berufsschule die Anforderungen 9 „Unterrichtsbeispiele“ immer wieder an allgemeinbildende Schulen und auf diese Bereiche zurückkommt und die dort anzubietenden Standardfä- sich für deren Ausweitung ausspricht, cher gelegentlich etwas an den Rand sorgt er für inhaltliche Wiederho- geraten. Doch für alle, die die Digi- lungen. Sein unverkennbares Engage- talisierung einer Bildungseinrichtung ment für diese Lehr-Lernformen führt vorantreiben wollen oder müssen, liefert ihn dabei gelegentlich schon sehr weit er praxisorientiertes Fachwissen, das in die Zukunft beziehungsweise zu nur neben technischen auch organisato- noch schwer nachvollziehbaren Argu- rische und rechtliche Aspekte mit ein- mentationsfolgen. Sehr optimistisch schließt. Auf der anderen Seite scheint fällt so seine Perspektivenbeschreibung ihn seine Begeisterung für die neuen
Medien und Bildung 315
Technologien gelegentlich schon zu Ziel der Ausführungen ist es sogar, „die
weit in die Zukunft zu tragen, wobei toretische Komplexität des E-Learning
ein Blick in die Vergangenheit mit handlungspragmatisch für die Praxis“
ihren zahlreichen Ankündigungen von (S.1) aufzuarbeiten.
dann doch ausgebliebenen Revolutionen Bei ihrem Plädoyer für den Kon-
des Lernens als Korrektiv wirken könnte nektivismus als „Lerntheorie für das
(vgl. hierzu: Papert, Seymour: Revo- digitale Zeitalter“ (S.10ff.) stützen sie
lution des Lernens. Hannover: Heise- sich hauptsächlich auf einen Artikel
Verlag, 1994). Auch eine Diskussion von George Siemens, einer Lehrkraft
von an Schulen erreichbaren Lern- am Red River College in Winnipeg,
zielen und Konkretisierungen zu den welcher Urheber einer ELearning
neuro-didaktischen Konzepten (S.100; website ist, die inzwischen nicht mehr
S.186), die er mehrfach erwähnt, aber unter der angegebenen Adresse abruf-
welche nur schemenhaft erkennbar bar ist. Dass der zitierte Artikel von
werden, wären hilfreich, um die Reali- Siemens im Januar 2005 erschienen ist
sierungschancen der Vorschläge besser und nicht wie angegeben 2004, stört
abschätzen zu können. Auch wäre ein in einem Text mit wissenschaftlichen
Kapitel wünschenswert, in dem grund- Ansprüchen durchaus, mehr noch
legend über die Aufgaben der Schulen verwundert die Bedeutung, die die
in Gegenwart und näherer Zukunft Autor_innen diesem achtseitigen Text
reflektiert würde. Denn in der Summe eines college-instructors zuschreiben, den
dürfte Steppuhn mit seinen Forde- sie wiederholt als maßgebliche Autori-
rungen die Kapazitäten und Möglich- tät (S.59, S.65) heranziehen. Denn der
keiten hierzulande und in absehbarer Konnektivismus ist wesentlich älter und
Zeit deutlich überfordern. Doch trotz von anderen geprägt worden. Er bringt
einiger vermutlich recht kurzlebiger Grundannahmen des Konstruktivis-
Detailangaben zur Technologie enthält mus mit kybernetischen Lernformen
sein Buch vielfältige Informationen und zusammen und geht auf die Entwick-
Denkanstöße, mit denen er einen Bei- lung künstlicher Intelligenz und neu-
trag zur dringend notwendigen Digita- ronaler Netze zurück (vgl. Mitschian,
lisierung von Schulen leistet. Haymo: „Vom Behaviorismus zum
Ähnlich wie Steppuhn stellen auch Konstruktivismus. Das Problem der
Kergel/Heidkamp-Kergel eine unmit- Übertragbarkeit lernpsychologischer
telbare Verbindung zwischen digitalen und -philosophischer Erkenntnisse in
Lernmitteln und neueren Ansätzen der die Fremdsprachendidaktik.“ In: Zeit-
Lerntheorie her. Während Ersterer auf schrift für Interkulturellen Fremdspra-
neuro-didaktische Lernformen refe- chenunterricht 4[3], 2000, S.1-29, hier
riert, sieht das Autorenpaar im Kon- S.12f).
nektivismus beziehungsweise einem Generell gilt für die Ausführungen
„Sozio-Konstruktivismus“ (S.6) die von Kergel/Heidkamp-Kergel zu lern-
angemessene Grundlage für das digi- theoretischen und didaktischen Grund-
tale Lehren und Lernen. Explizites lagen, dass sie dabei sehr eklektizistisch316 MEDIENwissenschaft 02-03/2020
vorgehen – etwa mit knappen Verwei- erklärt und es bleibt bei sehr allgemein
sen auf Humboldt (S.18), Freinet (S.18), gehaltenen Beschreibungen einiger
Bandura (S.19) oder Baudrillard (S.38f.) Projekte. Symptomatisch für die Unver-
– und zu fragwürdigen Feststellungen bundenheit und Unverbindlichkeit der
kommen, wie etwa: „Grundsätzlich Ausführungen dürfte die Wiederholung
lässt sich Didaktik als Methode defi- einer Tabelle von Seite 39 auf Seite 87
nieren“ (S.12) oder später: „Mobile zur „Konvergenz zwischen Lernen und
Learning ist kein E-Learning mehr“ Technologie“ sein, die nur wenig aussa-
(S.86). Vieles von dem, was sie in einer gekräftige Termini aufl istet.
„E-Didaktik […] Kriterien-Checkliste“ Verknüpfungen von neuen Lehr-
(S.15-27) anführen, gilt genauso für Lerntechnologien mit gleichzeitig
das bisherige papiergestützte Lernen. neuen lerntheoretischen Ansätzen
Fraglich ist zudem die Bezugnahme haben sich seit der Verbindung des
auf medienpädagogische Konzepte aus Programmierten Lernens mit dem
den 90er Jahren, die Kompetenzen im Behaviorismus immer wieder als
Umgang mit Massenmedien einfor- nachteilig für beide Seiten erwiesen.
dern, die in keinem primären Zusam- Die Optionen des digital-vernetzten
menhang mit Lernmedien stehen und Lehrens und Lernens mit dem Kon-
deshalb genauso wenig gerechtfertigt struktivismus zu kombinieren, von
sind, wie die ausführliche Beschreibung Luhmann bereits 1988 als letzte
des Memex-Projekts von Vannevar Mode der Erkenntnistheorie bezeich-
Bush (S.50-53) aus den 1940er Jahren. net (Erkenntnis als Konstruktion. Bern:
Nur etwas konkreter wird es in den Benteli Verlag, 1988), trägt wiede-
beiden hochschuldidaktischen Praxis- rum das Potenzial in sich, beiden zu
kapiteln 6 und 7, obgleich auch hier schaden. Der Erkenntnisgewinn, der
ein eklektizistisches Vorgehen vor- aus dem schmalen Band von Kergel/
herrscht. Dass die „kleine Geschichte Heidkamp-Kergel zu ziehen ist, wird
des E-Learning“ (S.57-60) ebenso wie zudem durch den geringen Grad an
die nachfolgende „kleine Auswahl“ Systematik und wissenschaftlicher
(S.61-87) an E-didaktischen Ansätzen Gründlichkeit gemindert, weshalb
keine systematisch-strukturierten Ein- nur wenige Leser_innen einen Nutzen
blicke in die digitale Lehr-Lernpraxis aus der Beschäftigung damit werden
liefert, lassen bereits die Überschriften ziehen können.
erkennen. Aber auch inhaltlich wird
nur wenig fundiert informiert oder Haymo Mitschian (Göttingen)Sie können auch lesen